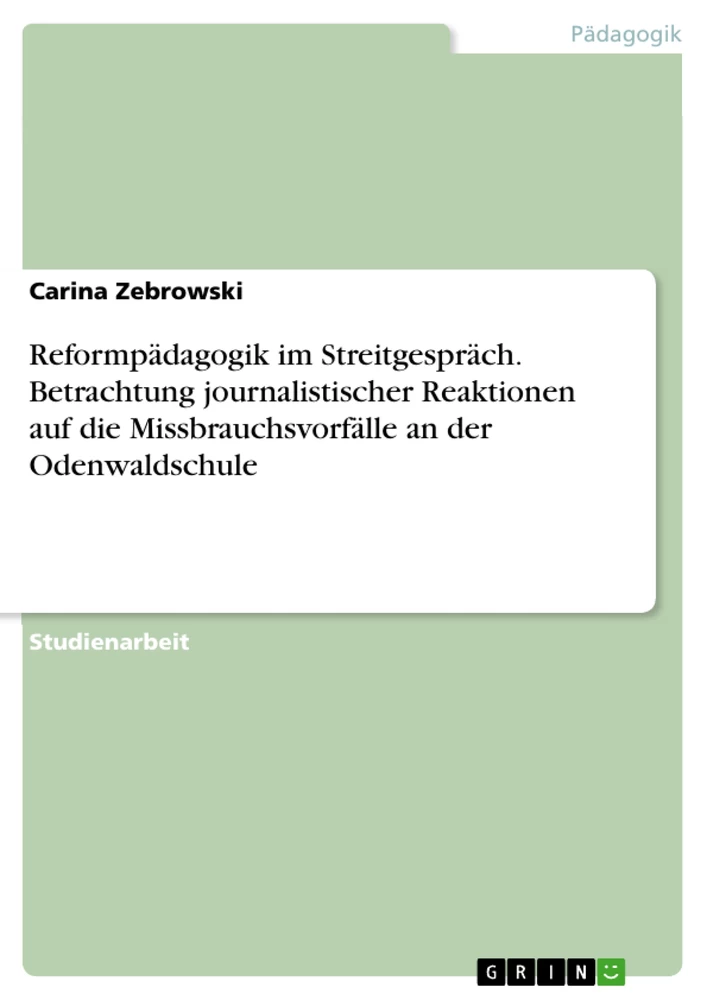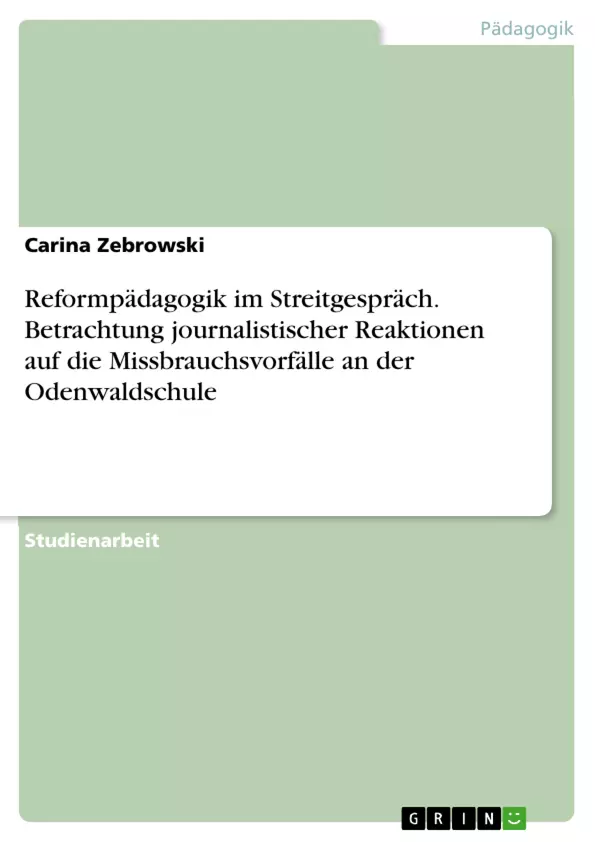„Lehrer müssen nicht geliebt werden“ sagt SPD-Politikerin Gabriele Behler. Die Balance von Nähe und Distanz zwischen Lehrern und Schülern sei zu definieren, denn „statt des ‚pädagogischen Eros‘ bedarf es eines professionellen Ethos für den Lehrerberuf.“ In ihrem Artikel fallen Begriffe wie „Bildungskitsch“ und „Sozialromantik“, die sie mit den Konzepten der Reformpädagogik in Verbindung bringt, da die Reformpädagogen „ihre Praxis als politisch korrekte Antwort auf die Pisa-Ergebnisse reklamierte“, obwohl diese Praxis wissenschaftlich nicht bestätigt sei.
Hinsichtlich der bekannt gewordenen Missbrauchsvorfälle an der Odenwaldschule, einem reformpädagogisch ausgerichteten Landerziehungsheim in Ober-Hambach, lassen sich derartige Vorwürfe gegen die Theorie der Reformpädagogik immer wieder in den Medien vernehmen. Behler fordert, die Reformpädagogik müsse endlich hart mit sich selbst ins Gericht gehen, denn sie habe versagt.
Gleichzeitig gibt es verteidigende Reaktionen auf derartige Anschuldigungen, [...]. Als Verteidiger des reformpädagogischen Bildungsansatzes ruft er dem Leser Schopenhauers Motto „Was dem Herzen widerstrebt, lässt der Kopf nicht rein“ gleich zweimalig in seinem Artikel in Erinnerung; der Kern verkümmere, wenn ihn nicht eine nährende Hülle umgebe und daher sei das Lernen mit Hirn, Herz und Hand notwendig [...].
Schon in diesen journalistischen Artikeln werden die beiden Grundpositionen, die seit einiger Zeit öffentlich diskutiert werden, überaus deutlich. Auf der einen Seite werden die Theorie und die Praxis der Reformpädagogik kritisiert, wenn es um "ganzheitliche Erziehung" und das freundschaftlich-kameradschaftliche Lehrer-Schüler-Verhältnis geht, die derartige Missbrauchsfälle, wie die an der Odenwaldschule, begünstigen würden. Auf der anderen Seite werden gerade diese Elemente als förderlich für ein erfolgreiches und umfassendes Lernen angesehen, was auch in den öffentlichen Schulen immer mehr zur Sprache und Praxis kommt.
Die folgende Ausarbeitung wird zunächst eine Grundlage schaffen, indem das Konzept der
Odenwaldschule anhand ihrer Homepage dargestellt und mit der Reformpädagogik in
Verbindung gebracht wird. Sie wird im Weiteren journalistische Texte zu diesem Thema
betrachten und vergleichen, um die unterschiedlichen Positionen vor allem zu den genannten
Themen der „Gemeinschaft“ und der „pädagogischen Liebe“ zu verdeutlichen, um im Fazit
schließlich zu einer Beurteilung dieses Streitgesprächs um die Schuldfrage zu gelangen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Der Internetauftritt der Odenwaldschule
- Die Homepage
- Reformpädagogische Elemente an der Odenwaldschule
- Aktuelle Auseinandersetzungen mit den reformpädagogischen Idealen
- Das Landerziehungsheim als „Polis im Kleinen"
- Die „pädagogische Liebe" im Streitgespräch
- Fazit
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Hausarbeit befasst sich mit den journalistischen Reaktionen auf die Missbrauchsvorfälle an der Odenwaldschule und setzt diese in Beziehung zur Reformpädagogik. Sie analysiert die verschiedenen Positionen im Streitgespräch über die Schuldfrage und untersucht, ob und inwiefern die reformpädagogischen Ideale eine Rolle bei den Missbrauchsfällen spielen.
- Die Rolle der Gemeinschaft in der Reformpädagogik und die Bedeutung des Landerziehungsheims als „Polis im Kleinen"
- Das Konzept der „pädagogischen Liebe" und die Frage nach der Nähe und Distanz im Lehrer-Schüler-Verhältnis
- Die Kritik an der Reformpädagogik im Kontext der Missbrauchsfälle
- Die Verteidigung der Reformpädagogik und die Betonung ihrer positiven Aspekte
- Die Frage nach der Verantwortung der Reformpädagogik für die Missbrauchsfälle
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema ein und stellt die beiden gegensätzlichen Positionen im Streitgespräch über die Reformpädagogik dar. Der zweite Teil der Arbeit analysiert den Internetauftritt der Odenwaldschule und zeigt die reformpädagogischen Elemente auf, die auf der Homepage präsentiert werden. Im dritten Teil werden journalistische Texte betrachtet, die sich kritisch mit den reformpädagogischen Idealen auseinandersetzen und die Frage nach der Verantwortung der Reformpädagogik für die Missbrauchsfälle aufwerfen. Der Fokus liegt dabei auf den Themen „Gemeinschaft" und „pädagogische Liebe".
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen die Reformpädagogik, Landerziehungsheime, Odenwaldschule, Missbrauchsfälle, pädagogische Liebe, Gemeinschaft, Polis im Kleinen, Lehrer-Schüler-Verhältnis, Nähe und Distanz. Die Arbeit analysiert die journalistischen Reaktionen auf die Missbrauchsfälle und setzt diese in Beziehung zur Reformpädagogik, um die verschiedenen Positionen im Streitgespräch über die Schuldfrage zu beleuchten.
Häufig gestellte Fragen
Welche Vorwürfe wurden gegen die Odenwaldschule erhoben?
Nach bekannt gewordenen Missbrauchsvorfällen wurde kritisiert, dass die pädagogischen Konzepte der Schule solche Übergriffe begünstigt haben könnten.
Was ist das Problem mit dem "pädagogischen Eros"?
Kritiker fordern statt eines emotionalen "Eros" ein professionelles Ethos, um die notwendige Distanz zwischen Lehrern und Schülern zu wahren.
Wie verteidigen Befürworter die Reformpädagogik?
Sie betonen das ganzheitliche Lernen mit "Hirn, Herz und Hand" und sehen ein enges Gemeinschaftsgefühl als förderlich für den Bildungserfolg an.
Was bedeutet der Begriff "Polis im Kleinen"?
Das Landerziehungsheim wird als eine Art Miniatur-Gesellschaft verstanden, in der Gemeinschaft und demokratisches Miteinander im Zentrum stehen.
Welche Rolle spielt der Internetauftritt der Odenwaldschule in der Analyse?
Die Arbeit untersucht die Homepage der Schule, um die dort präsentierten reformpädagogischen Ideale mit der medialen Kritik abzugleichen.
- Arbeit zitieren
- Carina Zebrowski (Autor:in), 2011, Reformpädagogik im Streitgespräch. Betrachtung journalistischer Reaktionen auf die Missbrauchsvorfälle an der Odenwaldschule, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/267214