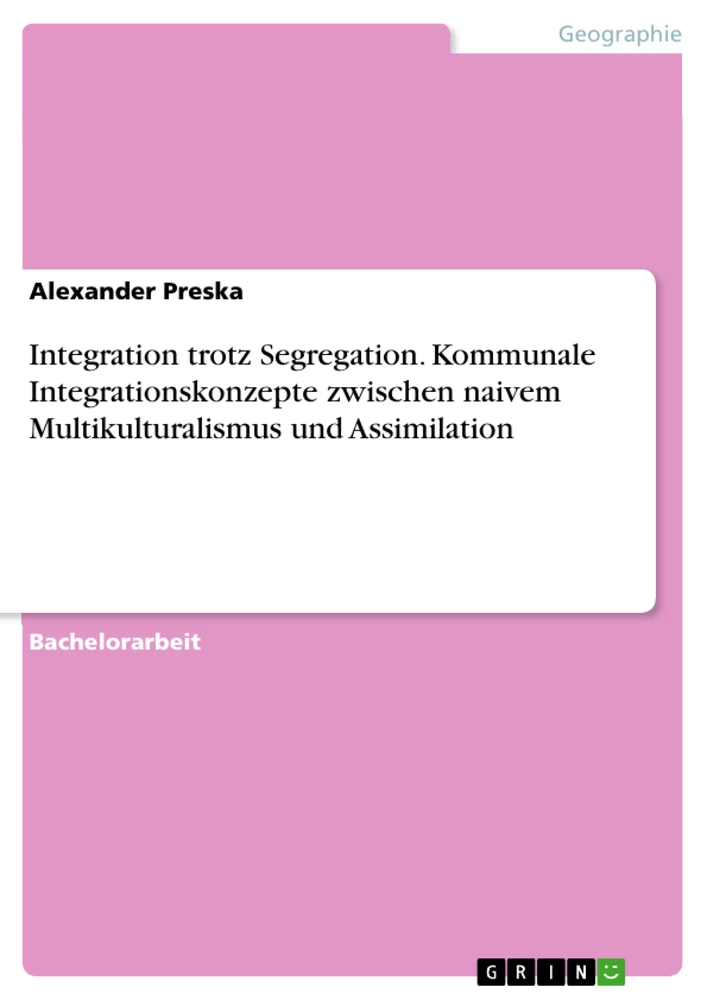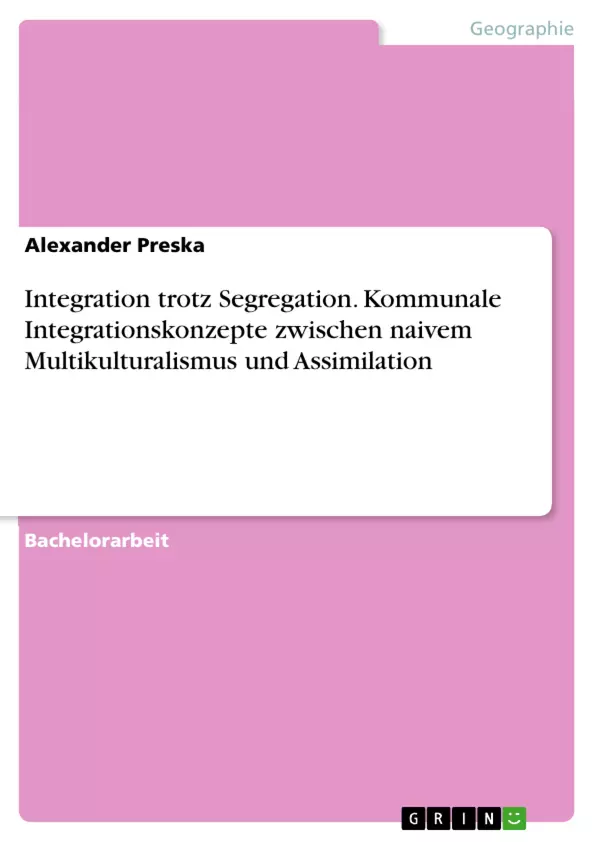Deutschland ist ein Einwanderungsland. Diese Erkenntnis hat lange Zeit gebraucht. Dabei ist die Bundesrepublik Deutschland seit über 50 Jahren von Zuwanderung geprägt (Reimann 2008: 195). Laut Mikrozensus 2005 habe sogar jeder fünfte Deutschlands und jedes dritte Kind unter sechs Jahren einen Migrationshintergrund.
Unabhängig davon könnte man meinen, dass die hitzige Debatte des letzten Jahres um das Thema Integration von Thilo Sarrazin alleine entfacht wurde, obwohl sie dadurch lediglich erst einmal in ein größeres öffentliches Interesse gerückt wurde. Teils wird sogar vom „Sarrazin-Effekt“ gesprochen, was natürlich die Brisanz um das Thema verdeutlicht. Seither wird in der öffentlichen und politischen Debatte darüber hinaus von „Integrationsverweigerern“ gesprochen und Heitmeyers Wortschöpfung „Parallelgesellschaft“ erreichte schon zur Wahl des Wortes 2004 die Zweitplatzierung. Justizministerin Leutheusser-Schnarrenberger geht noch weiter: „Um Integrationsverweigerer zu bestrafen, ist die derzeitige Gesetzeslage völlig ausreichend“. Da scheint es nicht verwunderlich, dass laut Bertelsmannumfrage 63 % der Deutschen der Meinung sind, dass die hierzulande wohnenden Migranten schlecht integriert seien (Bertelsmann-Stiftung 2011: 4).
Doch was heißt Integration? Ist jemand, der die deutsche Sprache beherrscht und einen Arbeitsplatz hat, schon integriert? Zugespitzt: Ist die Lehrerin, die den Schuldienst nicht antreten kann, weil sie nicht auf das Kopftuch verzichten möchte, dann eine „Integrationsverweigerin“? Ist die Migrantin, die alle nötigen Voraussetzungen für ein Hochschulstudium erfüllt nicht schon längst strukturell integriert? Wie weit müssen sich Migranten an unsere Kultur anpassen?
Der sich vornehmlich aus ideologischer Sichtweise speisende Diskurs scheint auch die Aufnahmegesellschaft weiter zu spalten. Die bestehende Divergenz bezüglich historisch gewachsener Werte, wie z.B. analytischem Denken oder Kritizismus, um nur zwei Beispiele zu nennen, und darüber hinaus, in einer größtenteils säkularisierten und individualistisch geprägten Gesellschaft, stellt für viele Migranten eine Überforderung dar. Die daraus ersichtliche Gratwanderung, bedingt durch die Sozialisation in ihrem ursprünglichen Kulturkreis einerseits, und den Ansprüchen einer auf Fortschritt und Moderne geprägten Gesellschaft andererseits, stellt eine zunehmende Herausforderung dar.
Die Arbeit führt in integrationstheoretische Ansätze und Modelle ein und prüft Integrationskonzepte.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Integrationstheoretische Ansätze und Modelle
- Die Assimilation
- Frühe assimilatorische Ansätze
- Neuere assimilatorische Ansätze
- Der Multikulturalismus
- Die Assimilation
- Segregation
- Integration vor Ort - Kommunale Integrationskonzepte im Umgang mit Segregation
- Konzept der Kategorie 1
- Konzept der Kategorie 2
- Konzept der Kategorie 3
- Fazit
- Literaturverzeichnis
- Abbildungs- und Tabellenverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Bachelorarbeit befasst sich mit dem Thema der Segregation im Kontext kommunaler Integrationskonzepte. Sie analysiert die Integrationspolitik zwischen den Modellen des naiven Multikulturalismus und der Assimilation und untersucht, wie kommunale Konzepte mit dem Phänomen der Segregation umgehen.
- Integrationstheoretische Ansätze und Modelle: Assimilation und Multikulturalismus
- Soziale und räumliche Segregation als Ausdruck sozialer Ungleichheit
- Kommunale Integrationskonzepte im Umgang mit Segregation
- Analyse von drei exemplarischen Integrationskonzepten
- Bewertung der Integrationspolitik in Deutschland
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Relevanz des Themas Integration im Kontext der Einwanderungsgesellschaft Deutschlands dar und beleuchtet die Debatte um den Integrationsbegriff und das Phänomen der Parallelgesellschaften. Sie führt in die Zielsetzung und den Aufbau der Arbeit ein.
Kapitel 2 behandelt die integrationstheoretischen Ansätze und Modelle. Es werden die Assimilation und der Multikulturalismus als zwei zentrale Konzepte vorgestellt, die sowohl in der wissenschaftlichen Literatur als auch in der politischen Diskussion eine wichtige Rolle spielen. Die verschiedenen Dimensionen und Auswirkungen der Assimilation werden erläutert, sowie die verschiedenen Formen des Multikulturalismus und ihre Implikationen für die Integration.
Kapitel 3 beschäftigt sich mit dem Phänomen der Segregation. Es werden verschiedene Formen und Ursachen von Segregation erläutert, insbesondere die soziale und räumliche Segregation, sowie die ethnische Segregation. Die Arbeit beleuchtet die Ambivalenz der Segregation als sowohl Ressource als auch Beschränkung der Lebenschancen von Migranten und die Auswirkungen auf die Integration.
Kapitel 4 analysiert drei exemplarische kommunale Integrationskonzepte im Hinblick auf ihren Umgang mit Segregation. Es werden drei Kategorien von Konzepten unterschieden: multikulturelle, gemischte und assimilatorische Konzepte. Die Analyse zeigt, wie die verschiedenen Konzepte das Problem der Segregation adressieren und welche Integrationsvorstellungen sie vertreten.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen die Integration, Segregation, Multikulturalismus, Assimilation, kommunale Integrationskonzepte, Parallelgesellschaften, ethnische Segregation, soziale Mischung, Stadtentwicklung und die Integrationsdebatte in Deutschland.
- Quote paper
- Bachelor of Arts Alexander Preska (Author), 2012, Integration trotz Segregation. Kommunale Integrationskonzepte zwischen naivem Multikulturalismus und Assimilation, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/267590