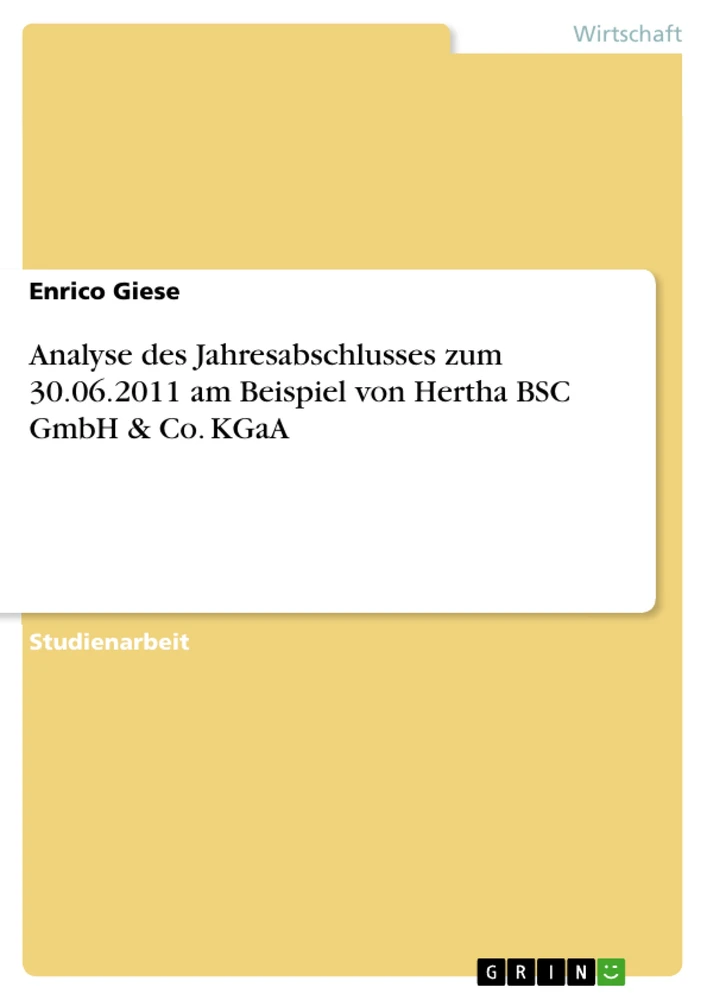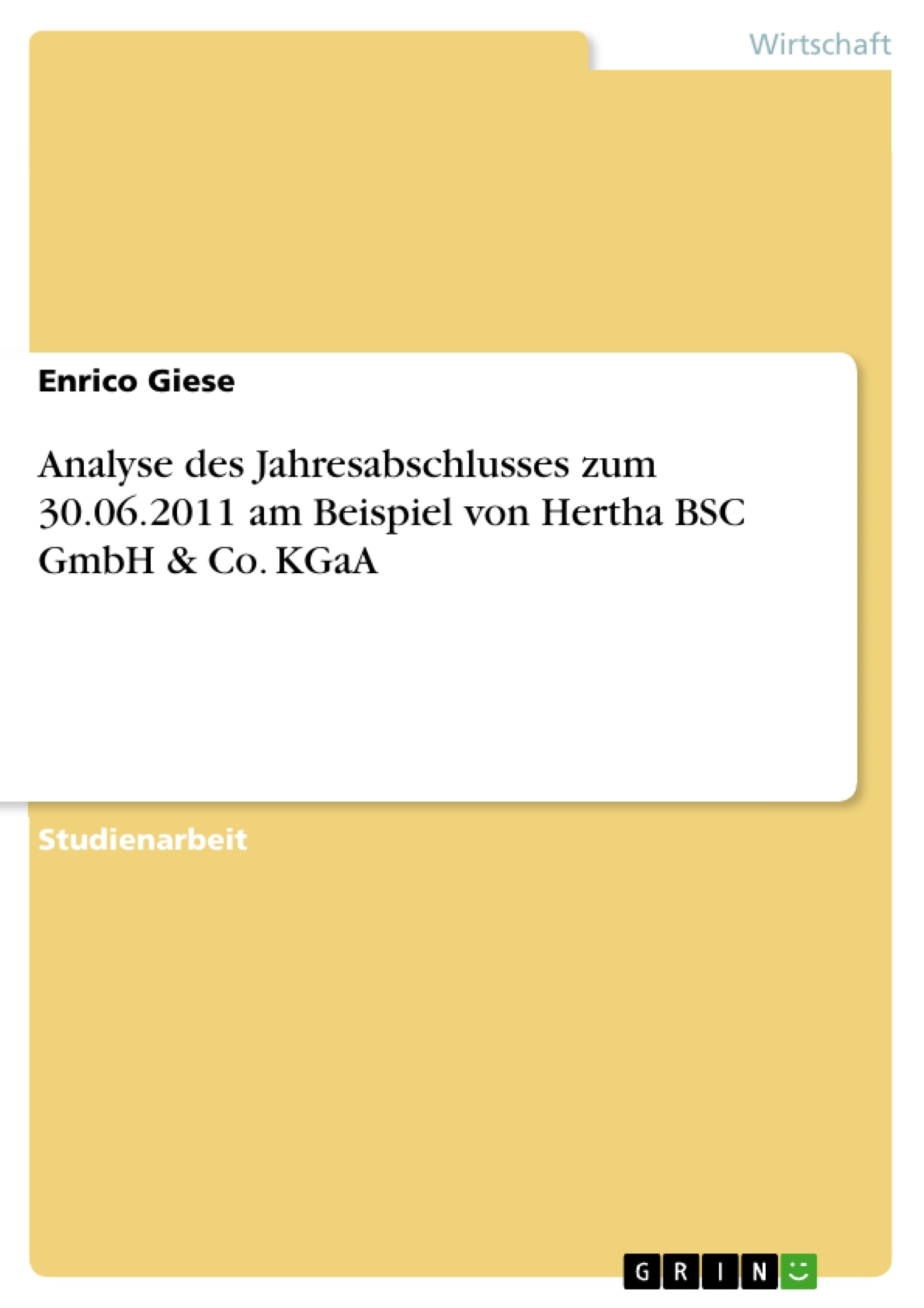Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Analyse des Jahresabschlusses der Hertha BSC GmbH & Co. KGaA. Sie besitzt das Ziel einen Einblick in die Jahresabschlussanalyse zu bekommen und zusätzlich einen konkreten Überblick von der finanziellen Lage des Unternehmens zu erhalten. Der Hauptteil der Arbeit besteht aus der Analyse der Kennzahlen. Dabei kommt vor allem die wesentlich risikobehaftete Situation des Unternehmens zum Vorschein, welche über die Finanz- und Ertragslage deutlich wird. Des Weiteren fallen das fehlende Eigenkapital und die deutliche Abhängigkeit von FK-Gebern auf. Dem entgegenwirkend ist die Vermögenslage etwas positiver zu bewerten, obwohl hierbei ebenfalls einige Kennzahlen unter Beobachtung stehen.
Der Gesamteindruck der Jahresabschlussanalyse ist im Großen und Ganzen leicht positiv. Es wird vereinzelt deutlich, dass das Unternehmen bereits die Initiative ergriffen hat, um der Überschuldung entgegenzutreten. Darüber hinaus werden detaillierte Aussagen zur Verschuldung in naher Zukunft erst möglich, wenn die Entwicklung des Unternehmens abgewartet wird.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung.
- 2. Grundlagen der Jahresabschlussanalyse.
- 2.1 Begriffsbestimmung und Zielsetzung
- 2.2 Der Adressatenkreis einer Jahresabschlussanalyse.
- 2.3 Vorbereitung der Jahresabschlussanalyse..
- 2.4 Ablauf der Jahresabschlussanalyse.....
- 3. Aufbereitung des Jahresabschlusses der Hertha BSC GmbH & Co. KGaA.....
- 3.1 Erstellung von Strukturbilanz und strukturierter GuV
- 3.1.1 Die Strukturbilanz..
- 3.1.2 Die strukturierte GuV
- 4. Instrumente der Jahresabschlussanalyse
- 4.1 Kennzahlen der Jahresabschlussanalyse
- 4.1.1 Analyse der Vermögenslage
- 4.1.2 Analyse der Kapitalstruktur.
- 4.1.3 Analyse der Ertragslage
- 4.2 Zahlungsstrombasierte Kennzahlen.
- 4.2.1 Veränderungsbilanz
- 4.2.2 Bewegungsbilanz
- 4.2.3 Kapitalflussrechnung.....
- 4.2.4 Cash-Flow Analyse...
- 5. Schlusswort und Fazit........
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit analysiert den Jahresabschluss der Hertha BSC GmbH & Co. KGaA, um Einblicke in die Jahresabschlussanalyse zu gewinnen und die finanzielle Lage des Unternehmens zu beleuchten. Der Fokus liegt dabei auf der Analyse von Kennzahlen, die die Risikobehaftung, die Kapitalstruktur und die Vermögenslage des Unternehmens aufzeigen.
- Analyse der Risikobehaftung und der finanziellen Situation
- Untersuchung der Kapitalstruktur und der Abhängigkeit von Fremdkapitalgebern
- Bewertung der Vermögenslage und Analyse relevanter Kennzahlen
- Beurteilung der Initiativen zur Bewältigung der Überschuldung
- Prognose der zukünftigen Entwicklung des Unternehmens
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema der Jahresabschlussanalyse ein und erläutert die Zielsetzung der Arbeit. Kapitel 2 behandelt die Grundlagen der Jahresabschlussanalyse, einschließlich Begriffsbestimmungen, Adressatenkreis und Ablauf der Analyse. Kapitel 3 widmet sich der Aufbereitung des Jahresabschlusses der Hertha BSC GmbH & Co. KGaA, insbesondere der Erstellung von Strukturbilanz und strukturierter GuV. In Kapitel 4 werden die Instrumente der Jahresabschlussanalyse vorgestellt, einschließlich Kennzahlen der Vermögenslage, Kapitalstruktur und Ertragslage sowie zahlungsstrombasierte Kennzahlen wie Veränderungsbilanz, Bewegungsbilanz, Kapitalflussrechnung und Cash-Flow Analyse.
Schlüsselwörter
Jahresabschlussanalyse, Hertha BSC GmbH & Co. KGaA, Kennzahlen, Vermögenslage, Kapitalstruktur, Ertragslage, Risikobehaftung, Überschuldung, Zahlungsstrombasierte Kennzahlen, Strukturbilanz, strukturierte GuV.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Hauptziel dieser Jahresabschlussanalyse?
Ziel ist es, einen Einblick in die finanzielle Lage der Hertha BSC GmbH & Co. KGaA zum Stichtag 30.06.2011 zu gewinnen und die Risikobehaftung des Unternehmens zu bewerten.
Wie wird die finanzielle Situation des Clubs in der Arbeit bewertet?
Die Lage wird als wesentlich risikobehaftet eingestuft, insbesondere aufgrund fehlenden Eigenkapitals und einer starken Abhängigkeit von Fremdkapitalgebern.
Welche Instrumente der Analyse werden verwendet?
Es werden Kennzahlen zur Vermögens-, Kapital- und Ertragslage sowie zahlungsstrombasierte Instrumente wie die Kapitalflussrechnung und Cash-Flow-Analyse genutzt.
Was ist eine Strukturbilanz?
Eine Strukturbilanz ist eine für Analysezwecke aufbereitete Bilanz, bei der Posten nach Fristigkeit oder funktionalen Kriterien zusammengefasst werden.
Gibt es Anzeichen für eine Besserung der wirtschaftlichen Lage?
Die Arbeit stellt fest, dass das Unternehmen bereits Initiativen ergriffen hat, um der Überschuldung entgegenzutreten, wobei der Gesamteindruck leicht positiv bewertet wird.
Wer gehört zum Adressatenkreis einer solchen Analyse?
Dazu gehören unter anderem potenzielle Investoren, Gläubiger, die Vereinsführung sowie die interessierte Öffentlichkeit.
- Quote paper
- Enrico Giese (Author), 2013, Analyse des Jahresabschlusses zum 30.06.2011 am Beispiel von Hertha BSC GmbH & Co. KGaA, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/267781