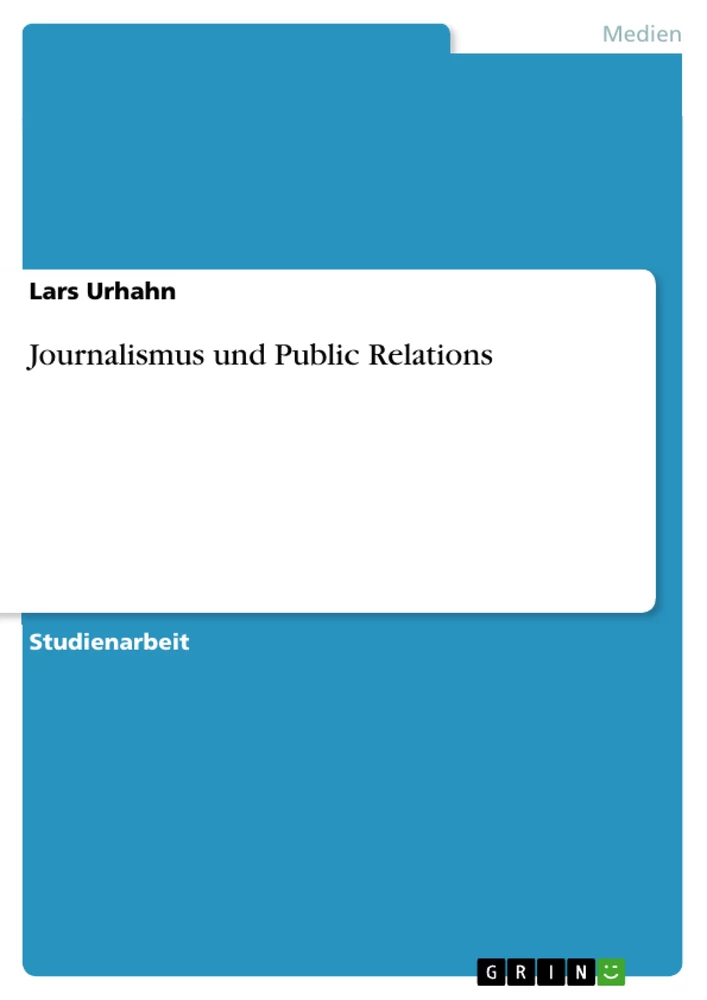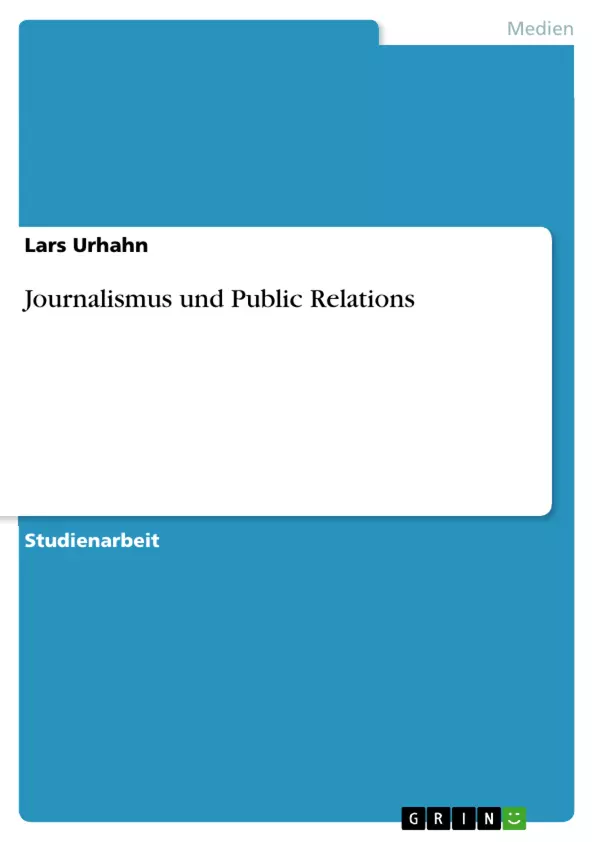Ziel der Arbeit ist es, nach einem kurzen Exkurs zur Entwicklung der beiden Disziplinen, das Verhältnis zwischen Journalismus und PR zu untersuchen und dabei
vor allem auf die Frage einzugehen, ob Journalismus und PR sich mehr und mehr vermischen. Im Rahmen dieser Fragestellung werden sowohl die berufsspezifischen
Kodizes als auch deren Umsetzung vorgestellt und dabei besonders auf die Unterschiede zu den Positionen des Netzwerks Recherche verwiesen. Zudem werden
empirische Ergebnisse thematisiert und deren Relevanz im Hinblick auf die weitere Entwicklung von Journalismus und PR beurteilt. Am Ende werden die
Arbeitsergebnisse zusammengefasst und kurze Ausblicke auf das zukünftige Verhältnis von Journalismus und PR gegeben.
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Theoretische Hinführung zum Thema nach Schmidt/Zurstiege
2.1 Entwicklung und Kernaufgaben des Journalismus
2.2 Entwicklung und Kernaufgaben der PR
3. Verhältnis von Journalismus und PR in Theorie und Praxis
3.1 Kodizes von Journalismus und PR
3.2 Empirische Forschungen – PR auf dem Vormarsch?
3.3 Journalismus und PR in der Praxis – Vermischung von „getrennten Welten“?
4. Fazit
5. Literatur- und Quellenverzeichnis
Häufig gestellte Fragen
Vermischen sich Journalismus und Public Relations immer mehr?
Die Arbeit untersucht die These der zunehmenden Vermischung und zeigt auf, wie PR-Inhalte oft ungefiltert in den Journalismus einfließen, was die Grenzen verwischt.
Was sind die Kernaufgaben des Journalismus?
Hauptaufgaben sind die unabhängige Information, Kritik und Kontrolle sowie die Bereitstellung einer Öffentlichkeit für gesellschaftlich relevante Themen.
Wie unterscheidet sich PR vom Journalismus?
Während Journalismus der Allgemeinheit verpflichtet ist, vertritt Public Relations (Öffentlichkeitsarbeit) partikulare Interessen von Auftraggebern oder Unternehmen.
Was sagt das "Netzwerk Recherche" zum Verhältnis von PR und Journalismus?
Das Netzwerk Recherche mahnt eine strikte Trennung an und kritisiert die wachsende Abhängigkeit von Redaktionen gegenüber professionell aufbereiteten PR-Materialien.
Welche Rolle spielen berufsspezifische Kodizes?
Sowohl für Journalisten (Pressekodex) als auch für PR-Schaffende gibt es ethische Richtlinien, deren Einhaltung in der täglichen Praxis jedoch oft unter ökonomischem Druck leidet.
- Quote paper
- Lars Urhahn (Author), 2012, Journalismus und Public Relations, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/268110