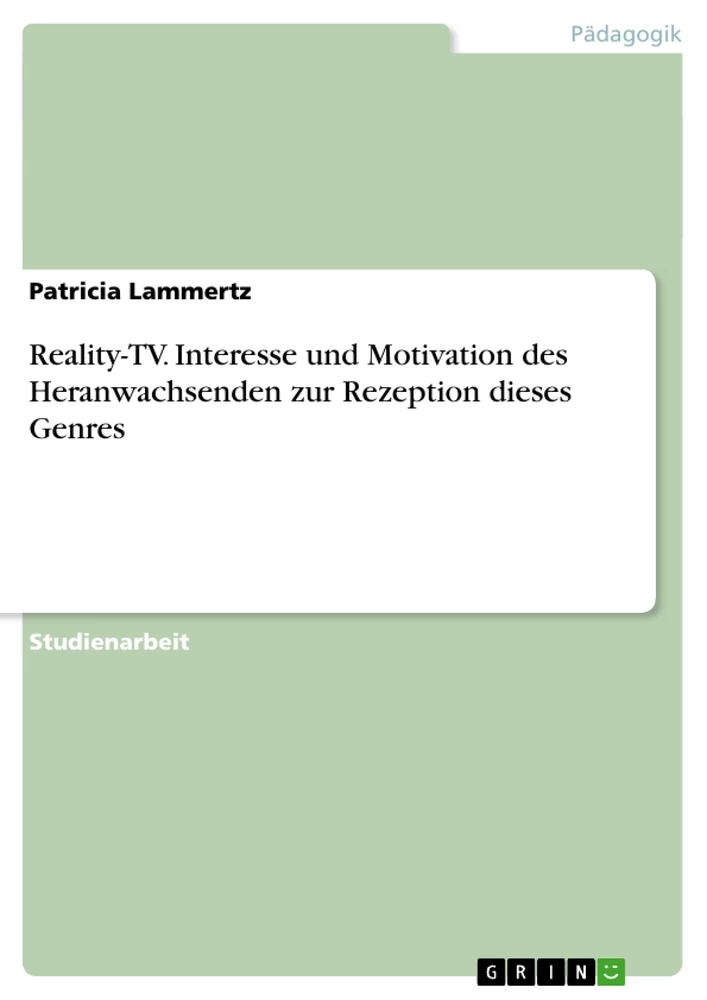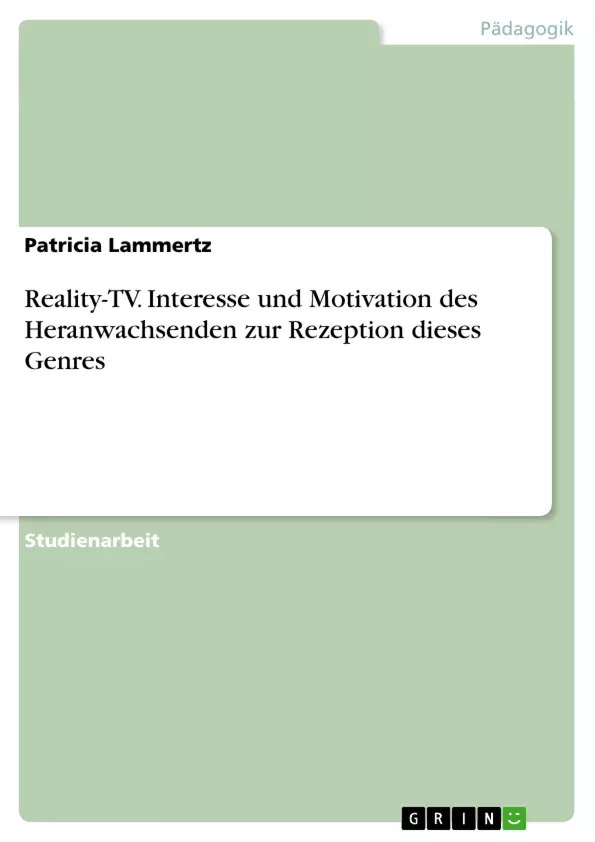1. Einleitung
Die vorliegende Hausarbeit befasst sich mit dem Genre des Reality-TV, das im derzeiti-gen Fernsehprogramm stark vertreten ist.
Vergleicht man die heutigen Ansprüche an Heranwachsende mit früheren fällt auf, dass sie deutlich gestiegen sind. Früher bestimmten die soziale Herkunft, die Regeln der Gemeinschaft, die Gebote und Verbote der Religion, welchen Platz ein junger Mensch in der Gesellschaft einnehmen konnte. Auch persönliche Eigenschaften, wie Begabung, bestimmte Charaktereigenschaften und Aussehen nahmen Einfluss auf den Lebensweg der Heranwachsenden. Diese Normierung grenzte auch die Vorstellung darüber ein, was der Einzelne als Person ist und wie er sich von anderen abgrenzt. Viel Spielraum in der Ausbildung der eigenen Identität gab es nicht. Heute ist dieser Spielraum erheblich grö-ßer geworden, was die Ansprüche an den Heranwachsenden jedoch erhöht. Sein Le-bensweg ist nicht mehr weitestgehend vorgegeben und es liegt an ihm zu entscheiden, wohin er gehen möchte, wer er sein will und inwiefern er sich von anderen abgrenzen will. Die Vielzahl an Wertvorstellungen, Verhaltensweisen, Idealen, Lebenswegen und Meinungen wird heute durch die Medien aus aller Welt an den Heranwachsenden her-angetragen, ganz egal, wo und wie er lebt. Erziehung findet nicht mehr allein zwischen Eltern, Familie und dem Pfarrer statt, sondern ist eine ständige Interaktion zwischen dem Heranwachsenden und seiner Umwelt geleitet durch die Medien geworden. Durch die vielfältigen Orientierungsangebote entstehen viele Möglichkeiten für den Einzelnen heutzutage seine Identität zu entfalten und neu zu gestalten. Diese Angebote projizieren Wünsche und Vorstellungen an den Heranwachsenden, was er aus sich machen kann und will. Eine Projektionsfläche stellen Reality-Formate im Fernsehen dar. Hier werden Kindern und Jugendlichen Modelle und Orientierungen angeboten, die nicht mehr län-ger aus der Welt der Prominenten Weltstars kommen, sondern aus allen gesellschaftli-chen Schichten Deutschlands.
Diese Hausarbeit geht zum Einen der Frage nach, was Reality-Formate ausmacht und beschränkt sich dabei auf ein bestimmtes Sendeformat. Zum Anderen wird hinterfragt, was Heranwachsende dazu motiviert, anderen Menschen bei Lebensproblemen zuzuse-hen.
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Das Genre „Reality-TV“
2.1 Definition und Geschichte
2.2 Inhalte und Ablauf am Beispiel einer Folge von
„Mitten im Leben“
2.3 „Scripted Reality“ – Die Lüge, wenn echtes Leben
langweilig wird
3. Attraktivität, Interesse, Motivation - das Reality-TV für den jungen Zuschauer
4. Fazit
5. Literaturverzeichnis
1. Einleitung
Die vorliegende Hausarbeit befasst sich mit dem Genre des Reality-TV, das im derzeitigen Fernsehprogramm stark vertreten ist.
Vergleicht man die heutigen Ansprüche an Heranwachsende mit früheren fällt auf, dass sie deutlich gestiegen sind. Früher bestimmten die soziale Herkunft, die Regeln der Gemeinschaft, die Gebote und Verbote der Religion, welchen Platz ein junger Mensch in der Gesellschaft einnehmen konnte. Auch persönliche Eigenschaften, wie Begabung, bestimmte Charaktereigenschaften und Aussehen nahmen Einfluss auf den Lebensweg der Heranwachsenden. Diese Normierung grenzte auch die Vorstellung darüber ein, was der Einzelne als Person ist und wie er sich von anderen abgrenzt. Viel Spielraum in der Ausbildung der eigenen Identität gab es nicht. Heute ist dieser Spielraum erheblich größer geworden, was die Ansprüche an den Heranwachsenden jedoch erhöht. Sein Lebensweg ist nicht mehr weitestgehend vorgegeben und es liegt an ihm zu entscheiden, wohin er gehen möchte, wer er sein will und inwiefern er sich von anderen abgrenzen will. Die Vielzahl an Wertvorstellungen, Verhaltensweisen, Idealen, Lebenswegen und Meinungen wird heute durch die Medien aus aller Welt an den Heranwachsenden herangetragen, ganz egal, wo und wie er lebt. Erziehung findet nicht mehr allein zwischen Eltern, Familie und dem Pfarrer statt, sondern ist eine ständige Interaktion zwischen dem Heranwachsenden und seiner Umwelt geleitet durch die Medien geworden. Durch die vielfältigen Orientierungsangebote entstehen viele Möglichkeiten für den Einzelnen heutzutage seine Identität zu entfalten und neu zu gestalten. Diese Angebote projizieren Wünsche und Vorstellungen an den Heranwachsenden, was er aus sich machen kann und will. Eine Projektionsfläche stellen Reality -Formate im Fernsehen dar. Hier werden Kindern und Jugendlichen Modelle und Orientierungen angeboten, die nicht mehr länger aus der Welt der Prominenten Weltstars kommen, sondern aus allen gesellschaftlichen Schichten Deutschlands.
Diese Hausarbeit geht zum Einen der Frage nach, was Reality -Formate ausmacht und beschränkt sich dabei auf ein bestimmtes Sendeformat. Zum Anderen wird hinterfragt, was Heranwachsende dazu motiviert, anderen Menschen bei Lebensproblemen zuzusehen.
Im ersten Schritt wird eine Beschreibung des Reality-TV -Begriffs vorgenommen. Dem folgen eine genaue Erläuterung des Ablaufs einer bestimmten Sendung und deren Inhalt. Anschließend findet eine Auseinandersetzung mit der Rezeption dieser Formate statt. Zum Schluss folgt ein Fazit.
2. Das Genre „Reality-TV“
2.1 Definition und Geschichte
Der Begriff des Reality-TVs kommt aus dem Amerikanischen und bezeichnet ein Genre von Fernsehsendungen, die den Anspruch erheben, sich mit der Wirklichkeit zu befassen. Die Realität wird möglichst authentisch dar- oder nachgestellt, wobei gewöhnliche Menschen in den Fokus der Darstellung geraten.[1]
Reality -Formate etablierten sich im deutschen Fernsehen in den frühen 90er Jahren. Eine der bekanntesten Sendungen war „Notruf“, bei der echte Unfälle nachgestellt wurden und deren Opfer davon erzählen. Weitere frühere Sendungen waren „Verzeih‘ mir“, „Vermisst“ oder „Aktenzeichen XY…ungelöst“, welches heute noch immer ausgestrahlt wird. Es folgten Talkshows, wie „Arabella Kiesbauer“ oder „Bärbel Schäfer“, in denen Konflikte und Probleme gelöst oder einfach nur über ein heikles Thema diskutiert wurden. Diese Formate zählten auch zum Genre des Reality-TVs und werden auch Reality-Shows genannt. Populär wurde dieses Genre durch öffentliche Diskussionen über den Bruch bisheriger Tabus, die mit diesen Sendungen einhergingen. Gewalt und Verbrechen so wirklichkeitsgetreu darzustellen oder öffentlich über sexuelle Dinge zu sprechen, war damals Anlass diese Formate kritisch zu diskutieren.[2]
Heutzutage ist Reality-TV nicht mehr aus dem täglichen Fernsehprogramm wegzudenken, denn es kommt in vielen Formen vor.
„Tag für Tag werden im deutschen Fernsehen Schuldner beraten, Kinder erzogen, Häuser umgebaut, Schwiegertöchter gesucht und Frauen getauscht. Es werden Süchtige therapiert, Ehen oder Restaurants gerettet, Nachbarschaftskräche geschlichtet, Straßenkinder aufgelesen und Schulabschlüsse nachgemacht.“[3]
Früher gewann das Private in Reality -Formaten an Relevanz, heute ist es das Alltägliche für viele Rezipienten. Menschen von Nebenan stehen dafür vor der Kamera und geben einen Teil ihres Privatlebens preis. Die Vorgänge werden bevorzugt aus der Sicht einzelner Beteiligten beschrieben und die Darstellung erfolgt chronologisch in kleinen Einzelschritten, die durch einen Sprecher dokumentiert werden. Somit ist eine verständliche Darstellung für jeden gewährleistet.[4]
Das Reality-TV bedient sich dreier Stilmittel: der Personalisierung, der Emotionalisierung und der Stereotypisierung. Rezipienten erleben das Leiden, die Konflikte und Probleme, aber auch die Freude fremder Menschen im Fernsehen mit. Diese Erfahrungen bekommen durch die Personalisierung ein Gesicht, eine Identifikationsperson mit Namen, Eltern und Freunden. Sie ermöglicht ein involviert sein und erhöht die Spannung für den Rezipienten. Die Emotionalisierung zeigt sich durch eine Ich-Beteiligung des Rezipienten. Sie erzeugt einen angenehmen Nervenkitzel und Spannung. Emotionen lassen sich nicht durch einen einfachen Bericht hervorrufen, sondern benötigen dramatische Situationen mit handelnden Personen. Stereotypisierungen kommen in unterschiedlicher Weise bei den verschiedenen Sendeformaten vor. Gemeint sind damit zum Beispiel Geschlechterrollen, Folgen eines Ereignisses, Ursachenerklärung und Schuldzuweisung.[5]
2.2 Inhalte und Ablauf am Beispiel einer Folge von „Mitten im Leben“
In dieser Hausarbeit wird das Format „Mitten im Leben“ (RTL) genauer betrachtet, da es an fünf Tagen in der Woche morgens und nachmittags zu sehen ist. Es handelt sich hierbei um eine Real-Doku, wie der Sender sie nennt. Auf der Internetseite des Senders RTL ist eine Beschreibung dieses Formats zu finden:
„ „Mitten im Leben!“ verfolgt außergewöhnliche Geschichten des Alltags: Von mutigen ersten Schritten in eine bessere Zukunft über aufreibende Familienkonflikte bis hin zu berührenden Auseinandersetzungen mit harten Schicksalsschlägen. So unterschiedlich wie die spannenden, nachdenklichen und mitunter auch skurrilen Geschichten der Sendung sind auch die Menschen, die täglich von 14 bis 15 Uhr Einblicke in ihr Privatleben gewähren.“[6]
Das Themenspektrum ist breit angelegt. Es ragt von ungewöhnlichen Liebesgeschichten, der Suche nach vermissten Familienmitgliedern, außergewöhnlichen Berufen bis hin zu unter Phobien oder Ängsten leidenden Menschen. Einen großen Platz nehmen die Geschichten rundum Jugendliche ein. Diese werden mit der Kamera belgeitet, wenn sie ein Kind erwarten, Konflikte mit den Eltern haben oder unter Perspektivlosigkeit leiden. Auch Menschen, die einen Star vergöttern „oder andere Ticks“[7] haben werden auf der Internetseite der zuständigen Casting-Agentur aufgerufen. „Mitten im Leben“ beinhaltet auch bestimmte Reihen, wie „Praktikum Mama“, bei der regelmäßig Teenager in die Mutterrolle schlüpfen oder „Das große Tauschexperiment“, wenn Jugendliche für eine Woche ihre Familien tauschen und das fremde Leben des Anderen kennenlernen.[8]
[...]
[1] Vgl. Eberle, Thomas: Motivation des Fernsehverhaltens Jugendlicher. Grundlagen, Verhaltensanalyse, Selbstauskünfte und Beurteilung des Reality-TV. Bad Heilbronn 2000, S.208.
[2] Vgl. ebd., S. 16f.
[3] http://www.spiegel.de/spiegel/0,1518,656022,00.html [Stand:26.8. 2010]
[4] Vgl. Eberle, Thomas: Motivation des Fernsehverhaltens Jugendlicher. A.a.O., S. 239-243.
[5] Vgl. ebd., S. 239-243.
[6] http://www.rtl.de/cms/unterhaltung/tv-programm/real_life/mitten-im-leben.html [Stand: 26.8.2010]
[7] http://www.easycast.de/?p=789> [Stand : 26.8.2010]
[8] http://www.rtl.de/cms/unterhaltung/tv-programm/real_life/mitten-im-leben.html [Stand: 26.8.2010]
Häufig gestellte Fragen
Was definiert das Genre Reality-TV?
Reality-TV erhebt den Anspruch, die Wirklichkeit authentisch darzustellen, wobei gewöhnliche Menschen in ihrem Alltag oder in nachgestellten Situationen gezeigt werden.
Warum ist Reality-TV für Jugendliche so attraktiv?
Es bietet Orientierungshilfen und Projektionsflächen für die eigene Identitätsbildung in einer komplexer gewordenen Gesellschaft.
Was bedeutet "Scripted Reality"?
Es handelt sich um Sendungen, die den Anschein von Realität erwecken, aber auf einem Drehbuch basieren und von Laiendarstellern inszeniert werden.
Welche Stilmittel nutzt Reality-TV zur Zuschauerbindung?
Die Formate nutzen Personalisierung, Emotionalisierung und Stereotypisierung, um beim Zuschauer Spannung und Mitgefühl zu erzeugen.
Welche Rolle spielt das Format "Mitten im Leben"?
Die Arbeit analysiert dieses Format als Beispiel für eine Real-Doku, die alltägliche Geschichten, Familienkonflikte und Schicksalsschläge thematisiert.
- Citar trabajo
- Patricia Lammertz (Autor), 2010, Reality-TV. Interesse und Motivation des Heranwachsenden zur Rezeption dieses Genres, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/268271