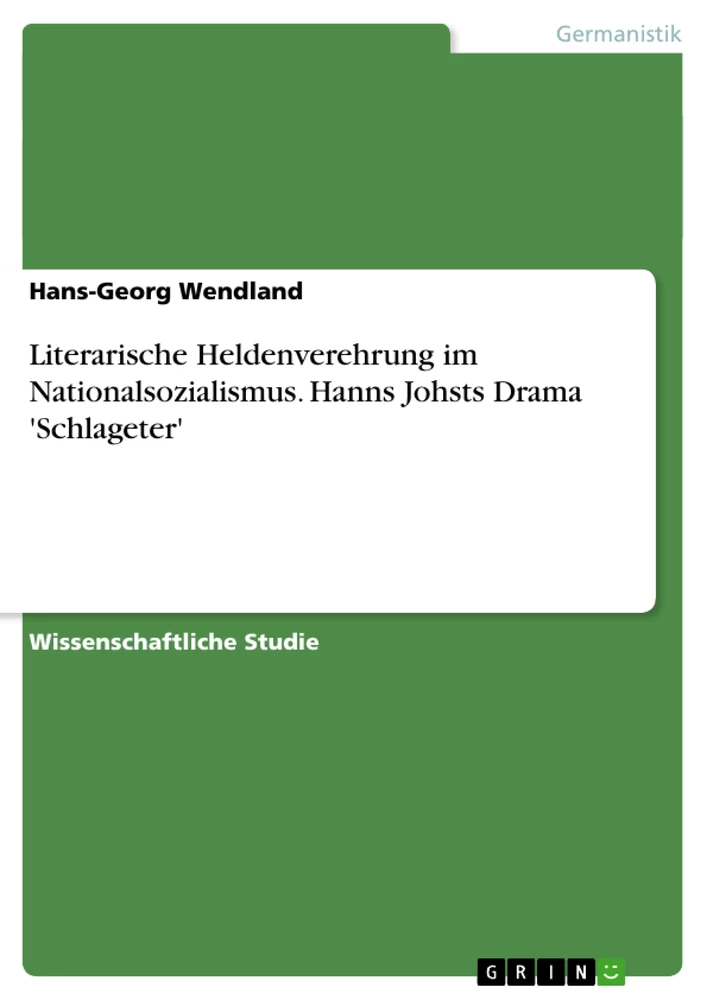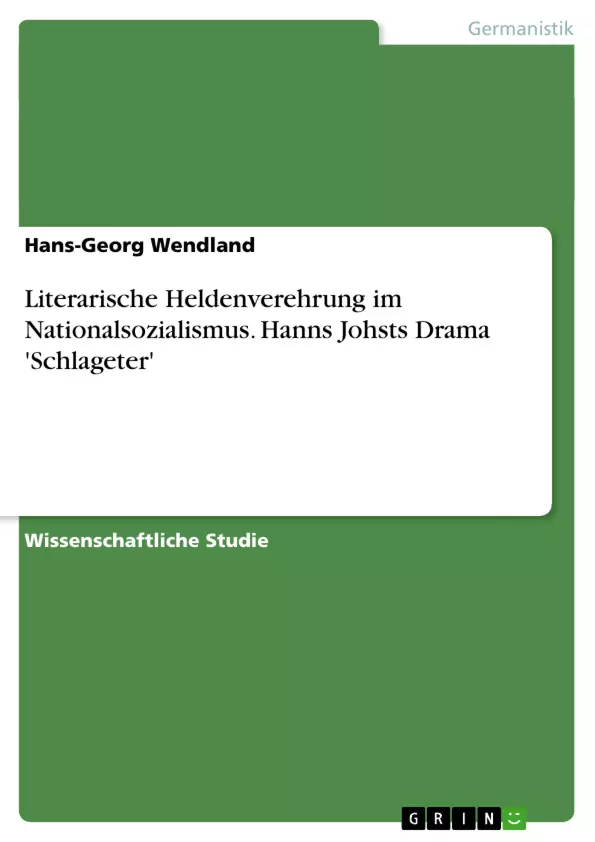Mit seinem Drama "Schlageter" (1933) wurde Hanns Johst zum führender Exponenten einer literarischen Mythen- und Legendenbildung, durch die ein ehemaliger Frontkämpfer zum Nationalhelden stilisiert wird. Mit seinem Stück erreichte dieser gleich nach dem Ende des ersten Weltkrieges einsetzende Prozess seinen absoluten Höhepunkt. Nach den Worten Günther Rühles handelt es sich um "das erste Schauspiel, in dem das 'Dritte Reich' sich [selbst] feierte." Durch Johsts Drama verbreitete sich das Schlagwort vom "ersten Soldat des Dritten Reiches", das dem von den Nationalsozialisten betriebenen Militärkult enormen Auftrieb verlieh. Der Autor hatte seine literarische Laufbahn mit expressionistischen Dramen begonnen und war schon in den zwanziger Jahren ein anerkannter und wiederholt aufgeführter Dramatiker gewesen. Mit Beginn der Weimarer Republik hatte er den Expressionismus hinter sich gelassen und war auf einen immer stärker völkisch und nationalistisch ausgerichteten Kurs eingeschwenkt, der ihn schließlich zu einem überzeugten Nationalsozialisten und zu einem der erfolgreichsten Kulturfunktionäre des Dritten Reiches werden ließ. Die Krönung seiner politischen Karriere war das Amt des Joseph Goebbels direkt unterstellten Präsidenten der Reichsschrifttumskammer, das er von 1935 bis 1945 innehatte. Dass Johst als Dramatiker ursprünglich im Stil des Expressionismus geschrieben hatte, erkennt man zum Beispiel daran, dass der Protagonist Leo Schlageter - ähnlich dem eines expressionistischen Wandlungs- und Verkündigungsdramas - sich vom zögernden Zweifler am Sinn seines Tuns zum überzeugten Verfechter des aktiven Widerstands gegen die französische Besetzung des Rheinlandes im Jahre 1923 entwickelt. Damit wird er für seine "Kameraden" zur vorbildlichen Führerfigur und für seine Förderer und Sympathisanten nach seiner Verhaftung und Hinrichtung durch die französischen Besetzer zum nationalen Märtyrer. Die Botschaft zum Schluss des Dramas ist keinesfalls die eines gescheiterten Partisanenkämpfers, sondern im Gegenteil die eines erfolgreichen Patrioten, dessen Opfer nicht umsonst gewesen ist. Aufrechten Hauptes und mit pathetischen Durchhalteappellen an seine Kameraden und alle deutschen Volksgenossen geht er im Stil eines expressionistischen Welterneuerers triumphierend in den Tod - überzeugt, dass sein Kampf eines Tages siegreich zu Ende geführt werden wird.
1. Mythen- und Legendenbildung nach dem verlorenen Krieg
Illusion eines großen Volkskörpers
Der Appell an Gefühle und Emotionen bildete ein wesentliches Element nationalsozialistischer Propaganda. Dabei machte man sich existenzielle Ängste und geheime Sehnsüchte nach einer charismatischen Führergestalt zunutze, die das Volk aus der durch den verlorenen ersten Weltkrieg erlittenen Schmach zu neuer nationaler Größe führen sollte. Die nationalsozialistischen Machthaber bedienten sich eines raffiniert zusammengestellten Inventars subtiler Beeinflussungstechniken, durch die unerwünschte Realitätsanteile ausgeblendet und durch künstlich geschaffene Mythen und Legenden ersetzt wurden. Sie konstruierten ein Weltbild, das den kritischen Verstand des Einzelnen außer Kraft setzen sollte und erzeugten die Illusion eines großen Volkskörpers, mit dem das Individuum verwurzelt und verwachsen war. Die Mythologisierung des eigenen Volkes entzog sich einer rationalen Analyse und wurde durch ein großartiges Aufgebot medial gesteuerter Propaganda zu einem Religionsersatz aufgebauscht, dessen suggestive Wirkung sich als geradezu überwältigend erwies.
Mythos vom tapferen Frontsoldaten
Seit der Antike bestehen zwischen Mythos und Literatur enge Verbindungslinien. Viele Autoren haben im Laufe der Jahrhunderte und verschiedener Epochen literarisierte Mythen wie Homers "Odyssee" immer wieder aufgegriffen und als Quelle der Inspiration benutzt. Im Nationalsozialismus hatte die Tendenz zur Mythenbildung großen Einfluss auf die zeitgenössische Literatur. Viele linientreue Schriftsteller des Dritten Reiches ließen sich davon vereinnahmen und trugen zur Verherrlichung von historischen Ereignissen, bestimmten Völkern, Volksgruppen oder heldenhaften Gestalten bei. Dazu kann man zum Beispiel den Mythos von einer nordischen Herrenrasse, den Blut-und-Boden-Mythos, den Mythos vom Volk ohne Raum, der auf die Expansion nach Osten ausgerichtet war, und den Mythos vom tapferen Soldaten zählen. Bereits 1920 hatte Ernst Jünger in seinem Kriegstagebuch "In Stahlgewittern" den Frontsoldaten des ersten Weltkriegs zu einer heldenhaften Gestalt emporstilisiert, für die der Krieg zur existenziellen Bewährungsprobe schlechthin geworden war. (Vgl. Sarkowicz/Mentzer, 346) Schon vor der Gründung der NSDAP im Februar 1920 gab es in weiten Kreisen der bürgerlichen Bevölkerung ausgesprochene Bewunderung für die Frontsoldaten, die sich so tapfer für das Vaterland geschlagen hatten und denen nur wenig Dank zuteil geworden war. Diese Tendenz hatte ihre Wurzeln in der allgemeinen Hochschätzung des Militärs im Kaiserreich, die Karl Zuckmayer mit seinem Drama "Der Hauptmann von Köpenick" (1930) parodierte. Sie fand ihren konkreten Ausdruck in Legenden wie die von "Langemarck", wo sich im November 1914 junge, unerfahrene Kriegsfreiwillige mit "Deutschland, Deutschland über alles"-Gesängen todesmutig ins Schlachtengetümmel gestürzt hatten und zu Zehntausenden gefallen waren. Besonders die vom rechtsnationalen Lager verbreitete und von General Ludendorf und dem späteren Reichspräsidenten von Hindenburg unterstützte These von der "Dolchstoßlegende"
hatte sich tief ins nationale Bewusstsein eingegraben. Danach hatten nicht die tapfer vor Ort kämpfenden deutschen Truppen den Krieg verloren, sondern Sozialisten, Kommunisten, Pazifisten und Juden des Heimatlandes waren ihnen in den Rücken gefallen und trugen daher die Verantwortung für ihre Niederlage.
Militärkult und Kameradschaft
Die patriotische Stimmungslage und das revanchistische Denken war nach 1918 in weiten Teilen der deutschen Bevölkerung keineswegs abgeebbt, sondern bestand nach wie vor fort. Das zeigte sich zum Beispiel in Frontkämpfer-Verbänden wie dem 1918 gegründeten, national-konservativ ausgerichteten und die Weimarer Republik ab Ende der zwanziger Jahre offen bekämpfenden "Stahlhelm: Bund der Frontsoldaten" und dem 1924 gegründeten politischen Kampfverband der Linken "Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold". Überdies schürten zahlreiche Kriegsromane oder Kriegstagebücher wie das von Ernst Jünger verfasste und bereits erwähnte "In Stahlgewittern" die Stimmung weiter und hielten die Legende von den im Felde angeblich unbesiegten deutschen Truppen am Leben. Der im Volk fortlebende Militärkult würdigte ausdrücklich das Vorbild des einfachen Frontsoldaten und feierte die Mitglieder der kämpfenden Truppe als verschworene Gemeinschaft Gleichgesinnter, deren Zusammengehörigkeitsgefühl sich in dem mit starker symbolischer Bedeutung aufgeladenen Signalwort "Kamerad" ausdrückte. Auch wenn die Generalität und das Offizierskorps sich von diesem Kult distanzierte und Hindenburg verächtlich vom Kriegsteilnehmer Adolf Hitler als dem "böhmischen Gefreiten" sprach, war man sich im Prinzip über die hervorragende Bedeutung des Militärs einig. Der Begriff der "Kameradschaft" behielt im Denken ehemaliger Frontsoldaten seinen besonderen Klang, und die Erinnerung an gemeinsame Kämpfe bildete in ihren Gesprächen ein zentrales Thema.
Volksgemeinschaft und Sehnsucht nach dem "Führer"
Die später von den Nationalsozialisten beschworene "Volksgemeinschaft" wurde als entscheidende Voraussetzung für die Erringung neuer nationaler Größe angesehen. Um dieses Ziel zu erreichen, bedurfte es einer starken Führerfigur. Das Führerprinzip bildete einen wesentlichen Bestandteil der nationalsozialistischen Eroberungsideologie. Damit befand man sich im krassen Gegensatz zu den Grundgedanken einer parlamentarischen Demokratie. Diese musste zerschlagen werden, weil sie nur hinderlich auf dem Wege zum angestrebten Ziel sein konnte. Dabei orientierte man sich an Vorläufern und Vorbildern aus dem Kaiserreich. Zwar war im öffentlichen Bewusstsein das Bild vom heroischen Kaiser Wilhelm II verblasst, der mit der überheblichen Phrase, am deutschen Wesen müsse die Welt genesen, Deutschland in den ersten Weltkrieg geführt hatte. An seine Stelle war aber der Reichsgründer Otto von Bismarck getreten, an dessen überragender Bedeutung für die Einheit des Deutschen Reiches kein Zweifel bestand und der nach wie vor weithin verehrt wurde. In großen Teilen der Bevölkerung bestand der Wunsch nach einem starken Mann, der Deutschland aus den Trümmern des Krieges und den Demütigungen durch Friedensverträge und Reparationszahlungen zur verdienten Größe führen und die erlittene Schmach tilgen würde. Das Misstrauen am parlamentarischen System und an der Wirksamkeit demokratischer Parteien war daher weit verbreitet.
Hanns Johsts "Schlageter": "der erste Soldat des Dritten Reiches"
Mit seinem Drama "Schlageter" (1933) wurde Hanns Johst zum führender Exponenten einer literarischen Mythen- und Legendenbildung, durch die ein ehemaliger Frontkämpfer zum Nationalhelden stilisiert wird. Mit seinem Stück erreichte dieser gleich nach dem Ende des ersten Weltkrieges einsetzende Prozess seinen absoluten Höhepunkt. Nach den Worten
Günther Rühles handelt es sich um "das erste Schauspiel, in dem das 'Dritte Reich' sich [selbst] feierte." (Rühle, 729) Durch Johsts Drama verbreitete sich das Schlagwort vom "ersten Soldat des Dritten Reiches", das dem von den Nationalsozialisten betriebenen Militärkult enormen Auftrieb verlieh. Der Autor hatte seine literarische Laufbahn mit expressionistischen Dramen begonnen und war schon in den zwanziger Jahren ein anerkannter und wiederholt aufgeführter Dramatiker gewesen. Mit Beginn der Weimarer Republik hatte er den Expressionismus hinter sich gelassen und war auf einen immer stärker völkisch und nationalistisch ausgerichteten Kurs eingeschwenkt, der ihn schließlich zu einem überzeugten Nationalsozialisten und zu einem der erfolgreichsten Kulturfunktionäre des Dritten Reiches werden ließ. Die Krönung seiner politischen Karriere war das Amt des Joseph Goebbels direkt unterstellten Präsidenten der Reichsschrifttumskammer, das er von 1935 bis 1945 innehatte. Dass Johst als Dramatiker ursprünglich im Stil des Expressionismus geschrieben hatte, erkennt man zum Beispiel daran, dass der Protagonist Leo Schlageter - ähnlich dem eines expressionistischen Wandlungs- und Verkündigungsdramas - sich vom zögernden Zweifler am Sinn seines Tuns zum überzeugten Verfechter des aktiven Widerstands gegen die französische Besetzung des Rheinlandes im Jahre 1923 entwickelt. Damit wird er für seine "Kameraden" zur vorbildlichen Führerfigur und für seine Förderer und Sympathisanten nach seiner Verhaftung und Hinrichtung durch die französischen Besetzer zum nationalen Märtyrer. Die Botschaft zum Schluss des Dramas ist keinesfalls die eines gescheiterten Partisanenkämpfers, sondern im Gegenteil die eines erfolgreichen Patrioten, dessen Opfer nicht umsonst gewesen ist. Aufrechten Hauptes und mit pathetischen Durchhalteappellen an seine Kameraden und alle deutschen Volksgenossen geht er im Stil eines expressionistischen Welterneuerers triumphierend in den Tod - überzeugt, dass sein Kampf eines Tages siegreich zu Ende geführt werden wird. Für den ideologischen Einpeitscher des Nationalsozialismus Joseph Goebbels befand sich Deutschland im Erscheinungsjahr des Johstschen Dramas und zehn Jahre nach der beispielgebenden Heldentat Schlageters an der Schwelle zu der von Schlageter verkündeten Wiedergeburt eines einstmals mächtigen Reiches, das nun den Weg zu neuer nationaler Größe angetreten hatte.
Die aus dem Volk aufsteigende Figur des Nationalhelden
Aus einfachen bäuerlichen Verhältnissen stammend und zur Zeit des Dramengeschehens 29 Jahre alt, gehörte die historische Figur des Albert Leo Schlageter nicht zur Schicht der Gebildeten, Adligen oder sonstwie Privilegierten im Deutschland jener Tage. Er eignete sich hervorragend für den aus dem Volk aufsteigenden und sich für sein Volk hingebenden Typus eines nationalen Helden und passte so recht in das von den Nazis erzeugte und propagierte Weltbild, in dem ein fest mit seinem Volk verwachsenes Individuum, das - wie schon der siegreiche Armin der Cherusker vor knapp 2000 Jahren - die besten Kräfte des Volkes in sich vereint, eine Führungsrolle übernimmt und das Volk aus kollektiver Misere zu nationalem Triumph führt. Der im Drama wiederholt verwendete Begriff der "Kameradschaft" unterstreicht symbolisch das Zusammengehörigkeitsgefühl der ehemaligen Frontkämpfer in ihrem unerschütterlichen Glauben, für ihr Vaterland das Richtige zu tun.
Triumphale Uraufführung des "Schlageter"-Dramas
Die Uraufführung des Dramas, das der Autor Hanns Johst seinem "Führer" Adolf Hitler "in liebender Verehrung und unwandelbarer Treue" persönlich gewidmet hatte, fand am 20. April 1933 zu Hitlers erstem Geburtstag als Reichskanzler im Staatlichen Schauspielhaus am
Gendarmenmarkt in Berlin in Anwesenheit Hitlers statt und wurde ein großer Erfolg. Umjubelt von tosendem Applaus bestieg der Autor selbst die Bühne und grüßte Hitler und die versammelte Nazi-Prominenz mit ausgestrecktem rechten Arm, während das begeisterte Publikum das Deutschland- und das Horst-Wessel-Lied[1] anstimmte. Mit diesem Aufführungserfolg verabschiedete sich Hanns Johst von seiner Tätigkeit als Dramenautor und widmete sich nunmehr ganz seiner Karriere als nationalsozialistischer Kulturfunktionär. Allerdings hegte er hochfahrende Pläne, dereinst die Saga der deutschen Eroberungsfeldzüge im Osten zu schreiben und auf diese Weise zur literarischen Verewigung des Germanentums beizutragen.
"Bekenntnis zur Barbarei"
Nach diesem triumphalen Aufführungserfolg meldeten sich nur wenige kritische Stimmen - wie die Golo Manns oder Johannes R. Bechers - zu Wort und zeigten sich empört über die im Stück verbreiteten Feindseligkeiten gegenüber pazifistisch eingestellten Bevölkerungskreisen und den aggressiven Zynismus, der sich zum Beispiel in Äußerungen des Schlageter-Kumpanen Friedrich Thiemann offenbart, wenn der Autor ihn sagen lässt: "Wenn ich Kultur höre ... entsichere ich meinen Browning!" Hierin spiegele sich - so Becher - die zynische Geisteshaltung, mit der die Nazis im Mai 1933 die Bücherverbrennung betrieben haben. In Äußerungen wie dieser kündige sich eine Mentalität an, durch die echte deutsche Kulturwerte mit Füßen getreten wurden. (Vgl. Düsterberg, 197) Auf diese Weise werde aus Schwarz Weiß gemacht. Mit solchen und ähnlichen Passagen entlarve sich das Stück als ein einziges "Bekenntnis zur Barbarei". (Ebd., 198) Auch ehemalige Frontkämpfer und spätere NS-Gefolgsleute bekannten ihren Unmut mit der im Drama konstruierten Pseudo-Wirklichkeit einer verschworenen Gemeinschaft unverbesserlicher Saboteure und warfen - wie beispielsweise Paul Fechter in einem persönlichen Schreiben an den Autor - Johst vor, er ersetze einen zivilisierten "klassischen" durch einen "barbarischen" und zutiefst menschenfeindlichen Kulturbegriff. (Ebd.)
Stellungnahme Thomas Manns
Bei Thomas Mann stieß die Verherrlichung der Schlageter-Figur in Johsts Drama, wie überhaupt die Tendenz der nationalsozialistischen Kultur- und Literaturpolitik zur Mythen- und Legendenbildung, auf entschiedene Ablehnung. Missbilligend kommentierte er sie als "der deutsche Wille zur Legende, zum Mythos, zu dem, was nicht wahr, aber 'schöpferisch' ist, ein Wille gegen die Wahrheit, gegen die geistige Reinlichkeit". (Zit. nach Franke, 112, Anm. 36) Für ihn waren die gewaltverherrlichenden nationalsozialistischen Mythen massenwirksame Steuerungsinstrumente, durch die Wahrheit und Fiktion untrennbar miteinander vermengt wurden und später erfolgte barbarische Akte wie die der Judenverfolgung gerechtfertigt erscheinen sollten.
Hanns Johsts Konzeption eines völkischen Kulttheaters
Als Dramaturg hatte Hanns Johst in den zwanziger Jahren die Idee eines völkischen
Kulttheaters entwickelt, in dem Akteure und Zuschauer zu einer Erlebnisgemeinschaft verschmelzen sollten. Diese Gedanken hatte er in seiner Schrift mit dem bezeichnenden Titel
"Ich glaube! Bekenntnisse von Hanns Johst" (1928) niedergelegt. Darin war davon die Rede, dass das neue wie einst das griechische Drama völkisch und national werden müsse und es auf
diese Weise zur "Wiedergeburt einer Glaubensgemeinschaft" kommen würde. ("Ich glaube", 36) Statt einer "vernunftmäßigen" forderte er eine "gefühlsmäßige Dramaturgie". (Ebd., 38)
Oberstes Ziel sei es, die Menschen zu der Erfahrung zu führen, dass sie ein Volk und eine Schicksalsgemeinschaft seien. Johsts Bemühungen um ein neues Theater zielten aber nicht nur darauf ab, zwischen Bühne und Zuschauern eine Erlebnisgemeinschaft herzustellen, sondern waren vor allem Ausdruck seiner bedingungslosen Bereitschaft, die Literatur überhaupt in den Dienst des totalitären Staates zu stellen, sie für dessen Ziele zu instrumentalisieren und durch seine Verstaatlichung eine Gleichschaltung des gesamten Theaterlebens herbeizuführen. Um die Überwältigung der Zuschauer durch das dargestellte Geschehen zu gewährleisten, mussten sie zur "Gefolgschaft erzogen" werden. Das Publikum wurde als ungestaltete Masse betrachtet, die durch ein propagandistisches Theater erst zur Gemeinschaft geformt wurde - analog zu einer staatlichen Führungsfigur, die die Massen der Bevölkerung zur "Volksgemeinschaft" zusammenschweißen würde. Damit wurde zugleich der pseudo-sakrale Charakter des Theaters betont. Das Theater sollte zum Kult, zum Religionsersatz und zu einem Ereignis umstilisiert werden, das in den Worten des Propagandaministers Joseph Goebbels die Funktion eines "nationalen Gottesdienstes" erhält.
Auch im "Schlageter"-Drama soll das Publikum aufgerüttelt und überwältigt werden. Diese Funktion kommt besonders stark in der Schlussszene zum Tragen, wo der Protagonist sich unmittelbar vor seiner Hinrichtung mit pathetischer Gebärde an das Publikum wendet und im Angesicht des Todes zu nationaler Einheit und zum Kampf gegen die vermeintlichen Unterdrücker des Vaterlandes aufruft. Es ist klar, dass er nicht nur als Märtyrer erscheinen, sondern vor allem die Rolle einer nationalen Führungsfigur übernehmen soll, die seinem Volk aus der Misere hilft. In der Terminologie der Nationalsozialisten wird sein Tod als "Fanal" inszeniert, um dem deutschen Volk den Weg zur "nationalen Wiedergeburt" zu weisen.
2. Die historische Figur des Albert Leo Schlageter und der zeitgeschichtliche Rahmen
Als Freiwilliger im ersten Weltkrieg
Schon aufgrund seiner Herkunft ist Albert Leo Schlageter prädestiniert für den Typus eines aus dem Volk aufsteigenden und sich für das Volk aufopfernden Helden. Er wird am 12. August 1894 als sechstes Kind des Landwirts Joseph Schlageter und seiner Ehefrau Rosina in Schönau, einer kleinen Stadt im Schwarzwald, etwa 30 Kilometer südlich von Freiburg, geboren. Bei Ausbruch des ersten Weltkriegs meldet sich der knapp Zwanzigjährige freiwillig und erlebt Einsätze an der Westfront in Nordfrankreich und Flandern. Im Frühjahr 1917 wird er vom Unteroffizier zum Leutnant der Reserve befördert. Er erhält das Eiserne Kreuz[2]
II. Klasse und wird bald darauf für seine Tapferkeit bei besonders gefährlichen Einsätzen im April 1918 mit dem Eisernen Kreuz I. Klasse ausgezeichnet.
[...]
[1] Horst Wessel (1907 - 1930), Student, seit 1926 Mitglied der NSDAP und seit 1929 SA-Sturmführer, starb am 14. Januar 1930 an den Folgen einer gewaltsamen Auseinandersetzung mit linken Aktivisten und wurde nach seinem Tod von den Nationalsozialisten zum nationalen Märtyrer stilisiert. Er verfasste das sogenannte Horst-Wessel-Lied ("Die Fahne hoch, die Reihen fest geschlossen, SA marschiert in ruhig festem Schritt ..."), das von den Nazis zur zweiten Nationalhymne erhoben wurde.
[2] Vgl. hierzu das Kapitel II.2 "Leben und Sterben eines deutschen Helden", in: Zwicker, 32 ff., und Kapitel 3 "Biogramm Albert Leo Schlageter", in: Franke, 20 ff.
Häufig gestellte Fragen
Wer war Albert Leo Schlageter?
Schlageter war ein ehemaliger Frontsoldat, der 1923 wegen Sabotage gegen die französische Ruhrbesetzung hingerichtet und von den Nationalsozialisten zum "ersten Soldaten des Dritten Reiches" stilisiert wurde.
Welche Rolle spielte Hanns Johst im Dritten Reich?
Johst war ein überzeugter Nationalsozialist und Präsident der Reichsschrifttumskammer. Sein Drama "Schlageter" gilt als das erste offizielle Schauspiel des NS-Staates.
Was ist die "Dolchstoßlegende"?
Dies war eine Verschwörungstheorie, nach der das deutsche Heer im Ersten Weltkrieg unbesiegt geblieben sei und nur durch Verrat in der Heimat ("Dolchstoß") verloren habe.
Wie nutzte die NS-Propaganda literarische Mythen?
Durch die Heroisierung von Frontsoldaten und Märtyrern wurde ein Weltbild geschaffen, das den kritischen Verstand ausschalten und die Illusion einer unbesiegbaren Volksgemeinschaft erzeugen sollte.
Inwiefern ist das Drama "Schlageter" expressionistisch beeinflusst?
Johst nutzte Stilelemente des expressionistischen Wandlungsdramas, um die Entwicklung des Protagonisten vom Zweifler zum opferbereiten Patrioten pathetisch darzustellen.
- Citation du texte
- Hans-Georg Wendland (Auteur), 2014, Literarische Heldenverehrung im Nationalsozialismus. Hanns Johsts Drama 'Schlageter', Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/268921