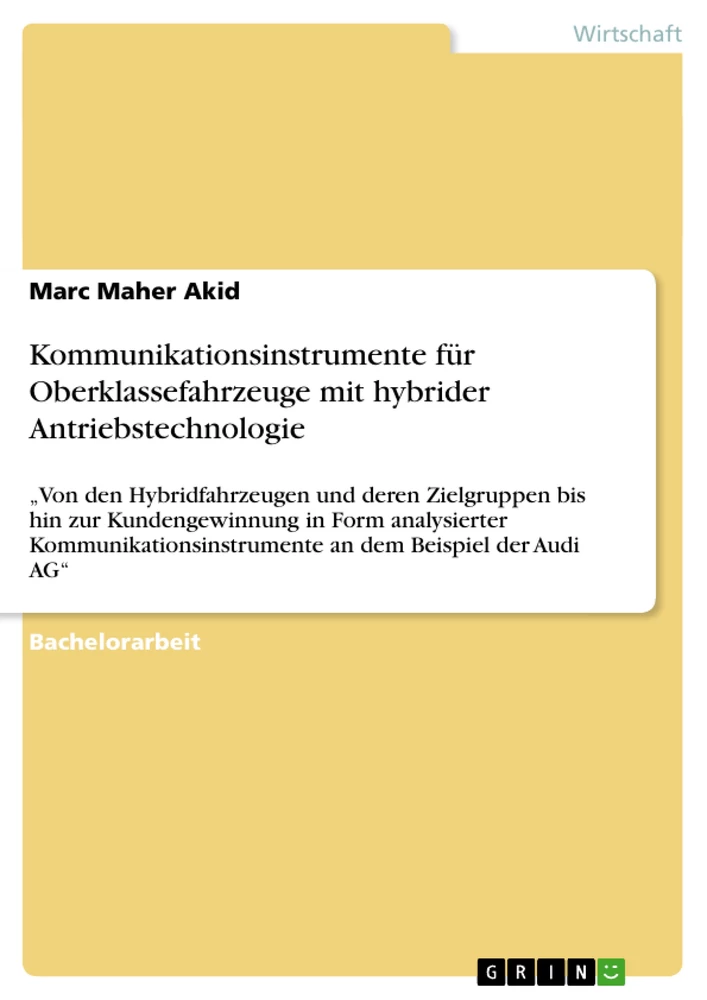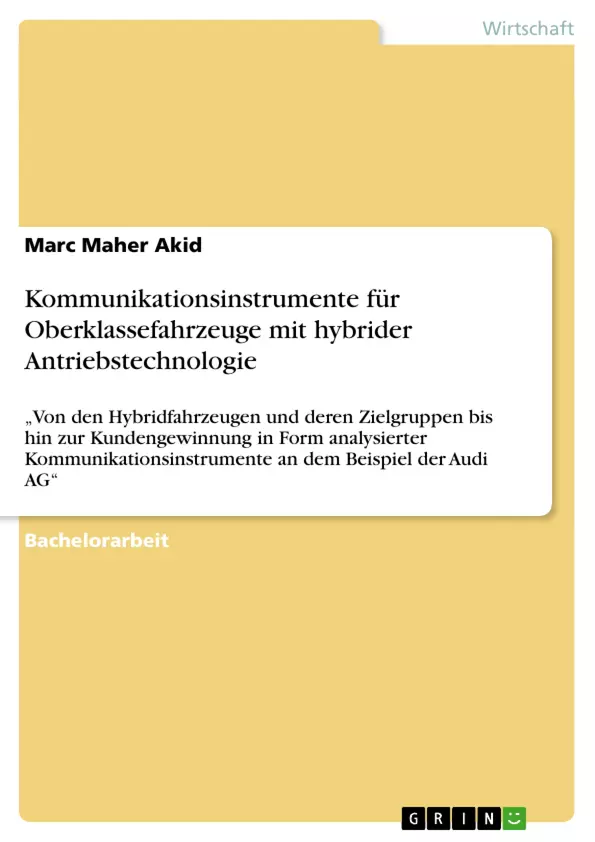Mit der Einführung hybrider Produkte in mehreren Fahrzeugklassen stellt sich die Frage, wie diese innovativen Produkte vom Interessenten wahrgenommen werden, wie sich die möglichen Kunden kategorisieren lassen und wie mit ihnen kommuniziert werden kann. Diese anspruchsvollen Fragen stellen sich vor allem Hersteller auf dem deutschen Oberklasse Hybridmarkt, die sich genau jetzt bewähren müssen. Sie müssen sich zeitnah etablieren, um dieses Segment letztendlich nicht an ausländische Automobilhersteller zu verlieren.
In Deutschland sind Hybridfahrzeuge aufgrund eines verbreiteten falschen Kenntnisstandes oftmals mit einem negativen Gefühl verknüpft. Daher versucht die Automobilindustrie für diese Produkte neue Segmente zu erschaffen, um einen Neuanfang in der Kommunikation zu erreichen.
Dieses Projekt soll einen Erkenntnisbeitrag für Unternehmen schaffen, mit welchen Kommunikationsinstrumenten potentielle Kunden der Audi Hybridtechnologie für Oberklassefahrzeuge angesprochen werden können. Dafür muss die mögliche Zielgruppe verstanden und ihre Lebensweise, ihr Verhalten, ihre Leidenschaft sowie ihre Locations erkannt werden, um sie von einem Produkt überzeugen zu können. Dieses Projekt stellt also dar, wo und wie die vorher erkannten Zielgruppen leben, um in einem weiteren Schritt eine geeignete Möglichkeit der Kommunikation festzulegen. Für Hersteller und Autohäuser ist es demnach das Wichtigste zu wissen, wie die Hybridtechnologie funktioniert, wie sie sich entwickelt hat, wer potentielle Kunden sind und durch welche Kommunikationsinstrumente sie erreicht werden können.
Inhaltsverzeichnis
I Abkürzungsverzeichnis
II Abbildungsverzeichnis
III Tabellenverzeichnis
A – Einleitung
1. Ausgangssituation
2. Zielsetzung/Problemstellung
3. Aufbau des Projekts
B – Hybridfahrzeuge
1. Der Hybridantrieb
1.1 Micro-Hybrid
1.2 Mild-Hybrid
1.3 Full-Hybrid
1.4 Plug-in-Hybrid
2. Technologische Treiber
2.1 Die Kunden als technologische Treiber
2.2 Der Staat als technologischer Treiber
2.3 Die Hersteller als technologische Treiber
3. Kritik an der Hybridtechnologie
4. Notwendigkeit der Hybridtechnologie
5. Die Hybridtechnologie als Unterform des Elektrofahrzeuges
5. 1 Elektrofahrzeuge
5. 2 Abgrenzung zur Hybridtechnologie
C – Zielgruppen
1. Der KFZ-Hybridmarkt
1. 1 Besonderheiten des Hybrid-Automobilmarktes
1.2 Audi hybrid
2. Bildung eines Zielmarktes
3. Die Audi-Philosophie
4. Neue Zielgruppen
4. 1 Definition
4. 2 Annäherungsprozess an die neue Zielgruppe
4. 3 Sinus-Milieus
4. 3. 1 Beschreibung
4. 3. 2 Milieu der Hybridmodelle
4. 3. 2. 1 Die modernen Performer
4. 3. 2. 2 Die Postmateriellen
4. 3. 2. 3 Die Experimentalisten
4. 3. 2. 4 Die Etablierten
4. 3. 2. 5 Bürgerliche Mitte
4. 3. 3 Bewertung der Milieus
4. 3. 3. 1 Analyse der Begriffe und der Charakteristika
4. 3. 3. 2 Analyse des Bildungsniveaus, des Alters und des Einkommens
4. 3. 3. 3 Analyse der Mediennutzung
4. 3. 3. 4 Analyse der Hobbys und Standortangaben
4. 3. 3. 5 Analyse der Meinungen
4. 3. 3. 6 Gemeinsamkeiten
4.4 Zielgruppenbeschreibung der Audi AG.
D – Kommunikationsinstrumente
1. Marketingkommunikation
1. 1 Definition
1. 2 Einordnung und Abgrenzung
1. 3 Instrumente
2. Eingrenzung der Kundengewinnung
3. Gewichtung der Kommunikationsinstrumente für Hybridmodelle
4. Kommunikationsinstrumente der Oberklasse Hybridfahrzeuge
4. 1 Hörfunkwerbung
4. 1. 1 Definition und Formen
4. 1. 2 Analyse
4. 2 Außenwerbung
4. 2. 1 Definition und Formen
4. 2. 2 Analyse
4. 3 Online-Marketingkommunikation
4. 3. 1 Definition und Formen
4. 3. 2 Analyse
4. 4 Ambient Media
4. 4. 1 Definition und Formen
4. 4. 2 Analyse
4. 5 Kino
4. 5. 1 Definition und Formen
4. 5. 2 Analyse
4. 6 Printmedien
4. 6. 1 Definition und Formen
4. 6. 2 Analyse
4. 7 Nutzungshinweise für Audi
E – Fazit
IV Quellenverzeichnis
I Abkürzungsverzeichnis
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
II Abbildungsverzeichnis
Abbildung 1: Vereinfachte Darstellung der Inhalte dieses Projekts
Abbildung 2: Darstellung zur Unterscheidung der relevanten, neuen Antriebstechnologien
Abbildung 3: Bevorzugte Pkw-Art bei einer Neuanschaffung
Abbildung 4: Interesse der Pkw-Nutzer an alternativer Antriebstechnologie
Abbildung 5: Bevorzugte Antriebsarten von Pkw im Fall, dass dieser ein Geschenk ist
Abbildung 6: Neuzulassungen von Hybridfahrzeugen in Deutschland
Abbildung 7: Prognose zur weltweiten Verteilung von Neuwagentypen im Jahre 2020
Abbildung 8: Prognose zum Anteil der jeweiligen Antriebsart am weltweiten Pkw-Absatz im Jahre 2020
Abbildung 9: Beschäftigtenanzahl in der Automobilindustrie
Abbildung 10: Neuzulassung von Hybridfahrzeugen in Deutschland der Jahre 2009 und 2010 nach Herstellern
Abbildung 11: Segmentierungsstrategie vom Markt zur Nische
Abbildung 12: Segmentierung der deutschen Bevölkerung im Jahr 2007 anhand der Sinus-Milieus
Abbildung 13: Segmentierung der deutschen Bevölkerung im Jahr 2007 anhand der Sinus-Milieus inklusive der Markierung der Milieus für mögliche Kunden von Fahrzeugen mit alternativen Antriebstechnologien
Abbildung 14: Milieus nach Wichtigkeit für Marketingmaßnahmen inklusive der Faktoren zur Berechnung
Abbildung 15: Fakten der Milieus nach ihren Begriffen bzw. Charakteristika inklusive der errechneten Fakten mit höchster Wertigkeit.,
Abbildung 16: Fakten der Milieus nach Alter, Bildungsniveau und Einkommen inklusive der errechneten Fakten mit höchster Wertigkeit
Abbildung 17: Fakten der Milieus nach der Mediennutzung inklusive der errechneten Fakten mit höchster Wertigkeit
Abbildung 18: Fakten der Milieus nach ihren Hobbys und Standortangaben inklusive der errechneten Fakten mit höchster Wertigkeit
Abbildung 19: Fakten der Milieus nach ihren Meinungen inklusive der errechneten Fakten mit höchster Wertigkeit
Abbildung 20: Wichtigste Merkmale unserer Zielgruppen
Abbildung 21: Kommunikationsmöglichkeiten im Bereich der Hörfunkwerbung
Abbildung 22: Werbeformen der Außenwerbung
Abbildung 23: Wichtige Instrumente der Online-Marketingkommunikation
Abbildung 24: Kommunikationsmöglichkeiten im Bereich der Ambient Media
Abbildung 25: Instrumente der Kinowerbung
Abbildung 26: Formen von Printmedien
III Tabellenverzeichnis
Tabelle 1: Bewertung der Kommunikationsinstrumente nach Milieubeschreibung
Tabelle 2: Rangfolge der Kommunikationsinstrumente
A – Einleitung
1. Ausgangssituation
Schon Charles Darwin schrieb im 19. Jahrhundert in einer These nieder, dass die Grundvoraussetzung für das Überleben im „Struggle of Life“ die ständige und erfolgreiche Anpassung an neue Gegebenheiten ist.[1] Dieser Grundsatz lässt sich auch heute auf die verschiedensten Lebensbereiche übertragen. Er gilt auch für die Wirtschaft und dort insbesondere für die Automobilindustrie Deutschlands, die sich an die veränderten „Gegebenheiten“ des Marktes „anpassen“ muss, um zu „überleben“. So arbeiten einige Automobilhersteller bereits an der Entwicklung von neuen Fahrzeugtypen mit alternativen Antrieben, um beispielsweise auf das Aufbrauchen knapper Ressourcen zu reagieren, eine Effizienzsteigerung ihrer Pkw-Modelle hinsichtlich Schadstoff- und Verbrauchsminimierung zu erreichen und vor allem den veränderten Verbraucherwünschen zu entsprechen.
Doch nicht nur eine Veränderung der Produktpalette sichert das Überleben eines Unternehmens. Jedem Hersteller muss bewusst sein, dass er kein Produkt verkauft ohne einen erweiterten Wissensstand. Dieser geht über die reinen Produkt-kenntnisse hinaus. Eine genaue Analyse über die Kunden inklusive ihrer Probleme und Wünsche ist notwendig. Die daraus resultierenden Ergebnisse werden dann mit tiefgründigem Produktwissen und Wissen über das Produktumfeld kombiniert. Nur so kann anschließend herausgefunden werden, wie das jeweilige Produkt mit Hilfe der Kundenanalyse an potentielle Kunden vermarktet werden kann.[2]
Im „Struggle of Life“ muss also neben der ständigen Weiterentwicklung und der ständigen Anpassung im rein technischen Sinne auch eine ständige Anpassung des Wissenstandes sowie die systematische und akribische Identifikation von möglichen Interessenten erfolgen. Dieses Vorgehen wird zur Akquisition des Kunden von morgen und damit zum Überleben des Herstellers im derzeitigen Markt führen.
Darwin würde hierzu wohl sagen, dass das Überleben des Stärkeren dadurch garantiert wird, dass er Nahrungsstellen identifiziert und diese mit Werkzeugen abschöpft, um die Nahrung anschließend verspeisen zu können. Sinngemäß bedeutet das für ein Unternehmen, seine Interessenten zu identifizieren, auf sie einzuwirken und sie zu Kunden zu machen. Um aber überhaupt auf die Kunden einwirken zu können, müssen sie zunächst über Kommunikation erreicht werden.
„Man kann nicht nicht kommunizieren!“[3] Dieses Zitat des Kommunikations-wissenschaftlers Paul Watzlawick (1921–2007) aus dem Jahr 1969 trifft damals wie heute pragmatisch den Punkt: Sobald zwei Personen sich gegenseitig wahrnehmen können, kommunizieren sie miteinander, da jedes Verhalten einen kommunikativen Charakter besitzt. Zu Verhalten gibt es kein Gegenteil, also kann sich auch nicht nicht verhalten werden und somit ist es auch unmöglich, nicht zu kommunizieren. Dies trifft nicht nur auf das zwischenmenschliche Kommunizieren zu, sondern auch auf jegliche Art der Kommunikation zwischen Kommunikationsteilnehmern, also zwischen Sendern und Empfängern.
Unternehmen kommunizieren demnach ständig, auch nonverbal und unbewusst. Die Kommunikationsstrategie stellt dabei mit ihren Kommunikationsinstrumenten eine immer wichtigere Komponente des Marketingmix dar. In den meisten Branchen ist daher eine Umverteilung des Budgets vom Produkt hin zur Marketingkommunikation festzustellen.[4] Durch diese Aspekte wird für Unter-nehmen eine Anpassung angestrebt, die zum Überleben im „Struggle of Life“ beiträgt.
2. Zielsetzung/Problemstellung
Mit der Einführung hybrider Produkte in mehreren Fahrzeugklassen stellt sich die Frage, wie diese innovativen Produkte vom Interessenten wahrgenommen werden, wie sich die möglichen Kunden kategorisieren lassen und wie mit ihnen kommuniziert werden kann. Diese anspruchsvollen Fragen stellen sich vor allem Hersteller auf dem deutschen Oberklasse Hybridmarkt, die sich genau jetzt bewähren müssen. Sie müssen sich zeitnah etablieren, um dieses Segment letztendlich nicht an ausländische Automobilhersteller zu verlieren.
In Deutschland sind Hybridfahrzeuge aufgrund eines verbreiteten falschen Kenntnisstandes oftmals mit einem negativen Gefühl verknüpft. Daher versucht die Automobilindustrie für diese Produkte neue Segmente zu erschaffen, um einen Neuanfang in der Kommunikation zu erreichen.
Dieses Projekt soll einen Erkenntnisbeitrag für Unternehmen schaffen, mit welchen Kommunikationsinstrumenten potentielle Kunden der Audi Hybridtechnologie für Oberklassefahrzeuge angesprochen werden können. Dafür muss die mögliche Zielgruppe verstanden und ihre Lebensweise, ihr Verhalten, ihre Leidenschaft sowie ihre Locations erkannt werden, um sie von einem Produkt überzeugen zu können. Dieses Projekt stellt also dar, wo und wie die vorher erkannten Zielgruppen leben, um in einem weiteren Schritt eine geeignete Möglichkeit der Kommunikation festzulegen. Für Hersteller und Autohäuser ist es demnach das Wichtigste zu wissen, wie die Hybridtechnologie funktioniert, wie sie sich entwickelt hat, wer potentielle Kunden sind und durch welche Kommunikationsinstrumente sie erreicht werden können.
3. Aufbau des Projekts
Begegnet wird der eben genannten Zielsetzung mit einem strukturierten Herantreten an die Zielgruppe und der Analyse der für sie geeigneten Kommunikationsinstrumente.
Zunächst muss ein Basiswissen über die alternativen Antriebe bei Hybridfahrzeugen vorhanden sein, denn um vernünftig werben und verkaufen zu können, müssen Interessenten überzeugt werden können. Kapitel B stellt daher in einen Überblick die verschiedenen Hybridantriebe vor und beleuchtet den Micro-,
Mild-, Full- und Plug-in-Hybrid eingehender. Nach der technischen Erklärung folgt die makroökonomische Herleitung, weshalb es Hybridantriebe überhaupt gibt. Der Frage nach dem Sinn von Hybridantrieben wird aus Sicht der technologischen Treiber nachgegangen, also jeweils aus Sicht der Kunden, des Staates sowie der Hersteller selbst. Weiterhin wird die Frage nach dem „Warum gibt es Hybridantriebe?“ aus einer kritischen makroökonomischen Sichtweise und der Notwendigkeit dieser Technologie beleuchtet.
An dieser Stelle ist es zudem noch wichtig, die Hybridtechnologie als Unterform des rein elektronischen Antriebes zu differenzieren. Dafür werden die Elektrofahrzeuge beschrieben und ihre Abgrenzung aufgezeigt.
Nachdem im Kapitel B die Definitionen und die Notwendigkeit der Hybridtechnologie geklärt wurden, beschäftigt sich das Kapitel C mit den Zielgruppen solcher alternativer Technologien. Hier wird die Zielgruppe vom Groben zum Speziellen erforscht. Dazu wird im ersten Schritt der Hybridmarkt untersucht, vor allem dessen Besonderheiten hinsichtlich der Vermarktung. Erst dann kann die Bildung und Beschreibung des Zielmarktes im zweiten Schritt vollzogen werden. Die Audi-Philosophie ergänzt im dritten Schritt die Erforschung neuer Zielgruppen. Diese Zielgruppen werden unter Punkt 4 zunächst definiert, um einen Annäherungsprozess in Richtung Zielgruppe Z1 mit Hilfe des Sinus-Milieu-Modells entwickeln zu können. Dieses Sinus-Milieu-Modell wird zunächst beschrieben und die für Audi geeigneten Milieus herausgefiltert. Die modernen Performer, die Postmateriellen, die Experimentalisten, die Etablierten und die bürgerliche Mitte werden anschließend hinsichtlich ihrer Definition, ihrer Größe, ihrer Begriffe, ihres Bildungsniveaus, ihres Alters, ihres Einkommens, ihrer Mediennutzung, ihrer Aufenthaltsorte und ihrer Meinungen beschrieben.
Neben dieser Beschreibung ist ein weiterer Schwerpunkt in dem Kapitel C die anschließende Analyse dieser Eigenschaften mit dem Ziel, Gemeinsamkeiten in einer Zielgruppe Z1 zusammenzufassen, um dadurch einen Kriterienkatalog zur Spezialisierung von Marketinginstrumenten zu erstellen. Die festgelegte Zielgruppe wird anschließend durch die Zielgruppenbeschreibung der Audi AG ergänzt.
Das hier geschaffene Datenmaterial aus der Zielgruppenanalyse wird im Kapitel D nun zur Kundengewinnung genutzt. Hierfür wird die Marketingkommunikation kurz beschrieben und die Zielgruppe weiter eingegrenzt. Danach wird als erster Schwerpunkt dieses Kapitels die Gewichtung der Kommunikationsinstrumente für Hybridmodelle anhand der Kriterien, Akzeptanz, Nettoreichweite, Affinität und Placement, verknüpft mit den im vorigen Kapitel gewonnenen Fakten der Milieus, vollzogen. Die dadurch herausgefilterten Instrumente werden im zweiten Schwerpunkt dieses Kapitels unter Punkt 4 hinsichtlich ihrer Definition sowie derer Formen beschrieben und jeweils analysiert. Hörfunk, Außenwerbung, Online-Marketing, Ambient Media, Kinowerbung und Printmedien werden also hier aus Sichtweise der Nutzung für die Audi AG identifiziert (s. Abb. 1).
Zusammenfassend wird in diesem Projekt an die passenden Kommunikations-instrumente über die Hybridfahrzeuge, deren Zielgruppen und deren Gewinnung als Kunden heran getreten.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 1: Vereinfachte Darstellung der Inhalte dieses Projekts.
Quelle: eigene Darstellung.
B – Hybridfahrzeuge
Um eine Grundlage des Verständnisses für die Hybridtechnologie zu schaffen und deren Begrifflichkeiten zu verdeutlichen, wird eine kurze Erläuterung der verschiedenen Hybridantriebe vorangestellt.
1. Der Hybridantrieb
Wie der Name schon vermuten lässt, definiert sich der Hybridantrieb durch das Vorhandensein von mindestens zwei unterschiedlichen Antriebssystemen. Hinsichtlich Elektromotoren besitzt er somit mindestens zwei Energiewandler, also einen Verbrennungsmotor und einen Elektromotor sowie mindestens zwei Energiespeicher in Form von Batterie und Kraftstofftank.[5],[6],[7]
Abbildung 2 lässt erkennen, dass Hybridantriebe aktuell in Micro-, Mild-, Full- und Plug-in-Hybrid unterschieden werden. Dabei sind die verschiedenen Stufen abhängig von der Leistung des Elektromotors pro Fahrzeugmasse bzw. der elektrischen Leistung in Volt.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 2: Darstellung zur Unterscheidung der relevanten, neuen Antriebstechnologien.
Quelle: eigene Darstellung.
1.1 Micro-Hybrid
In seiner Funktionalität beschreibt der Micro-Hybrid einen Startergenerator, der im Stand den Verbrennungsmotor automatisch abschaltet und beim Anfahren wieder startet. Die dabei genutzte Energie zum Anschalten des Verbrennungsmotors bringt ein Elektromotor auf. Hierfür wird ein riemengetriebener Elektromotor mit einer Leistung von zwei bis zehn kW anstelle des konventionellen Generators eingesetzt. Dadurch werden die sogenannten Leerlaufverbräuche vermieden. Es entsteht ein Verbrauchssenkungspotential von 5 bis 10 %, innerstädtisch sogar 20 bis 30 %. Der Micro-Hybrid-Motor kann mit geringeren technischem Aufwand als kostengünstige Lösung beschrieben werden.
Allerdings wird wenig bis gar kein Einfluss auf den Verbrauch bei Langstrecken genommen, da kein rekuperatives Bremsen, d.h. die Rückspeisung der Bremsenergie, möglich ist. Außerdem findet keine Unterstützung des Antriebsmotors durch den Elektromotor statt.[8],[9]
Dieses Konzept ist jedoch ausgereift und schon heute in den BMW 1er Modellen oder dem Citroën C3 zu finden.[10]
1.2 Mild-Hybrid
Die Nachteile des Micro-Hybrid sind beim Mild-Hybridantrieb beseitigt. Genauer bedeutet das, dass ein Start-/Stoppgenerator vorhanden ist und eine Rekuperation kinetischer Energie beim Bremsen stattfindet. Der sogenannte „Booster“ beschreibt die gegebene Drehmomentunterstützung. Es handelt sich demnach um einen Elektromotor mit Antriebsstrang, der üblicherweise eine Leistung zwischen 4 und 20 kW aufweist. Durch diesen entsteht ein Verbrauchssenkungspotential von bis zu 20 %. Bis auf das elektrische Fahren sind sämtliche Hybridfunktionen realisierbar.
Jedoch brauchen bei dieser Variante die zusätzlichen Batterien viel Platz und können das Transportvolumen des Fahrzeuges verringern. Zudem wird das Gesamtgewicht erhöht. Weiterhin ist diese Technik noch vergleichsweise teuer. Das Kosten- und CO2-Einsparungspotential liegt damit nur auf dem gleichen Niveau wie in den vorhandenen „Clean Diesel“-Konzepten.
Zu finden ist das Mild-Hybrid-Konzept im Honda Civic IMA, im Chevrolet Silverado Hybrid und im Mercedes Benz S400 Hybrid.[11],[12],[13]
1.3 Full-Hybrid
Das Full-Hybrid-Konzept ermöglicht das begrenzte rein elektrische Fahren. Neben dem vorhandenen Start-/Stoppgenerater sowie der Rekuperation kinetischer Energie beim Bremsen ist der Booster, also die Drehmoment-unterstützung, ebenfalls integriert. Dieses Konzept besteht aus einer E-Maschine im Antriebsstrang und einer motorseitigen zweiten Kupplung, die die Abkopplung des Verbrennungsmotors ermöglicht. Diese E-Maschine kommt auf eine Leistung von über 20 kW und überzeugt durch eine gute Fahrleistung, einem höheren Sparpotential gegenüber gleich starken Benzinmotoren, einem möglichen kurz-zeitigen abgasfreien Fahren und einem insgesamten Verbrauchssenkungspotential von bis zu 45 %.
Gegenüber vergleichbaren Diesel-Modellen sind die Einsparungen vor allem auf Langstrecken jedoch gering. Das zusätzliche Gewicht sowie der hohe technische Aufwand und die hohen Anschaffungskosten sind weiterhin nachteilig.[14]
Dennoch ist diese Technik unter anderem im Lexus RX 400h, in den Audi-Oberklasse-Hybridmodellen und im Toyota Prius zu finden.[15],[16]
1.4 Plug-in-Hybrid
Plug-in-Hybride unterscheiden sich nur in einer Hinsicht von Full-Hybriden und zwar durch die Möglichkeit, die vorhandene Batterie auch extern laden zu können. Eine fahrzeuginterne Energiegenerierung ist damit nicht zwingend notwendig.[17],[18]
2. Technologische Treiber
Nachdem nun ein Kenntnisstand der hybriden Antriebstechnologien und ihre Komplexität gegeben ist, stellen sich die Fragen: „Warum gibt es die Hybridtechnologie überhaupt?“ und „Warum reichen die konventionellen Antriebe nicht mehr aus?“
Ob nun die Wirtschaftskrise oder ein in der Bevölkerung entstandenes Umweltbewusstsein den Ausschlag gegeben haben, ist unklar. Zu beobachten ist aber, dass nun auch in der Oberklasse ein Wettkampf um das im Verbrauch sparsamste Modell ausgebrochen ist. Dabei wird, wie im folgenden Kapitel veranschaulicht, die Automobilbranche in besonderer Art und Weise durch ihre Makroumwelt beeinflusst. Das Ziel jedes Unternehmens der Automobilindustrie ist es, Einfluss auf die technologischen Treiber der alternativen Antriebsart in Deutschland auszuüben. Die Einflussgeber lassen sich grob in Kunden-, Staats- und Herstellertreiber unterscheiden, wobei die Grenzen nahezu fließend sind.
2.1 Die Kunden als technologische Treiber
Technologische Entwicklungen werden in der Automobilbranche besonders durch die Anforderungen möglicher Kunden initiiert. Für diese spielen hauptsächlich der Nutzen, die Kosten und das Image einer Automobilmarke eine bedeutende Rolle.[19]
Die steigenden Anforderungen und das wachsende Interesse der Kunden bezüglich der (Weiter-)Entwicklung neuer Antriebstechnologien und speziell an der Hybridtechnologie zeigt Abbildung 3. So ist sie als die bevorzugte Art der Pkw bei Neuanschaffungen von rund 450.000 im Jahre 2007 auf rund 980.000 am Anfang des Jahres 2011 gestiegen. Der Nutzen dieser Technologie scheint überzeugt zu haben.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 3: Bevorzugte Pkw-Art bei einer Neuanschaffung.[20]
Quelle: Arbeitsgemeinschaft Verbrauchs- und Medienanalyse (2011).
Das Interesse an hybriden Antriebstechnologien derer, die Pkw neu anschaffen, lag schon 2009 bei rund 32,5 % der an einer Umfrage beteiligten Personen (s. Abb. 4). Dies bestätigt die These, dass das Verlangen nach neuster, effizienter Technologie in Deutschland durchaus vorhanden ist.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 4: Interesse der Pkw-Nutzer an alternativer Antriebstechnologie.[21]
Quelle: ZMG Autostudie, S.8 (2009).
Demnach sind Kunden bereit, in neue Technologien zu investieren, um daraus ihre Vorteile zu ziehen. Natürlich ist auch aus Kundensicht das zu erreichende persönliche Image bzw. der soziale Status gegenüber den Mitmenschen ein Grund, um als technologischer Treiber die neuste Technologie zu besitzen.
Bemerkenswert und ein großes Ausrufezeichen für jeden Automobilhersteller ist die allgemeine Akzeptanz der Kunden im Bezug auf die Hybridtechnologie. Wie aus folgender Grafik ersichtlich wird, würden rund 30 % im Falle einer Schenkung ein Fahrzeug mit Hybridantrieb bevorzugen (s. Abb. 5).
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 5: Bevorzugte Antriebsarten von Pkw im Fall, dass dieser ein Geschenk ist.[22]
Quelle: YouGov (2012).
2.2 Der Staat als technologischer Treiber
Momentan ist der Gesetzgeber bzw. die Politik der wohl stärkste Einflussfaktor auf die Technologieentwicklung in Deutschland.
Sie nimmt durch die Emissionsgesetzgebung, Fahrverbote und Steuervorteile einen starken Einfluss. Die Tendenz der Emissionsgesetzgebung geht für Neuwagen ab dem Jahr 2020 klar in Richtung „Null“, was null Emissionsausstoß bei den zukünftigen Antrieben im Straßenverkehr bedeutet. Zu erkennen ist dies auch an den in den letzten Jahren eingeführten Umweltplaketten, der Pflicht von Ruß-Partikel-Filtern sowie weiteren Gesetzgebungen, um den Emissionsausstoß in Deutschland zu mindern. Hierdurch soll vor allem dem Klimawandel und der Luftverschmutzung entgegengewirkt werden. Ein weiteres Indiz für kommende ratifizierte Verordnungen vom deutschen Staat sind unsere Nachbarstaaten sowie die ständig steigende Abgabe vieler nationaler Kompetenzen an die EU-Einrichtungen. In Frankreich und Portugal werden beispielsweise Fahrzeuge mit einem hohen CO2-Ausstoß schon jetzt extra besteuert und Fahrzeuge mit einem geringen Ausstoß gefördert. Dies kann in Frankreich bis zu € 2.600,- Zulassungssteuer ausmachen. In Portugal wird ein Hybridfahrzeug mit bis zu € 3.000,-[23] gefördert. Auch andere Länder besitzen bereits ähnliche Gesetz-gebungen. Diese extremen Besteuerungen oder Förderungen zwingen die Auto-mobilhersteller innerhalb der EU, ihre Fahrzeuge effizienter zu entwickeln, da die EU solche Maßnahmen bald für alle EU-Mitgliedsstaaten einführen bzw. vereinheitlichen könnte.[24]
Der simple Fakt, dass immer mehr Menschen ein Fahrzeug besitzen, besitzen möchten und besitzen können, führt dazu, dass Kraftfahrzeuge immer recyclebarer werden und neue Sicherheitsbestimmungen erfüllen sowie den CO2-Ausstoß reduzieren müssen – der Umwelt zuliebe. Besonders in den bevölkerungsreichen Schwellenländern wie China oder Indien führt die immer weiter steigende Fahrzeugdichte dazu, dass in erster Linie die Großstädte „im Smog versinken“.[25] Das hat zur Folge, dass sich gerade diese Schwellenländer als führende technologische Treiber im Bereich der Elektromobilität sehen. Aber auch in den westlichen Nationen tritt immer mehr das Ziel in den Vordergrund, die Luftqualität in Ballungsgebieten zu verbessern. So gibt es hierzulande Gebiete, die durch staatliche Maßnahmen von Fahrzeugen mit zu hohem CO2-Ausstoß geschützt werden. Außerdem soll und kann die Geräuschkulisse von Verbrennungsmotoren in den Ballungsgebieten weiterhin verringert werden.[26]
2.3 Die Hersteller als technologische Treiber
Die sinkende Verfügbarkeit der momentan genutzten fossilen Brennstoffe bei gleichzeitig stark steigendem Bedarf zwingt ohnehin zur Entwicklung einer neuen Antriebstechnologie. So sollen langfristig auch die konstant steigenden Kosten für die Nutzer gesenkt werden. Neue Technologien stoßen demnach auf eine höhere Akzeptanz bei potentiellen Kunden, was wiederum zu einer erhöhten Nachfrage führt. Zudem gibt es nur wenige Erdöl fördernde Länder, die weiterhin oft politisch instabil sind und voraussichtlich auch bleiben werden. Die beiden durch Drosselung der Fördermengen erzeugten Ölkrisen von 1973 und 1979 führten den westlichen Industrieländern diesen Fakt vor Augen. Als direkte Folge waren kurzzeitig starke Steigerungen des Kraftstoffpreises sowie staatlich verordnete autofreie Sonntage zu beobachten.[27] Schlussfolgernd nehmen Hersteller und Zulieferer mit dem Ziel der Gewinnmaximierung Einfluss auf die Entwicklung neuer Technologien. Nachfolgende Abbildung zeigt die steigenden Neu-zulassungen von Hybridfahrzeugen in Deutschland von 2005 bis 2011. An diesem Anstieg innerhalb der Nische gilt es, gewinnträchtig zu partizipieren.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 6: Neuzulassungen von Hybridfahrzeugen in Deutschland.[28]
Quelle: KBA (2012).
Auch die zukünftige Wettbewerbsfähigkeit der Hersteller hängt von der Entwicklung neuer Technologien ab. So sind im Jahre 2020 voraussichtlich 20 % aller Fahrzeuge Hybrid betrieben (s. Abb. 7). An diesem wachsenden Markt sollte ein sicherer Marktanteil erarbeitet werden. Einfluss auf die Wettbewerbsfähigkeit nimmt auch das Image eines Automobilherstellers, das durch neuste Technologien gefördert wird.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 7: Prognose zur weltweiten Verteilung von Neuwagentypen im Jahre 2020.[29]
Quelle: Der Markt der Mobilität, S. 43 (2009).
Gleichzeitig entwickelt sich der prognostizierte Anteil der Hybridfahrzeuge am weltweiten Pkw-Absatz bis hin zum Jahre 2020 mit 20,2 % zu einem deutlichen Faktor (s. Abb. 8).
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 8: Prognose zum Anteil der jeweiligen Antriebsart am weltweiten Pkw-Absatz im Jahre 2020.[30]
Quelle: Financial Times Deutschland, 14.10.2009, S. 4 (2009).
Entscheidend für den Erfolg einer Technologie seitens des Herstellers ist also die Erfüllung der Kundenanforderung hinsichtlich Funktion und Wirtschaftlichkeit unter Einhaltung der gesetzlichen Rahmenbedingungen.[31]
Um den zukünftigen Herausforderungen, vor allem in Hinsicht auf globale Beschränkungen und die Reduktion des Verbrauches von Rohstoffen, gewachsen zu sein, sind Innovationen notwendig. „Die Elektrifizierung des Antriebes ist daher derzeit ein Thema hoher strategischer Bedeutung“, so Dipl.-Kfm. Ingo Olschewski, Mitarbeiter der Forschungsgesellschaft Kraftfahrwesen mbH Aachen. So seien nicht nur Fahrzeughersteller und Zulieferer, sondern besonders auch universitäre und private Forschungseinrichtungen im Wettrennen zur Lösung des Problems der massentauglichen Verbreitung von Fahrzeugen mit alternativen Antriebstechnologien eingestiegen.[32]
3. Kritik an der Hybridtechnologie
Die Hybridtechnologie gilt als fortschrittlicher gegenüber konventionellen Antriebstechnologien. Es ist naheliegend zu hinterfragen, warum nicht schon eher in diesem Bereich geforscht und entwickelt wurde. Die Antwort ist in den vielen Nachteilen zu den herkömmlichen Antriebsvarianten zu finden, die bisher von einer Weiterentwicklung abgelenkt haben. So geht zum Beispiel mit dem Vorhandensein der Hybridtechnologie ein zusätzliches Vorhandensein von mehr Technik an Bord (Elektromotor, Akkumulatoren, Inverter usw.) einher. Dadurch entsteht ein größeres Fehlerpotential im Fahrzeug. Folglich steigt auch das Gesamtgewicht des Pkw an, was zu einem Mehrverbrauch an Kraftstoff führt. Hinzu kommt der ebenfalls nicht unerhebliche Mehraufwand bei der Produktion der Hybrid-Pkw. Auch können durch die vorhandene Hochvoltleitung Bergungsmaßnahmen, insbesondere im Fall von Karosserie-Verformungen bei Unfällen, zu einem ernsthaften Problem werden.
Das größte Hindernis jedoch stellt die Batterietechnologie dar. Aufgrund einer zu geringen Leistung und Lebensdauer ist diese noch nicht ausgereift genug. Die momentane Batterieleistung schränkt somit auch die jährliche Fahrleistung ein. Hybridmodelle sind nicht für Vielfahrer geeignet, da ihre jährliche Laufleistung auf 15.000 bis 20.000 Kilometer ausgelegt ist. Demnach können nur lokale Transportbedürfnisse mit einem überschaubaren Bewegungsradius erfüllt werden. Einen weiteren kritischen Faktor stellt der Preis dar, der gegenüber einem üblichen Pkw mit vergleichbarer Leistung deutlich höher ist, nämlich rund € 8.000,- mehr als bei Vergleichsmodellen ohne Hybridtechnologie.[33],[34]
4. Notwendigkeit der Hybridtechnologie
Trotz aller Kritik an der Hybridtechnologie wird diese Antriebsform gebraucht – und zwar jetzt und so schnell wie möglich! Die Notwendigkeit ist bereits im Absatz der technologischen Treiber ausführlich beschrieben.
Unabhängig von den Fakten der technologischen Treiber sprechen weitere Umstände für die Hybridantriebe. Während der Inbetriebnahme des Verbrennungs-motors wird der Elektromotor wieder aufgeladen. Es ist keine externe Ladung notwendig, womit die Unabhängigkeit von elektrischen Ladestationen weiterhin garantiert ist. Das „Reichweitenproblem“ wird demnach umgangen, da für Fahrten nach wie vor auf den primären Kraftstoffantrieb zurückgegriffen werden kann. Dies ist bei einem rein elektrischen Fahrzeug wiederum nicht möglich. Aus der technischen Perspektive wird schon beim Anfahren das maximale Drehmoment zur Verfügung gestellt, was zu einer besseren Beschleunigung führt, die die Kunden genießen können.[35]
Die Kritikpunkte gegen eine Weiterentwicklung der Hybridtechnologie haben sich im letzten Jahrzehnt nicht geändert. Die in Punkt 2 beschriebenen Vorteile dieser Technologie haben sich in ihrer Wertigkeit jedoch stark erhöht.
5. Die Hybridtechnologie als Unterform des Elektrofahrzeuges
5.1 Elektrofahrzeuge
Aus den Beschreibungen der Hybridmodelle in Punkt 1 des Kapitels B ist zu erkennen, dass diese Antriebstechnologien nur als Übergangslösung für ein geeignetes batteriebetriebenes Elektrofahrzeug gelten können. Um einen Ausblick auf die Zukunft der alternativen Antriebe zu geben und den Unterschied zur Hybridtechnologie klarzustellen, wird nun ein kurzer Überblick der rein elektrischen Antriebstechnologie gegeben.
Das Elektrofahrzeug wird allein von einem Elektromotor angetrieben, bei dem Batterien den Strom speichern und diesen direkt aus dem Stromnetz beziehen. Momentan ist diese Technik zwar schon in Betrieb, jedoch wird sie überwiegend nur bei Kleinst- und Leichtfahrzeugen im Bereich von Flottenfahrzeugen und hauptsächlich auf Werksgeländen eingesetzt.[36] Mit dieser Antriebstechnologie ist ein emissionsfreies Fahren möglich, so dass Fahrverbote in den Innenstädten umgangen werden können. Außerdem wird sich auf nur eine Antriebsquelle beschränkt. Weitere Vorteile sind der geräuscharme Betrieb und die gute Beschleunigung sowie die optimale Nutzung der Bremsenergie.
Allerdings ist die CO2-Bilanz nachhaltig nur so gut wie der Strom in Kraftwerken gewonnen wird.[37] Die begrenzte Reichweite und die derzeit langen Aufladezeiten sind wohl die größten Nachteile.[38] Ferner ist die notwendige Infrastruktur zum Laden der Batterien noch nicht genügend ausgebaut und die Anschaffungskosten sind derzeit zu hoch. Die möglicherweise größten Herausforderungen bei Elektrofahrzeugen und dadurch gleichzeitig die größte Legitimation für Hybridfahrzeuge sind sowohl die noch dringend notwendige Verbesserung der Nutzerakzeptanz als auch die noch nicht ausgereifte Batterietechnik zusammen mit der noch nicht abgeschlossenen Entwicklung im Bereich der Energie-gewinnung.[39],[40]
5. 2 Abgrenzung zur Hybridtechnologie
Die Hybridtechnologie ist folglich als Übergangslösung hin zur optimalen Elektromobilität zu verstehen.
Abgrenzen lassen sich die Elektro- zu den Hybridfahrzeugen durch ein wesentliches Merkmal: Sie fahren rein elektrisch ohne die Möglichkeit, auf einen Kraftstoffantrieb zurückzugreifen und sind daher abhängig von externer oder interner Erzeugung von Strom, der in Batterien gespeichert wird.
Im Januar 2010 waren nur rund 1.500 Elektrofahrzeuge in Deutschland unterwegs. Im selben Jahr bekräftigt Bundeskanzlerin Angela Merkel im Zuge der „Nationalen Plattform Elektromobilität“ aber, dass bis zum Jahr 2020 rund eine Millionen Elektrofahrzeuge auf den deutschen Straßen einzuführen sind. Jedoch ist dies im Vergleich zu den vorhandenen konventionellen Pkw eine äußerst geringe Anzahl. Hochrechnungen zufolge wird bis zum Jahre 2025 weltweit mit rund 15 Millionen Elektrofahrzeugen auf den Straßen gerechnet. Das sind jedoch nur 1,5 % des zukünftigen Fahrzeugbestandes.[41]
[...]
[1] Vgl. Sprengel (1998), S. 44.
[2] Vgl. Stampfl (2011), S. 105.
[3] Vgl. Pepels (2012), S. 728.
[4] Vgl. Vergossen (2004), S. 25.
[5] Zur Vereinfachung des technischen Teils der Arbeit wird bei der Hybridtechnologie nur auf die Micro-, Mild- und Full-Hybrid bezogen.
[6] Vgl. Wallentowitz/Freialdenhoven/Olschewski (2010), S. 52-54.
[7] Vgl. Hofmann (2010), S. 42-52.
[8] Vgl. Olschewski (2010), Folie 12-14.
[9] Vgl. Wallentowitz/Freialdenhoven/Olschewski (2010), S. 54.
[10] Vgl. Hofmann (2010), S. 42.
[11] Vgl. Olschewski (2010), Folie 15-17.
[12] Vgl. Wallentowitz/Freialdenhoven/Olschewski (2010), S. 54-55.
[13] Vgl. Reif (2011), S. 100.
[14] Vgl. Friederich (2012), S. 32.
[15] Vgl. Olschewski (2010), Folie 18-22.
[16] Vgl. Wallentowitz/Freialdenhoven/Olschewski (2010), S. 55-58.
[17] Vgl. Wallentowitz/Freialdenhoven/Olschewski (2010), S. 58.
[18] Vgl. Hofmann (2010), S. 46.
[19] Vgl. Wallentowitz/Freialdenhoven/Olschewski (2010), S. 22-23.
[20] URL 1
[21] URL 2
[22] URL 3
[23] URL 4
[24] Vgl. Wallentowitz/Freialdenhoven/Olschewski (2010), S. 3-22.
[25] URL 5
[26] Vgl. Wallentowitz/Freialdenhoven/Olschewski (2010), S. 1.
[27] Vgl. Wallentowitz/Freialdenhoven/Olschewski (2010), S. 23-34.
[28] URL 6
[29] URL 7
[30] URL 8
[31] Vgl. Olschewski (2010), Folie 3-8.
[32] Vgl. Olschewski (2010), Folie 7-8.
[33] URL 9
[34] Vgl. Hofmann (2010), S. 21.
[35] URL 10
[36] Vgl. Wallentowitz/Freialdenhoven/Olschewski (2010), S. 59-60.
[37] Vgl. Proff u. a. (2012), S. 410.
[38] Vgl. Heising/Ersoy/Gies (2011), S. 653.
[39] Vgl. Olschewski (2010), Folie 23-27 .
[40] Vgl. Wallentowitz/Freialdenhoven/Olschewski (2010), S. 60.
[41] Vgl. Becker (2010), S. 143.
Häufig gestellte Fragen
Wie werden Hybridfahrzeuge in Deutschland wahrgenommen?
Oft besteht ein falscher Kenntnisstand, der mit negativen Gefühlen verknüpft ist. Die Automobilindustrie versucht daher, durch neue Kommunikationsstrategien gegenzusteuern.
Welche Zielgruppen sind für Oberklasse-Hybride relevant?
Die Arbeit analysiert Sinus-Milieus wie "Moderne Performer", "Postmaterielle" und "Etablierte", die aufgrund ihres Lebensstils und Einkommens als potenzielle Käufer infrage kommen.
Welche Kommunikationsinstrumente eignen sich für diese Zielgruppen?
Untersucht werden unter anderem Online-Marketing, Außenwerbung, Hörfunk, Printmedien sowie Ambient Media und Kinowerbung.
Was unterscheidet Mild-Hybrid von Plug-in-Hybrid?
Die Arbeit erläutert verschiedene Hybridformen, wobei der Plug-in-Hybrid extern geladen werden kann und größere elektrische Reichweiten bietet als ein Mild- oder Full-Hybrid.
Welche Rolle spielt die Audi-Philosophie in diesem Projekt?
Das Projekt nutzt Audi als Fallbeispiel, um zu zeigen, wie ein Premiumhersteller technologische Innovation mit gezielter Kundenansprache verbindet.
- Quote paper
- Bachelor of Arts Marc Maher Akid (Author), 2012, Kommunikationsinstrumente für Oberklassefahrzeuge mit hybrider Antriebstechnologie, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/269271