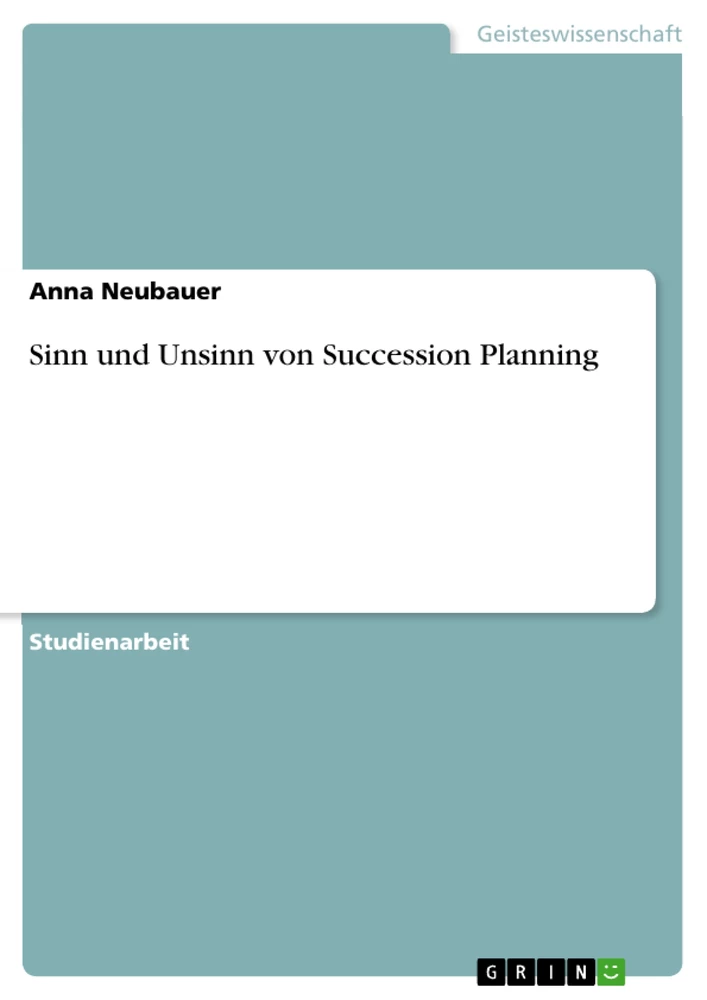Abstract
Succession Planning ist ein strukturierter Prozess und umfasst eine Vielzahl an Aktivitäten zur Planung der Nachfolge von Führungskräften in Organisationen. Dieser Prozess sollte einer bestimmten Ordnung folgen, langfristig sein und kann verschiedene methodische Werkzeuge beinhalten. Garman und Glawe (2004) haben die Forschung zu Succession Planning in einem Review zusammengefasst, aber es bedarf noch weiteren Wachstums dieses Forschungsbereiches, um den Erfolg auch messbar zu machen und eine evidenzbasierte, praxisnahe Anleitung für Succession Planning zu entwickeln, die auch im Berufsleben von beratenden und prozessbegleitenden Psychologen zur Anwendung kommen kann. Einige positive wirtschaftliche Resultate lassen sich schon jetzt festhalten, wenn Succession Planning durchgeführt wird. Da momentan noch in zu wenigen Unternehmen ein Ansatz zur Regelung der Nachfolge in wichtigen Firmenpositionen vorliegt, könnte dies aufgrund der Finanzkrise und der Verrentung der sogenannten Baby Boomer Generation zu makroökonomischen Folgen führen. Deswegen sollte die Forschung zu diesem Thema unbedingt ausgeweitet und Unternehmen dazu ermuntert werden, Succession Planning Maßnahmen zu implementieren.
Inhaltsverzeichnis
- Abstract zur Arbeit: „Sinn und Unsinn von Succession Planning“
- Einleitung
- Theoretische Grundlagen
- Was ist Succession Planning?
- Aktueller Forschungsstand zu Succession Planning
- Diskussion
- Evidenzbasierte Praxis für Succession Planning
- Einsatz von Succession Planning in der Praxis
- Sinn und Unsinn von Succession Planning
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit untersucht den Sinn und Unsinn von Succession Planning. Ziel ist es, die Vor- und Nachteile dieses Prozesses darzustellen und den aktuellen Forschungsstand zu beleuchten. Die Arbeit betrachtet die praktische Anwendung und diskutiert die Herausforderungen bei der Implementierung.
- Definition und geschichtliche Entwicklung von Succession Planning
- Aktueller Forschungsstand und evidenzbasierte Praxis
- Praktische Anwendung von Succession Planning in Unternehmen
- Vorteile und Nachteile von Succession Planning
- Auswirkungen auf die Wirtschaft (Mikro- und Makroökonomie)
Zusammenfassung der Kapitel
Abstract zur Arbeit: „Sinn und Unsinn von Succession Planning“: Dieses Abstract fasst die Kernaussagen der Arbeit zusammen. Es definiert Succession Planning als strukturierten Prozess zur Nachfolgeplanung von Führungskräften und hebt die Notwendigkeit weiterer Forschung zur messbaren Erfolgsbewertung und praxisnahen Anwendung hervor. Es werden positive wirtschaftliche Ergebnisse angesprochen und der Bedarf an Implementierung in Unternehmen betont, besonders im Hinblick auf die demografische Entwicklung und die Auswirkungen der Finanzkrise.
Einleitung: Die Einleitung verdeutlicht die Bedeutung von Succession Planning, insbesondere vor dem Hintergrund des bevorstehenden Ruhestands der Baby Boomer Generation und den daraus resultierenden wirtschaftlichen Herausforderungen. Sie hebt die potenziellen negativen Folgen unzureichender Nachfolgeplanung hervor – von Arbeitsplatzverlusten bis hin zu Insolvenzen – und betont den Einfluss auf die Makroökonomie. Die Arbeit skizziert ihren Aufbau und die Forschungsfrage.
Theoretische Grundlagen: Dieses Kapitel liefert eine Definition von Succession Planning als Teil des Personalmarketings. Es beschreibt den Prozess als strukturierte, langfristige Aktivität zur Identifizierung und Vorbereitung potentieller Nachfolger. Die historische Entwicklung wird kurz skizziert, beginnend mit der Anwendung in Königshäusern und Familienunternehmen bis hin zum Einsatz in der British Army und dem Civil Service. Die Problematik politischer Einflussnahme und die Vorteile einer objektiven Beratung werden angesprochen.
Diskussion: Dieser Abschnitt setzt sich mit der evidenzbasierten Praxis und dem praktischen Einsatz von Succession Planning auseinander. Er analysiert die Vor- und Nachteile des Verfahrens und beleuchtet die Herausforderungen und Chancen, die mit seiner Implementierung verbunden sind. Der Fokus liegt auf der Synthese aus theoretischen Grundlagen und empirischen Beobachtungen, um den Sinn und Unsinn von Succession Planning zu evaluieren.
Schlüsselwörter
Succession Planning, Nachfolgeplanung, Führungskräfteentwicklung, Personalmarketing, Personalpsychologie, Wirtschaftswissenschaften, Evidenzbasierte Praxis, Baby Boomer Generation, Finanzkrise, Mikroökonomie, Makroökonomie.
FAQ: Sinn und Unsinn von Succession Planning
Was ist der Gegenstand dieser Seminararbeit?
Die Seminararbeit untersucht den Sinn und Unsinn von Succession Planning. Sie beleuchtet die Vor- und Nachteile dieses Prozesses, den aktuellen Forschungsstand und die praktische Anwendung, inklusive der Herausforderungen bei der Implementierung.
Was sind die Ziele der Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, die Vor- und Nachteile von Succession Planning darzustellen und den aktuellen Forschungsstand zu beleuchten. Sie betrachtet die praktische Anwendung und diskutiert die Herausforderungen bei der Implementierung.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themen: Definition und geschichtliche Entwicklung von Succession Planning; aktueller Forschungsstand und evidenzbasierte Praxis; praktische Anwendung in Unternehmen; Vorteile und Nachteile; Auswirkungen auf die Mikro- und Makroökonomie.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit beinhaltet ein Abstract, eine Einleitung, theoretische Grundlagen, eine Diskussion und ein Fazit. Die theoretischen Grundlagen umfassen eine Definition von Succession Planning und einen Überblick über dessen historische Entwicklung. Die Diskussion analysiert die evidenzbasierte Praxis und den praktischen Einsatz, inklusive der Herausforderungen und Chancen.
Was wird im Abstract zusammengefasst?
Das Abstract fasst die Kernaussagen der Arbeit zusammen. Es definiert Succession Planning, hebt den Bedarf weiterer Forschung hervor und betont positive wirtschaftliche Ergebnisse sowie den Bedarf an Implementierung in Unternehmen, besonders im Hinblick auf demografische Entwicklung und die Auswirkungen der Finanzkrise.
Was wird in der Einleitung erläutert?
Die Einleitung verdeutlicht die Bedeutung von Succession Planning vor dem Hintergrund des bevorstehenden Ruhestands der Baby Boomer Generation und der daraus resultierenden wirtschaftlichen Herausforderungen. Sie hebt potenzielle negative Folgen unzureichender Nachfolgeplanung hervor und skizziert den Aufbau und die Forschungsfrage.
Was wird in den theoretischen Grundlagen behandelt?
Dieses Kapitel liefert eine Definition von Succession Planning als Teil des Personalmarketings, beschreibt den Prozess und skizziert die historische Entwicklung, beginnend mit der Anwendung in Königshäusern bis hin zum Einsatz im öffentlichen Dienst. Die Problematik politischer Einflussnahme und die Vorteile objektiver Beratung werden angesprochen.
Was wird in der Diskussion analysiert?
Dieser Abschnitt setzt sich mit der evidenzbasierten Praxis und dem praktischen Einsatz von Succession Planning auseinander. Er analysiert die Vor- und Nachteile und beleuchtet die Herausforderungen und Chancen der Implementierung. Der Fokus liegt auf der Synthese aus Theorie und Empirie, um den Sinn und Unsinn von Succession Planning zu evaluieren.
Welche Schlüsselwörter sind relevant für diese Arbeit?
Die relevanten Schlüsselwörter sind: Succession Planning, Nachfolgeplanung, Führungskräfteentwicklung, Personalmarketing, Personalpsychologie, Wirtschaftswissenschaften, Evidenzbasierte Praxis, Baby Boomer Generation, Finanzkrise, Mikroökonomie, Makroökonomie.
- Arbeit zitieren
- Anna Neubauer (Autor:in), 2013, Sinn und Unsinn von Succession Planning, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/269296