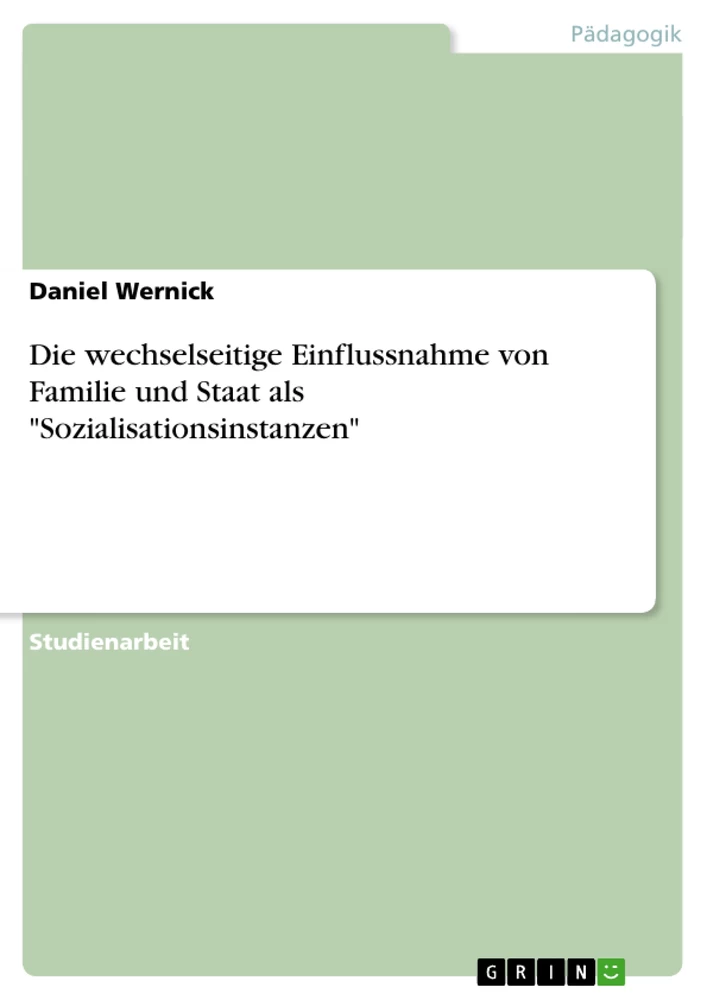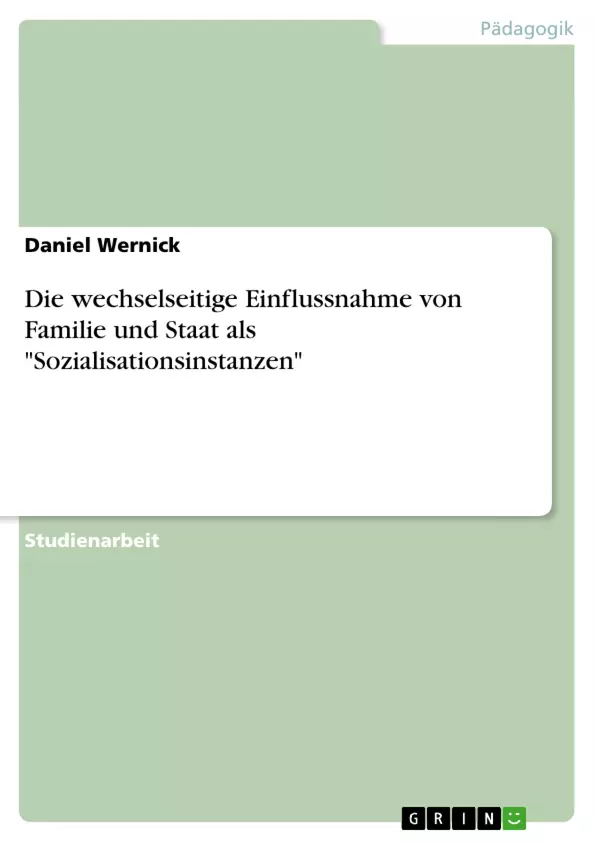Die Frage die mich bei dem Thema Sozialisation vorrangig beschäftigt, ist :
Wie können einerseits finanzielle und wirtschaftliche Belastungen für den Staat
und , zeitliche und physische Belastungen andererseits für die Familie so
austangiert werden, das beide Seiten weniger unter der Sozialisation der
heranwachsenden Schutzbefohlenen und dessen Begleiterscheinungen zu
tragen haben?
Eine Familie mit ein oder mehreren Kindern (traditionelle Kleinfamilie) ist kein
Auslaufmodell, aber es ist ein Sozialisationsumfeld das heute mit anderen
Sozialisationsformen konkurrieren muss. Sie ist ein Modell auf unbestimmte
Zeit.
Zu den verschiedenen “Konkurrenten“ der Kernfamilie, die ein
Sozialisationsumfeld darstellen könnten, zählen bekannter maßen:
Alleinerziehende Väter oder Mütter, die Großfamilie (weniger in
Industrieländern), die nichteheliche Lebensgemeinschaft und die
homosexuellen Ehe.
Kann bei solch einer Vielzahl an Modellen, eine ausgewogene und umfassende
Sozialisation gerade auch im Bezug auf die unterschiedliche Qualität der
einzelnen Modelle gewährleistet werden?
Um auf Antworten zu stoßen, versuche ich einzelne Ursachen von Wertewandel
näher zu durchleuchten.
Natürlich steht auch der Staat in der Verantwortung, altersgerechte und vor
allem lerneffiziente Möglichkeiten für die Jugendlichen anzubieten, um für eine
Entlastung der “Familie“ zu sorgen. Der Schwerpunkt der Arbeit liegt aber nicht
wie man sich denken könnte, auf dem Bereich Schule als Sozialisationsfaktor,
sondern auf den Voraussetzungen die Familie und Staat mit einbringen. Ein
Zusammenspiel zwischen Familie und Staat, das ich unter dem Begriff
Chancengleichheit betrachten möchte, da ich glaube das gerade das
Verantwortungsdenken in beiden Institutionen zu wertvollen Lösungsansätzen,
auf dem Weg zu einem ausgeglichenen Sozialisationsumfeld für Jugendliche,
werden können. Zum Abschluss möchte ich dann noch einen Einblick in den
Bereich des Gesundheitswesens machen um zu verdeutlichen, dass die
Auswirkungen von Sozialisation in alle Lebensbereiche hineinspielt und sie
umgestaltet.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Definition Familie und Staat
- Sozialisation und Lebenswelt
- Einflussnahme von Familie und Staat
- Verschiedene Voraussetzungen
- Mögliche Ursachen von Dissonanzen
- Lösungsansätze/präventive Interventionen
- Sozialisation und Gesundheitswesen
- Fazit
- Quellennachweis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit beleuchtet die wechselseitige Einflussnahme von Familie und Staat als Sozialisationsinstanzen. Sie analysiert die Herausforderungen, die sich aus der Doppelrolle von Familie und Staat in der Sozialisation von Kindern und Jugendlichen ergeben. Dabei stehen die unterschiedlichen Belastungen, die mit der Sozialisation einhergehen, im Fokus.
- Die Rolle der Familie als primäre Sozialisationsinstanz
- Die Verantwortung des Staates für den Schutz und die Förderung der Familie
- Mögliche Dissonanzen zwischen den Einflüssen von Familie und Staat
- Lösungsansätze und präventive Interventionen
- Die Bedeutung der Sozialisation für das Gesundheitswesen
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Arbeit stellt die Fragestellung nach dem Ausgleich finanzieller und zeitlicher Belastungen von Familie und Staat im Kontext der Sozialisation von Kindern und Jugendlichen. Sie beleuchtet verschiedene Sozialisationsformen, die neben der traditionellen Kleinfamilie existieren. Die Arbeit konzentriert sich auf die Voraussetzungen, die Familie und Staat einbringen, um ein ausgeglichenes Sozialisationsumfeld zu schaffen.
- Definition: Familie und Staat: Die Arbeit definiert den Begriff Familie als eine Gruppe von Personen, die in der Regel täglich miteinander Kontakt hat und eine Vielzahl von Aufgaben gemeinsam regelt. Der Staat wird als Zusammenschluss einer Bevölkerung innerhalb eines bestimmten Gebietes unter einer souveränen Gewalt definiert, die das Zusammenleben des Volkes regelt und schützt.
- Sozialisation und Lebenswelt: Das Konzept der Lebenswelt wird erläutert. Die Arbeit betont die Bedeutung der Lebenswelt als Raum der Entwicklung und Erziehung von Kindern und Jugendlichen und die Wichtigkeit der Aneignung der Regeln und Möglichkeiten dieser Welt.
- Einflussnahme von Familie und Staat: Die Arbeit beleuchtet die Rolle des Staates als Schutzmacht der Familie und die primäre Verantwortung der Familie in den ersten Lebensjahren eines Menschen. Sie betont die Wichtigkeit der Familie für die Entfaltungsmöglichkeiten des Kindes und die Notwendigkeit, ihm bestimmte Rollen und Erwartungen für das Funktionieren des sozialen Systems beizubringen.
- Verschiedene Voraussetzungen: Dieser Abschnitt behandelt die unterschiedlichen Voraussetzungen, die Familien und der Staat für die Sozialisation von Kindern und Jugendlichen mitbringen. Er berücksichtigt die verschiedenen familiären Modelle und die damit verbundenen Herausforderungen.
- Mögliche Ursachen von Dissonanzen: Dieser Abschnitt beleuchtet die möglichen Ursachen für Konflikte und Dissonanzen zwischen den Einflüssen von Familie und Staat in der Sozialisation. Er analysiert die Unterschiede in den Werten und Zielen, die Familie und Staat vertreten.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit den zentralen Begriffen Sozialisation, Familie, Staat, Lebenswelt, Wertewandel, Chancengleichheit und Gesundheitswesen. Sie analysiert die wechselseitigen Einflüsse dieser Faktoren auf die Entwicklung und Erziehung von Kindern und Jugendlichen, die Bedeutung von Dissonanzen und die Notwendigkeit von präventiven Interventionen. Darüber hinaus werden die unterschiedlichen Belastungen von Familie und Staat im Kontext der Sozialisation von Kindern und Jugendlichen beleuchtet.
Häufig gestellte Fragen
Wie arbeiten Familie und Staat als Sozialisationsinstanzen zusammen?
Die Familie ist die primäre Instanz für die frühe Entwicklung, während der Staat durch Schulen und Gesetze den Schutzraum und die Rahmenbedingungen für die weitere Sozialisation schafft.
Ist die traditionelle Kleinfamilie heute ein Auslaufmodell?
Nein, aber sie konkurriert zunehmend mit anderen Formen wie Alleinerziehenden, Patchworkfamilien oder gleichgeschlechtlichen Ehen, was neue Anforderungen an die staatliche Unterstützung stellt.
Was versteht man unter "Chancengleichheit" in diesem Kontext?
Es beschreibt das Ziel, dass der Staat durch lerneffiziente Angebote und finanzielle Entlastung sicherstellt, dass die Sozialisation unabhängig vom familiären Hintergrund gelingt.
Welche Belastungen entstehen für Familien durch die Sozialisation?
Neben finanziellen Kosten sind es vor allem zeitliche und psychische Belastungen, die durch die Vereinbarkeit von Beruf und Erziehungsarbeit entstehen.
Wie hängen Sozialisation und das Gesundheitswesen zusammen?
Eine gelungene Sozialisation fördert die psychische und physische Gesundheit. Dissonanzen im Umfeld können hingegen zu langfristigen Belastungen für das Gesundheitssystem führen.
- Citation du texte
- Daniel Wernick (Auteur), 2004, Die wechselseitige Einflussnahme von Familie und Staat als "Sozialisationsinstanzen", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/26982