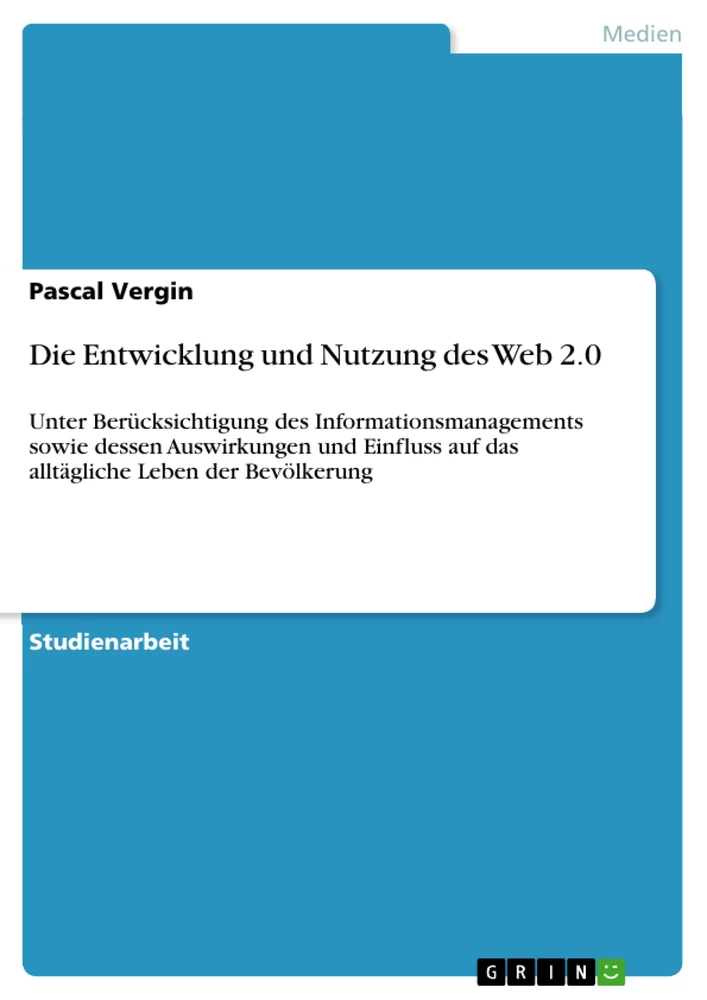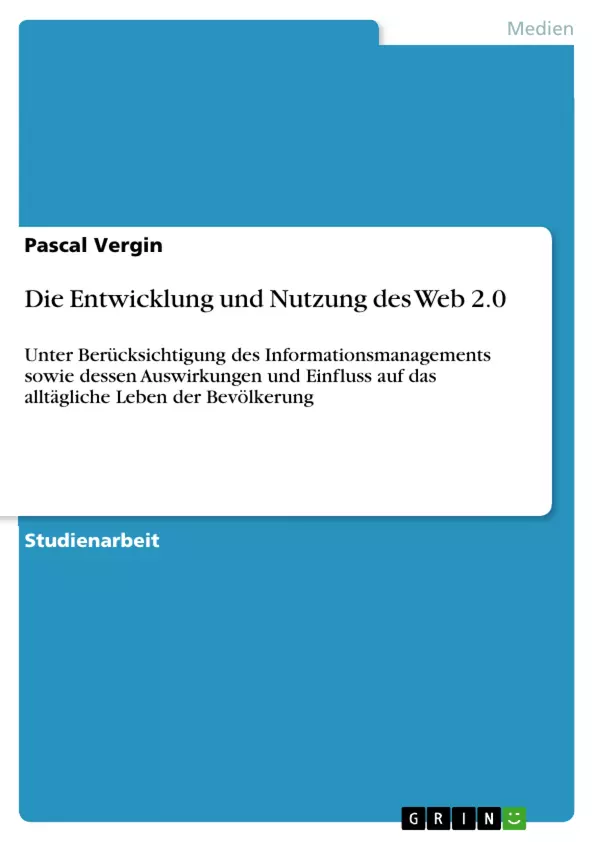In der folgenden Arbeit wird die Entwicklung und Nutzung des Web 2.0 unter Berücksichtigung des Informationsmanagements aufgezeigt. Des Weiteren werden die daraus entstandenen Auswirkungen und Einflüsse auf das alltägliche Leben der Bevölkerung dargestellt. Der Hauptteil der Arbeit besteht darin, die Web 2.0-Anwendungen aufzuführen und die damit verbundene Nutzung und Entwicklung zu analysieren. Dieses soll vor allem einen Überblick über das Leben mit dem Internet ermöglichen, welches – heutzutage - nicht mehr wegzudenken ist. Fast jeder von uns benutzt irgendwie, sei es bewusst oder unbewusst, das Web 2.0 mit seinen umfangreichen Angeboten und Anwendungen. Zum einen wird nachfolgend die Entwicklung des Internets und damit auch des Web 2.0 sowie des Informationsapparates, welchen dieser beinhaltet, detailliert dargestellt und zum anderen die Auseinandersetzung seitens der weltweiten Bevölkerung mit den Neuerungen aus dem „World Wide Web“ aufgeführt. Hierfür wird die Nutzung einzelner Web 2.0-Plattformen detailliert erläutert. Gleichzeitig wird die Entwicklung und Entstehung dieser Web 2.0-Angebote chronologisch dargestellt, damit dadurch eine sinnvolle und leicht verständliche zeitliche Reihenfolge entsteht. Ferner wird dieses anhand von Statistiken und Studien belegt.
Die vorliegende Arbeit verdeutlicht das Ziel, den aktuellen Kenntnisstand der Internetuser, sowie die vorhandenen Informationsressourcen, die durch das Web 2.0 abgerufen werden können, darzulegen. Die Tatsache, ob die Nutzung des Web 2.0 einfach hingenommen wird ohne darüber nachzudenken, dass davon zum Teil unser Leben bestimmt und stark vereinfacht wird, ist ein weiterer Zielaspekt dieser Arbeit.
Des Weiteren ist von Interesse, inwiefern das Web 2.0 sich auf das Leben der Bevölkerung auswirkt und dieses gleichzeitig beeinflusst. Ist es wirklich für jeden selbstverständlich, das Web 2.0 zu nutzen? Oder ist sich ein Teil der Bevölkerung bewusst, welche Auswirkungen es haben kann, die umfangreichen Web 2.0-Angebote übermäßig in Anspruch zu nehmen? Dies sind Fragen, die es in den folgenden Kapiteln zu beantworten gilt.
Inhaltsverzeichnis
I Abkürzungsverzeichnis
1 Einführung
2 Web 2.0
2.1 Entwicklung des Web 2
2.2 Informationsmanagement
3 Nutzung der Bevölkerung
3.1 Nutzung in Deutschland
3.2 Nutzung weltweit
4 Auswirkungen und Einfluss im alltäglichen Leben
5 Fazit
II Literaturverzeichnis
III Anlagen/Anhang
- Quote paper
- Pascal Vergin (Author), 2013, Die Entwicklung und Nutzung des Web 2.0, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/270516