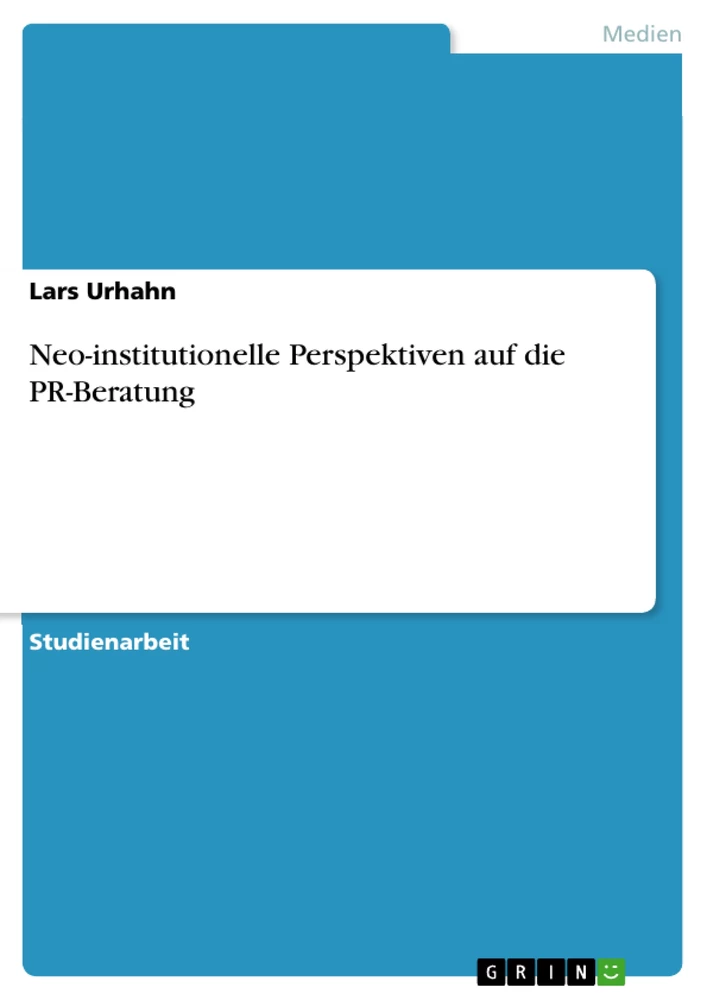In der heutigen – durch die Globalisierung geprägten – Welt bewegen sich Individuen fast
überall im Spannungsfeld von Organisationen. Egal welchen Aktivitäten man sein alltägliches
Leben widmet, stets kommt man direkt oder indirekt mit Organisationen in Berührung.
„Erziehung erfolgt zu weiten Teilen in Kindergärten und Schulen. Wenn von Religion die
Rede ist, dann sind in der Regel auch kirchliche Organisationen angesprochen. Beim
Rechtswesen denkt man schnell an Gerichte und Anwaltskanzleien, beim Gesundheitssystem
an Krankenhäuser, Pflegeheime und Krankenkassen“ – die Liste der von Organisationen
durchdrungenen Gesellschaftskomplexe ließe sich beliebig fortführen. Verfechter der
Organisationstheorie sprechen mittlerweile sogar von einer „Organisationsgesellschaft“.
Organisationen bieten Individuen dabei quasi eine Art Orientierungsrahmen, durch dessen
Hilfe sie ihren Alltag in einer komplexen Welt strukturieren können. Manche Organisationen
erreichen in diesem Zusammenhang einen so hohen Legitimitätsstatus, dass sie von den
Akteuren einer Gesellschaft irgendwann kaum noch hinterfragt und gewissermaßen als
ontologisch gegeben erachtet werden. Dass Organisationen jedoch nicht nur auf andere
Parameter – wie Akteure und ihre Handlungen – einwirken, sondern ihrerseits unter dem
Einfluss bestimmter Faktoren stehen, ist heruntergebrochen auf eine simplifizierende Formel,
eine der Hauptthesen des organisationalen Neo-Institutionalismus (NI). Als maßgeblichen
Einflussfaktor auf Organisationen macht der NI dabei – wie es der Name bereits suggeriert –
Institutionen aus, die durch verschiedene Prozesse auf Organisationen einwirken. Schon einer
der Vorreiter der Disziplin, der Soziologe Émile Durkheim (1858-1918) betonte die
Wichtigkeit von Institutionen und sprach in seinen „Regeln der soziologischen Methode“ von
der Soziologie als „Wissenschaft von den Institutionen“. Doch wie äußert sich der Einfluss
von Institutionen auf organisationale Bereiche und was versteht man eigentlich unter dem
Terminus der „Institution“? Diese Fragen werden im ersten Teil der Arbeit, der sich mit der
wissenschaftlichen Entstehungsgeschichte des NI sowie mit seinen Kernbegriffen und
Grundannahmen befasst, beantwortet. Anschließend sollen die neo-institutionellen Konzepte
auf das Feld der PR-Beratung übertragen werden, das momentan – wie fast alle Bereiche der Consulting-Branche – stark expandiert. [...]
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Neo-institutionelle Perspektiven: Entwicklung, Definition, Grundannahmen
2.1 Entwicklung
2.2 Definition
2.3 Grundannahmen
2.3.1 Legitimität
2.3.2 Isomorphie
2.3.3 Diffusion
3. PR-Beratung aus neo-institutioneller Perspektive
3.1 Stand der PR-Beratung
3.2 Neo-institutionelle Konzepte im Kontext der PR-Beratung
3.2.1 PR-Beratung und Legitimität
3.2.2 PR-Beratung und Isomorphie
3.2.3 PR-Beratung und Diffusion
3.3 Modell der Agentschaft
4. Fazit
5. Literatur- und Quellenverzeichnis
Häufig gestellte Fragen
Was besagt der organisationale Neo-Institutionalismus (NI)?
Der NI geht davon aus, dass Organisationen stark von gesellschaftlichen Erwartungen und Institutionen beeinflusst werden, um Legitimität zu erlangen, anstatt nur rein rational-ökonomisch zu handeln.
Was bedeutet „Isomorphie“ in der Organisationstheorie?
Isomorphie beschreibt den Prozess, durch den Organisationen sich einander angleichen, um gesellschaftlich anerkannt zu werden und dem Druck ihrer Umwelt zu entsprechen.
Warum ist Legitimität für Organisationen so wichtig?
Legitimität sichert das Überleben einer Organisation. Akteure hinterfragen Institutionen mit hohem Status kaum noch und betrachten sie als gegeben.
Wie lässt sich der NI auf die PR-Beratung übertragen?
Die Arbeit untersucht, wie PR-Agenturen durch die Übernahme bestimmter Standards und Strukturen ihre professionelle Glaubwürdigkeit und Marktposition sichern.
Was versteht man unter „Diffusion“ im Kontext von Institutionen?
Diffusion beschreibt die Ausbreitung von organisationalen Praktiken, Ideen oder Strukturen innerhalb eines Feldes, oft getrieben durch den Wunsch nach Professionalisierung.
- Quote paper
- Lars Urhahn (Author), 2014, Neo-institutionelle Perspektiven auf die PR-Beratung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/270568