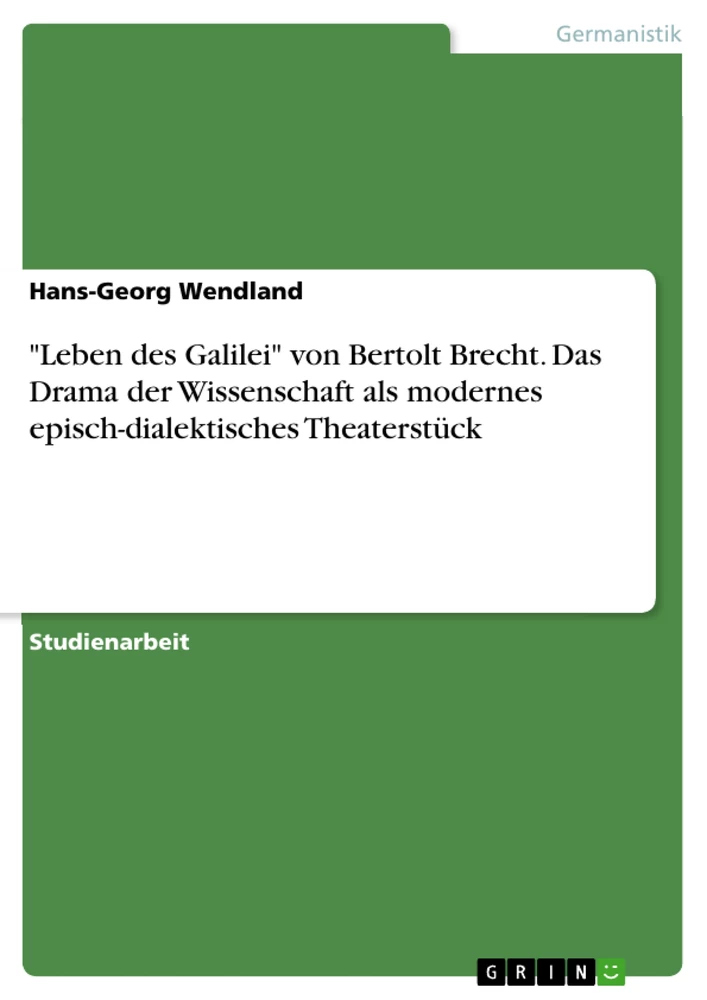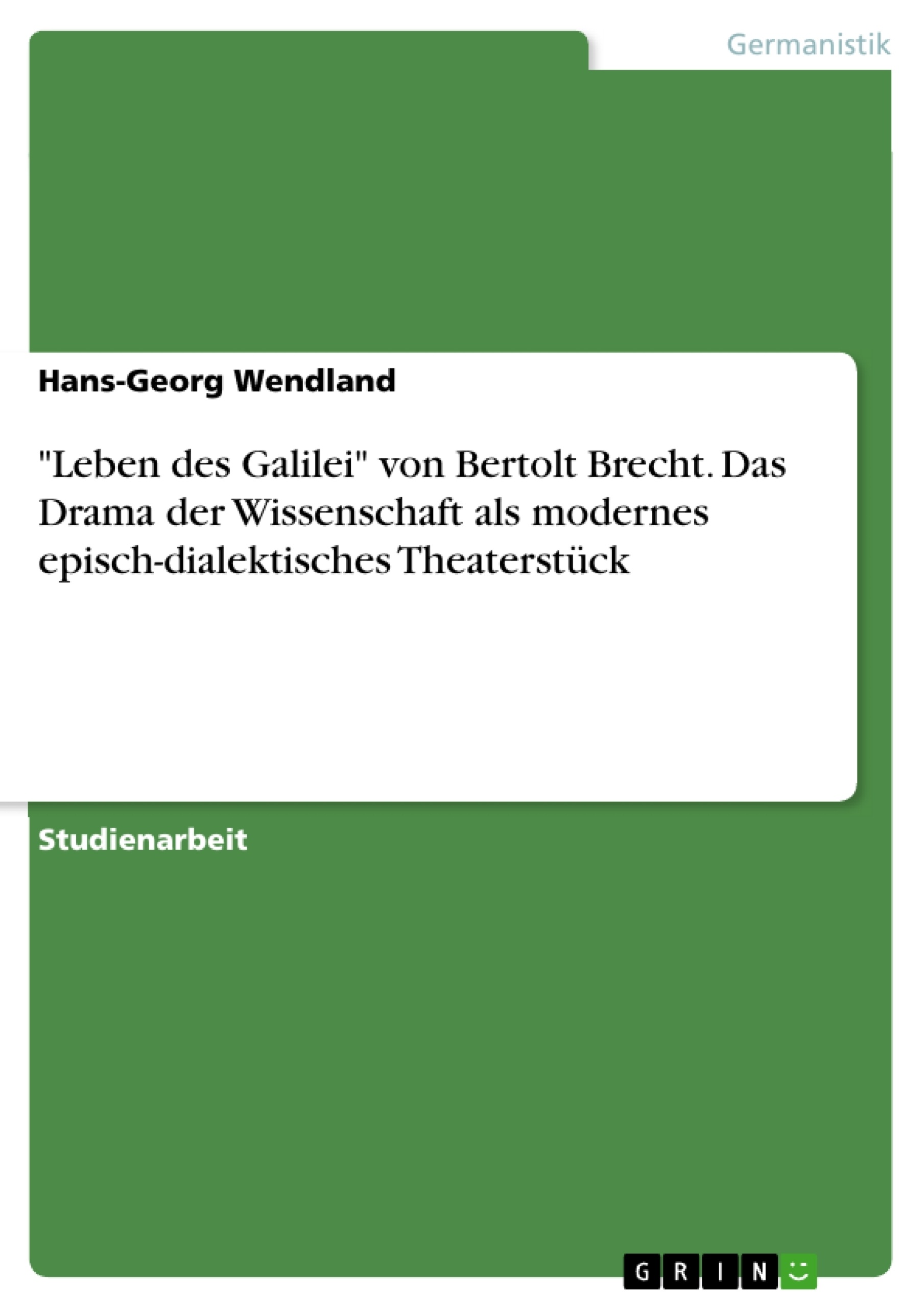"Leben des Galilei" gehört zu den am meisten inszenierten und aufgeführten Dramen Bertolt Brechts. Ein wesentlicher Grund dafür dürfte in der anhaltenden Aktualität der im Stück behandelten Probleme zu finden sein, insbesondere die Verantwortung des Wissenschaftlers gegenüber der menschlichen Gesellschaft. Angesichts der ständig wachsenden Bedrohung durch moderne Massenvernichtungswaffen stellt sich die Frage nach den Grenzen des wissenschaftlichen Fortschritts und der hemmungslosen Weiterverbreitung zerstörerischer Waffensysteme. Aus diesem Blickwinkel heraus könnte man Brechts Drama als Beispieltext einer verhängnisvollen historischen Entwicklung lesen, die im 17. Jahrhundert ihren Anfang nahm und bis heute nichts von ihrer Brisanz verloren hat. Mit einer solchen verengenden Betrachtungsweise würde man jedoch der Bedeutungsvielfalt des Stückes in keiner Weise gerecht werden. Es erscheint sinnvoll, sich zunächst Brechts Auseinandersetzung mit dem Galilei-Stoff zuzuwenden, um auf diesem Hintergrund die Frage aufzuwerfen, wie er die komplexe Thematik des Stückes auf die Bühne bringt.
Für die erste Fassung des Galilei-Dramas, die sogenannte "dänische Fassung", mit dem Titel "Die Erde bewegt sich" (1938/39) spielt die Bedrohung durch den wissenschaftlich-technischen Fortschritt keine entscheidende Rolle. Hier geht es vor allem um das Problem, wie in einer Gesellschaft, deren Verhältnisse vom Machtanspruch staatlicher und kirchlicher Obrigkeiten bestimmt werden, der Wahrheit zum Durchbruch verholfen werden kann. Erst als ihm die Gefahren der Kernspaltung durch die Arbeiten des Physikers Otto Hahn zu Bewusstsein gekommen waren (d. h. nach der Fertigstellung der "dänischen Fassung"), und vor allem nach dem amerikanischen Atombombenabwurf auf die japanischen Städte Hiroshima und Nagasaki am 6. bzw. 9. August 1945, gewannen die Folgeprobleme unbegrenzten wissenschaftlichen Fortschritts für Bertolt Brecht zunehmend an Bedeutung. Dadurch nahm er zum Stoff eine völlig veränderte Einstellung ein.
Gliederung
1. Das dialektische Verhältnis von Geschichte und Gegenwart
2. Das "Theater des wissenschaftlichen Zeitalters"
2.1. Kritik des aristotelischen Einfühlungstheaters
2.2. Konzeption des epischen Theaters
3. "Leben des Galilei": Zur Struktur des Stückes
3.1. Strukturelemente des traditionellen Dramas
3.2. Strukturmerkmale des epischen Verfremdungstheaters
4. "Leben des Galilei" als Drama des episch-dialektischen Theaters
4.1. Zum Begriff "dialektisches Theater"
4.2. Dialektik als Strukturprinzip
4.3. Galilei als dialektische Figur
4.4. Dialektik der Sprach- und Stilebenen
4.5. Dialektik des sozialen "Gestus"
4.6. Dialektik der Motive
Das Motiv der Milch
Das Motiv der Maskierung
Das Motiv des Sehens
5. Zusammenfassende Schlussbemerkung
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in Bertolt Brechts Drama "Leben des Galilei"?
Das Drama behandelt das Leben des Wissenschaftlers Galileo Galilei und thematisiert insbesondere den Konflikt zwischen wissenschaftlicher Erkenntnis und kirchlicher Autorität sowie die soziale Verantwortung des Wissenschaftlers.
Welche Rolle spielt die Verantwortung des Wissenschaftlers im Stück?
Brecht wirft die Frage auf, wie weit wissenschaftlicher Fortschritt gehen darf, wenn er die Gesellschaft gefährdet oder für zerstörerische Zwecke, wie Massenvernichtungswaffen, missbraucht wird.
Was unterscheidet die "dänische Fassung" von späteren Versionen?
In der ersten Fassung von 1938/39 stand der Kampf um die Wahrheit gegen die Obrigkeit im Vordergrund. Erst nach den Atombombenabwürfen 1945 rückten die Gefahren des unbegrenzten Fortschritts ins Zentrum der Überarbeitung.
Was versteht man unter dem "epischen Theater" bei Brecht?
Es ist eine Theaterform, die auf Distanzierung statt Einfühlung setzt. Durch Verfremdungseffekte soll der Zuschauer zum kritischen Nachdenken über gesellschaftliche Zustände angeregt werden.
Welche dialektischen Motive werden im Stück verwendet?
Wichtige Motive sind das Motiv der Milch (Sinnlichkeit vs. Wissenschaft), das Motiv der Maskierung und das Motiv des Sehens (Beweis durch Beobachtung).
- Arbeit zitieren
- Hans-Georg Wendland (Autor:in), 2014, "Leben des Galilei" von Bertolt Brecht. Das Drama der Wissenschaft als modernes episch-dialektisches Theaterstück, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/270734