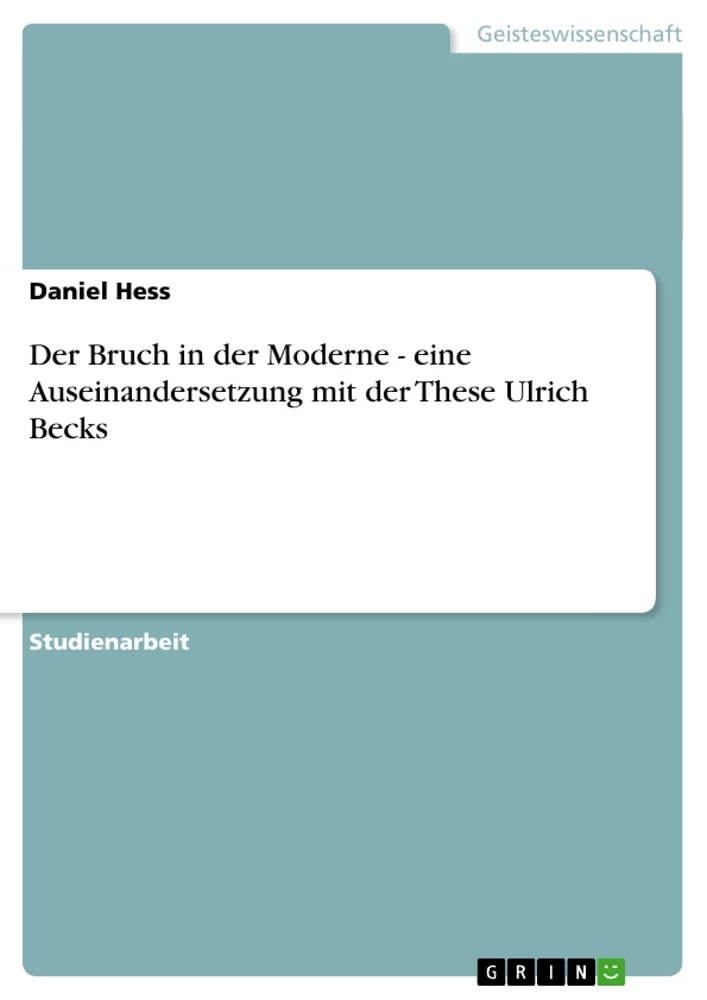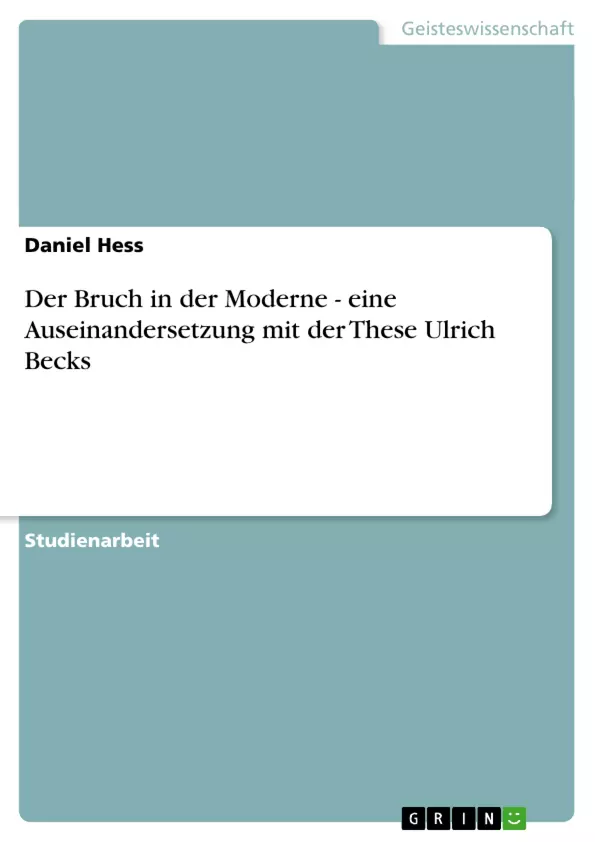Die Soziologie besitzt nicht eine „Zeit- oder Gegenwartsdiagnose“. Das Genre
zeichnet sich vielmehr durch vielfältige Ansätze aus: Gerhard Schulze behauptet
beispielsweise, wir lebten in einer Erlebnisgesellschaft, Richard Münch in der
Kommunikationsgesellschaft und Ulrich Beck in der Risikogesellschaft (Beck
1986). Ist dies ein Makel der Zeitdiagnosen, und zeugt das von einer Unreife des
Fachs Soziologie?
„Vielleicht ist die Perspektivenvielfalt ja auch die einzig adäquate Reaktion auf die immense
Komplexität sozialer Wirklichkeit, die sich analytisch einfach nicht in eine einzige Sicht der Dinge
hineinpressen lässt (Schimank 2000: 14).“
Schimank ist der Meinung, dass das Problem nicht aus dem Fach, sondern aus
dem Gegenstand des Faches entstehe: Die soziale Wirklichkeit sei so komplex!
Ziel könne es nicht sein, die Komplexität wiederzuspiegeln, in diesem Fall hätte
man keinen Erkenntnisgewinn. Vielmehr müsse stark vereinseitigt werden und
„aus Heterogenem ein Muster (Münch 2002:19)“ gemacht werden.
„Die Gegenwartsdiagnosen leisten einen wichtigen Beitrag zur „soziologischen Aufklärung“ der
Gesellschaft über sich selbst (Schimank 2000: 17).“
Die Funktion der Gegenwartsdiagnose sei also nicht das Finden der Wahrheit,
sondern die Selbstbeobachtung, indem sie auf drohende Krisen aufmerksam
mache. Dies leistet auch Becks Risikogesellschaft. Aus heterogenen
Einzelereignissen wie Waldsterben, Schadstoffe in Nahrungsmitteln,
Radioaktivität, Individualisierung und Arbeitslosigkeit hat er seiner Meinung nach
ein Muster herausgefiltert: Risiken. Damit vereinseitigt er, macht aber auch auf
eine drohende Krisen aufmerksam. Dennoch stellt sich die Frage, ob er nicht
durch den Untertitel „Auf dem Weg in eine andere Moderne“ über das Genre der
Zeitdiagnosen hinausgeht.
„Soziologische Gegenwartsdiagnosen sind also analytisch abstrakter als Untersuchungen
einzelner Gesellschaften, aber konkreter als generelle Gesellschaftstheorien (Schimank 2000: 16).“
Als Gegenpol zur Risikogesellschaft dient Beck die klassische
Industriegesellschaft. Zwischen Industriegesellschaft und Risikogesellschaft will er
einen ausreichenden Unterschied festgestellt haben, der einen Bruch zwischen
Beiden rechtfertigen würde. Weil die Moderne nicht einheitlich nach einer
Grundidee verlaufe, zieht dies die Einführung der Begrifflichkeit der zweiten
Moderne nach sich. [...]
Inhaltsverzeichnis
- Unterschiedliche Zeitdiagnosen
- Modernisierungsvorstellungen Becks
- Restrukturierung ökologischer Risikoproduktion
- Restrukturierung der Lebensführung
- Restrukturierung von Wissenschaft und Politik
- Die Risikogesellschaft als Zeitdiagnose
- Das Muster in den ökologischen Risiken
- Kollektiv verteilte Risiken
- Risikowahrnehmung und -wirklichkeit
- Entscheidungsabhängigkeit von Risiken
- Das Muster in der Lebensführung
- Die Frage der Mediengesellschaft
- Das Muster in den ökologischen Risiken
- Rechtfertigung des Epochenwandels
- Risiken der Industrie- und der Risikogesellschaft
- verschiedene Analyseperspektiven
- zur Einheit der Industriegesellschaft
- der Institutionenwandel
- kein Bruch trotz berechtigter Zeitdiagnose
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit setzt sich kritisch mit der These Ulrich Becks auseinander, dass die Moderne einen Bruch erfahren hat und eine „zweite Moderne“ – die Risikogesellschaft – entstanden ist. Das Ziel ist es, zu analysieren, ob die Veränderungen der Moderne so tiefgreifend sind, dass sie die Proklamation einer neuen Epoche rechtfertigen.
- Die Vielfalt der Zeitdiagnosen in der Soziologie
- Becks Analyse der Risikogesellschaft und ihre zentralen Merkmale
- Die Restrukturierung der ökologischen Risikoproduktion, der Lebensführung und von Wissenschaft und Politik
- Die Unterschiede zwischen der Industriegesellschaft und der Risikogesellschaft
- Die Rechtfertigung des Epochenwandels durch die Analyse der Risiken und des Wandels von Institutionen
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel 1: Die Arbeit stellt verschiedene Zeitdiagnosen in der Soziologie vor, darunter die Erlebnisgesellschaft, die Kommunikationsgesellschaft und die Risikogesellschaft. Es wird diskutiert, ob die Perspektivenvielfalt ein Makel der Soziologie oder eine angemessene Reaktion auf die Komplexität der sozialen Wirklichkeit ist.
- Kapitel 2: Becks These zur Restrukturierung der Moderne wird beleuchtet, indem die drei zentralen Bereiche der ökologischen Risikoproduktion, der Lebensführung und der Institutionen betrachtet werden. Die Arbeit argumentiert, dass Beck die „einfache Modernisierung“ der Industriegesellschaft von der „reflexiven Modernisierung“ der Risikogesellschaft abgrenzt.
- Kapitel 3: Die Arbeit analysiert die Merkmale der Risikogesellschaft, insbesondere die Eigenschaften der ökologischen Risiken. Es wird untersucht, wie die Risikowahrnehmung und -wirklichkeit die Gesellschaft beeinflussen und wie Entscheidungen in Bezug auf Risiken getroffen werden.
- Kapitel 4: Die Arbeit stellt die Risiken der Industriegesellschaft und der Risikogesellschaft gegenüber und diskutiert verschiedene Analyseperspektiven. Es wird die Frage erörtert, ob die Unterschiede zwischen den beiden Gesellschaftsformen einen epochalen Wandel begründen.
Schlüsselwörter
Die Arbeit konzentriert sich auf die Schlüsselbegriffe der Zeitdiagnose, Risikogesellschaft, moderne, Industriegesellschaft, reflexive Modernisierung, ökologische Risikoproduktion, Lebensführung und Institutionenwandel. Diese Begriffe und Konzepte bilden den Rahmen für die kritische Auseinandersetzung mit Becks These und die Analyse der Veränderungen der Moderne.
Was ist die zentrale These von Ulrich Becks "Risikogesellschaft"?
Beck behauptet, dass wir uns in einem Übergang von der Industriegesellschaft zu einer "zweiten Moderne" befinden, in der die Produktion von Risiken (ökologisch, sozial) die Produktion von Reichtum überlagert.
Was versteht man unter "reflexiver Modernisierung"?
Reflexive Modernisierung bedeutet, dass die Grundlagen der Industriegesellschaft durch ihre eigenen Erfolge und Nebenwirkungen (wie Umweltzerstörung) untergraben und verändert werden.
Welche Merkmale haben ökologische Risiken laut Beck?
Diese Risiken sind oft kollektiv verteilt, global grenzüberschreitend, häufig unsichtbar und hängen direkt von menschlichen Entscheidungen ab.
Gibt es wirklich einen Epochenbruch in der Moderne?
Die Arbeit setzt sich kritisch damit auseinander, ob die Veränderungen tiefgreifend genug sind, um von einer völlig neuen Epoche zu sprechen, oder ob es sich um eine Fortentwicklung handelt.
Wie verändert die Risikogesellschaft die Lebensführung?
Traditionelle Bindungen (Klasse, Familie) lösen sich auf, was zu einer Individualisierung führt, bei der das Individuum seine Biographie selbst planen und verantworten muss.