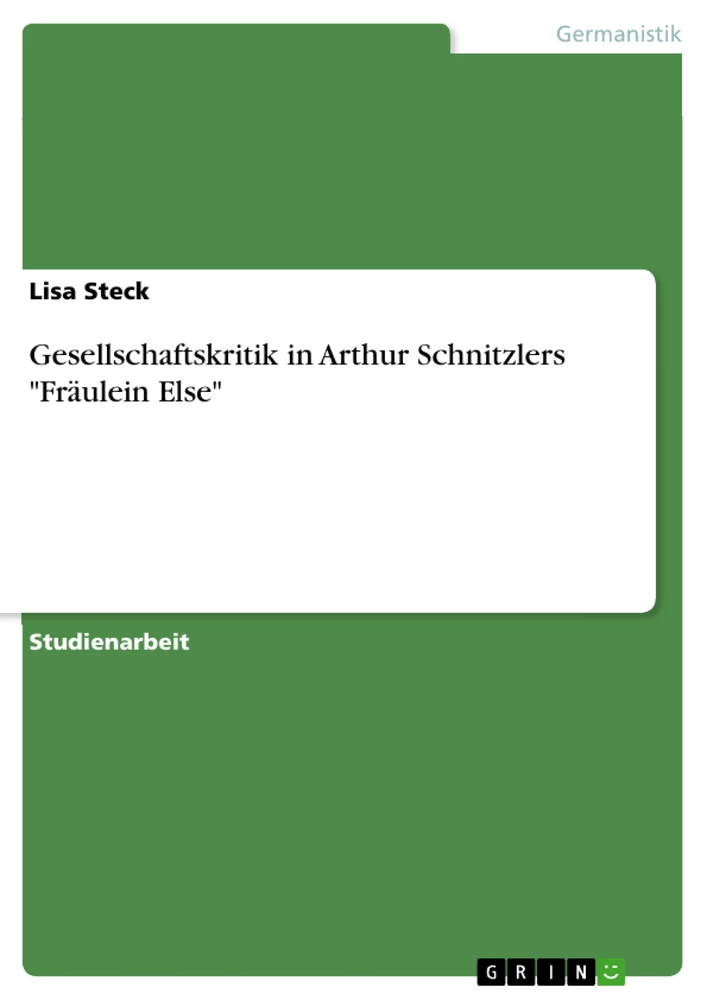Die vorliegende Arbeit untersucht die Aspekte der Gesellschaftskritik in Arthur Schnitzlers Novelle "Fräulein Else" aus dem Jahr 1924.
Else ist als Spross einer Aristokratenfamilie, die vor der Verarmung und dem Verlust des sozialen Status steht, hin- und hergerissen zwischen dem Wunsch nach Individualität und Abspaltung der Familie und dem Verantwortungsgefühl, dieser zu helfen. Durch ihre hervorstechend schöne äußere Erscheinung ist sie die einzige Hoffnung, um den Vater wegen veruntreuter Mündelgelder vor dem Gefängnis zu bewahren. Ihre Schönheit soll sie dazu nutze, dem Lüstling Dorsday die erforderliche Summe zu entlocken.
Trotz der Form der Novelle als innerer Monolog lässt sich eine Übersicht über einen kleinen Ausschnitt der Wiener Gesellschaft zur Zwischenkriegszeit, zumindest in den oberen Schichten, in denen sich Else bewegt, zeichnen.
Im Zuge dessen wird zuerst ein kurzer Überblick über die temporären Zustände in Wien gegeben, um die gesonderte Stellung der Aristokratie besser zu verstehen. Die Spaltung zwischen dem, was sich an der ‚gebügelten‘ Oberfläche der höheren Schichten der Gesellschaft zeigt und den unausgesprochenen Wirrungen, die der Künstlichkeit dieses Scheins zugrunde liegen sind ein signifikanter Punkt dieser Arbeit, der weiter untersucht wird.
Außerdem wird die Rolle des schönen Fräuleins in einer Zeit, in der Status über Moral geht und Geldnot den Ruin bedeuten kann, betrachtet.
Zuletzt wird noch kurz die Bedeutung des jüdischen Aspekts der Novelle eingegangen, welchen ich im Anbetracht sowohl der Zeit als auch des jüdischen Hintergrunds des Autors nicht komplett außer Acht lassen möchte.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Wiener Gesellschaft zur Zwischenkriegszeit
- Fräulein Else - gesellschaftskritische Aspekte
- Die Oberschicht
- Das Fräulein aus gutem Hause als weibliches Objekt
- Aspekte von Antisemitismus
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Gesellschaftskritik in Arthur Schnitzlers Novelle „Fräulein Else“. Der Fokus liegt auf der Darstellung der Wiener Gesellschaft der Zwischenkriegszeit, insbesondere der Oberschicht, und der Rolle der Frau in dieser Gesellschaft. Die Arbeit analysiert, wie soziale Normen und ökonomische Notlage das Leben der Protagonistin prägen.
- Die Wiener Gesellschaft im Kontext der Zwischenkriegszeit
- Die Darstellung der Oberschicht und ihre Strategien zur Aufrechterhaltung des Status quo
- Die Rolle der Frau und die gesellschaftlichen Erwartungen an sie
- Die Thematik des Scheins und Seins in der Wiener Gesellschaft
- Aspekte von Antisemitismus im Kontext der Novelle
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema der Arbeit ein und beschreibt die Absicht, die Aspekte der Gesellschaftskritik in Arthur Schnitzlers Novelle „Fräulein Else“ zu untersuchen. Sie skizziert den Fokus auf die soziale Lage Elses als Mitglied einer verarmenden Aristokratenfamilie, ihren Konflikt zwischen persönlicher Freiheit und familiärer Verantwortung, und die Rolle ihrer Schönheit als Mittel zum Zweck der Rettung des Vaters vor dem Gefängnis. Die Einleitung deutet die Untersuchung der Wiener Gesellschaft, der Rolle des Fräuleins und des antisemitischen Aspekts der Novelle an.
Die Wiener Gesellschaft zur Zwischenkriegszeit: Dieses Kapitel zeichnet ein Bild des Wiener gesellschaftlichen Lebens in der Zwischenkriegszeit. Es beschreibt die Armut und Not, besonders unter den Armen, im Gegensatz zum Rückzug der Reichen. Die zunehmende Bedeutung der weiblichen Rolle in einer Zeit der wirtschaftlichen Not und der veränderten Familienstrukturen, sowie die Entwicklung von Frauenrechtsbewegungen werden beleuchtet. Das Kapitel zeigt eine Gesellschaft geprägt von Gleichgültigkeit und Egoismus, im Kontrast zu dem Schein von Wohlstand und Ordnung, der in der Oberschicht aufrechterhalten wird. Es legt den Grundstein für das Verständnis des Konflikts zwischen Sein und Schein, welcher die Protagonistin in der Novelle prägt.
Fräulein Else - gesellschaftskritische Aspekte: Dieses Kapitel analysiert die gesellschaftskritischen Aspekte der Novelle, beginnend mit der Darstellung der Wiener Oberschicht. Es wird gezeigt, wie die Oberschicht die drohende Verarmung und die gesellschaftlichen Probleme verdrängt und an die nächste Generation weitergibt, wie es in Elses Familie exemplifiziert wird. Die Aufrechterhaltung des Scheins und der sozialen Repräsentation wird detailliert untersucht, inklusive der Verwendung von französischen Wörtern und dem Verbergen der finanziellen Notlage. Das Kapitel beleuchtet die Rolle Elses als weibliches Objekt, das instrumentalisiert wird, um die finanziellen Probleme der Familie zu lösen, und untersucht den gesellschaftlichen Druck und die mangelnde Unterstützung seitens ihrer Familie. Der Antisemitismus in der Novelle wird ebenfalls kurz angesprochen und in den Kontext der Zeit und des Hintergrunds des Autors gestellt.
Schlüsselwörter
Arthur Schnitzler, Fräulein Else, Gesellschaftskritik, Wiener Gesellschaft, Zwischenkriegszeit, Oberschicht, Armut, Schein und Sein, Weibliche Rolle, Antisemitismus, Moral, Status, Familie.
Häufig gestellte Fragen zu "Fräulein Else" - Gesellschaftskritik in Arthur Schnitzlers Novelle
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert die Gesellschaftskritik in Arthur Schnitzlers Novelle „Fräulein Else“. Der Fokus liegt auf der Darstellung der Wiener Gesellschaft der Zwischenkriegszeit, insbesondere der Oberschicht, und der Rolle der Frau in dieser Gesellschaft. Die Arbeit untersucht, wie soziale Normen und ökonomische Notlage das Leben der Protagonistin prägen.
Welche Themen werden im Einzelnen behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themen: Die Wiener Gesellschaft im Kontext der Zwischenkriegszeit; die Darstellung der Oberschicht und ihre Strategien zur Aufrechterhaltung des Status quo; die Rolle der Frau und die gesellschaftlichen Erwartungen an sie; die Thematik des Scheins und Seins in der Wiener Gesellschaft; Aspekte von Antisemitismus im Kontext der Novelle.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit besteht aus einer Einleitung, einem Kapitel über die Wiener Gesellschaft der Zwischenkriegszeit, einem Kapitel zur Gesellschaftskritik in "Fräulein Else" und einem Fazit. Zusätzlich werden Zielsetzung und Themenschwerpunkte, Kapitelzusammenfassungen und Schlüsselwörter aufgeführt.
Was wird in der Einleitung beschrieben?
Die Einleitung führt in das Thema ein und beschreibt die Absicht, die Aspekte der Gesellschaftskritik in Schnitzlers Novelle zu untersuchen. Sie skizziert den Fokus auf Elses soziale Lage, ihren Konflikt zwischen persönlicher Freiheit und familiärer Verantwortung und die Rolle ihrer Schönheit als Mittel zum Zweck der Rettung ihres Vaters.
Worauf konzentriert sich das Kapitel über die Wiener Gesellschaft der Zwischenkriegszeit?
Dieses Kapitel zeichnet ein Bild des Wiener gesellschaftlichen Lebens in der Zwischenkriegszeit. Es beschreibt die Armut und Not im Gegensatz zum Rückzug der Reichen, die zunehmende Bedeutung der weiblichen Rolle und die Entwicklung von Frauenrechtsbewegungen. Es zeigt eine Gesellschaft geprägt von Gleichgültigkeit und Egoismus im Kontrast zum Schein von Wohlstand und Ordnung in der Oberschicht.
Was wird im Kapitel über "Fräulein Else" - gesellschaftskritische Aspekte - analysiert?
Dieses Kapitel analysiert die Darstellung der Wiener Oberschicht, wie sie die drohende Verarmung verdrängt. Es untersucht die Aufrechterhaltung des Scheins und der sozialen Repräsentation, Elses Rolle als weibliches Objekt, den gesellschaftlichen Druck auf sie und den Antisemitismus in der Novelle.
Welche Schlüsselwörter sind relevant für die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Arthur Schnitzler, Fräulein Else, Gesellschaftskritik, Wiener Gesellschaft, Zwischenkriegszeit, Oberschicht, Armut, Schein und Sein, Weibliche Rolle, Antisemitismus, Moral, Status, Familie.
Welche Aspekte der Rolle der Frau werden behandelt?
Die Arbeit untersucht die Rolle der Frau in der Wiener Gesellschaft der Zwischenkriegszeit, die gesellschaftlichen Erwartungen an Frauen, den Druck auf Frauen wie Fräulein Else, und den Konflikt zwischen persönlicher Freiheit und familiärer Verantwortung.
Wie wird der Antisemitismus in der Novelle behandelt?
Der Antisemitismus in der Novelle wird im Kontext der Zeit und des Hintergrunds des Autors kurz angesprochen und analysiert.
Für wen ist diese Arbeit gedacht?
Diese Arbeit ist für akademische Zwecke gedacht und dient der Analyse von Themen in einer strukturierten und professionellen Art und Weise.
- Citar trabajo
- Lisa Steck (Autor), 2013, Gesellschaftskritik in Arthur Schnitzlers "Fräulein Else", Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/271176