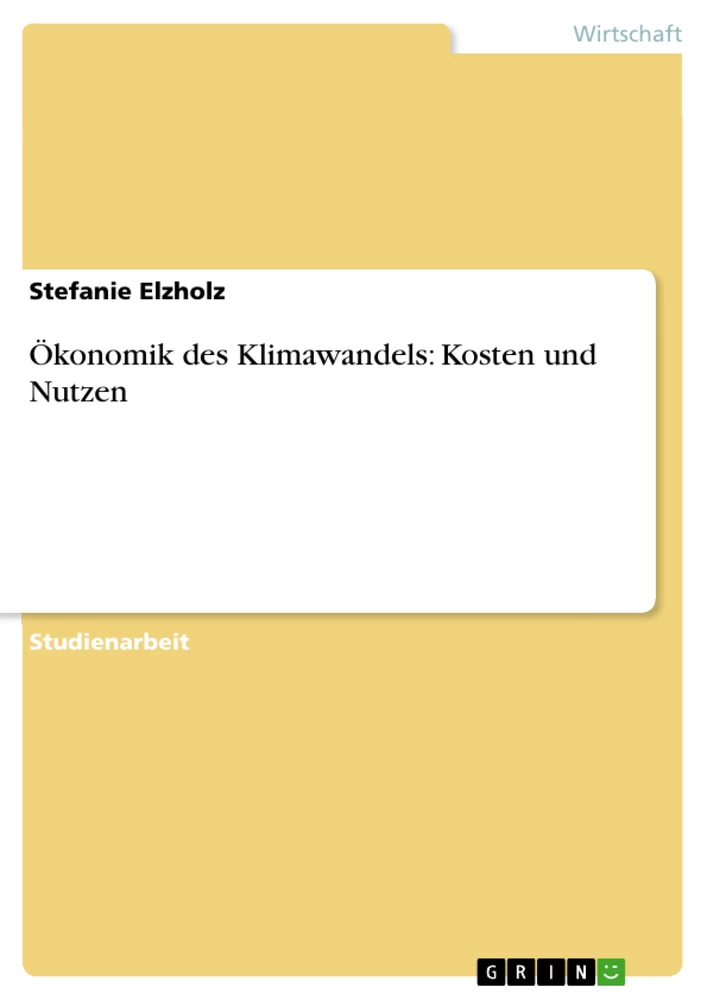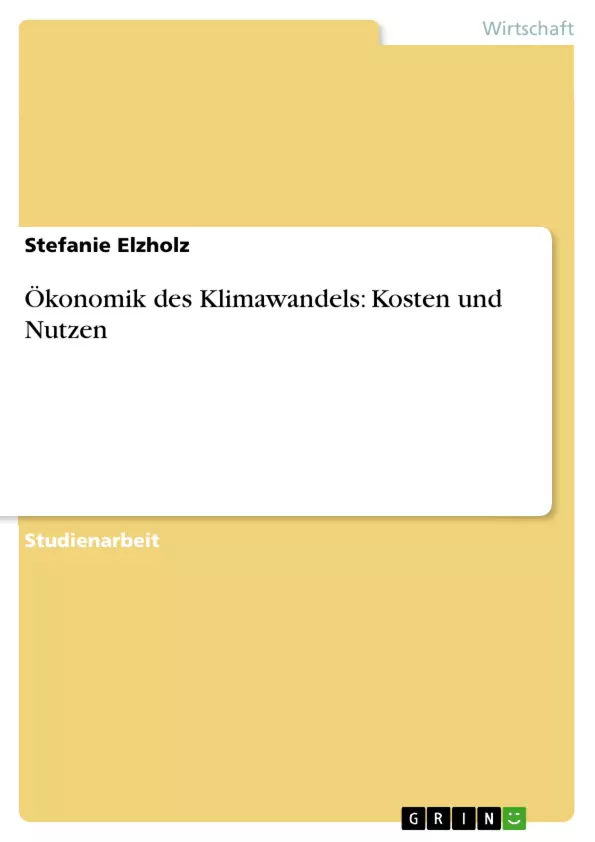Der fortschreitende anthropogene Klimawandel und dessen Folgen für die Natur und die menschliche Gesellschaft stellen politische Entscheidungsträger weltweit vor neue Herausforderungen. Die zentrale Aufgabe besteht dabei insbesondere darin, das Ausmaß von Klimaschäden zu minimieren und eine Klimakatastrophe abzuwenden, wobei die Wohlfahrtsverluste möglichst gering zu halten sind.
Während der wissenschaftliche Kenntnisstand über Ursachen und Situation der globalen Erderwärmung weitgehend Konsens gefunden hat, gestaltet sich die Debatte um das Ausmaß des Klimawandels und seiner Schäden als auch um geeignete Klimaschutzmaßnahmen als äußerst kontrovers. Ein wesentlicher Kern der klimapolitischen Diskussionen stellt der Kosten-Nutzen-Aspekt von Anpassungs- und Vermeidungsstrategien dar, ob und in welchem Maße sie Erfolg versprechend sind und welches Verhältnis von Anpassung und Vermeidung sich als optimal darstellt. Die Klimafolgenforschung liefert hierzu unterschiedliche Szenarioanalysen, welche zur Grundlage klimapolitischer Entscheidungen gemacht werden, aufgrund verschiedener Annahmen und Datenbasen jedoch häufig zu einem differenzierten Meinungsbild über die „richtige“ Klimaschutzstrategie führen.
Die vorliegende Arbeit untersucht die Problematik der Ökonomik des Klimawandels unter dem Kosten-Nutzen-Aspekt. Die Grundfrage des Klimaschutzes, welche im Wesentlichen in der Entscheidung für Anpassungs- oder Vermeidungsstrategien besteht, wird im zweiten Teil vorgestellt. Im Anschluss soll mittels Kosten-Nutzen-Analyse ein Antwortversuch auf diese Frage geliefert werden, wobei unterschiedliche Lösungsansätze renommierter Klimaökonomen gegenübergestellt werden. Im vierten Teil wird daraufhin die politische Dimension der Ökonomik des Klimawandels im Hinblick auf praktische Umsetzungsmaßnahmen beleuchtet. Eine Zusammenfassung der gewonnenen Erkenntnisse erfolgt in einer abschließenden Betrachtung.
Inhaltsverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis
1 Einleitung
2 Grundfrage des Klimaschutzes: Anpassen oder Vermeiden?
3 Ein Antwortversuch: Kosten-Nutzen-Analyse
4 Umweltpolitische Dimension der Ökonomik des Klimawandels
5 Zusammenfassung
Quellenverzeichnis
- Quote paper
- Stefanie Elzholz (Author), 2011, Ökonomik des Klimawandels: Kosten und Nutzen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/271436