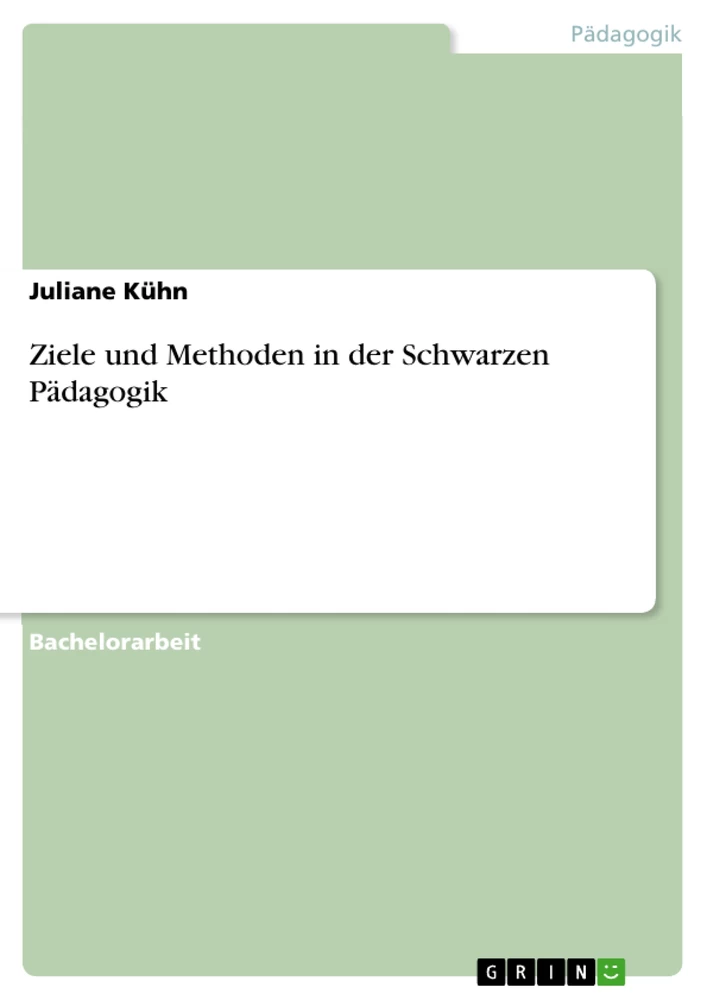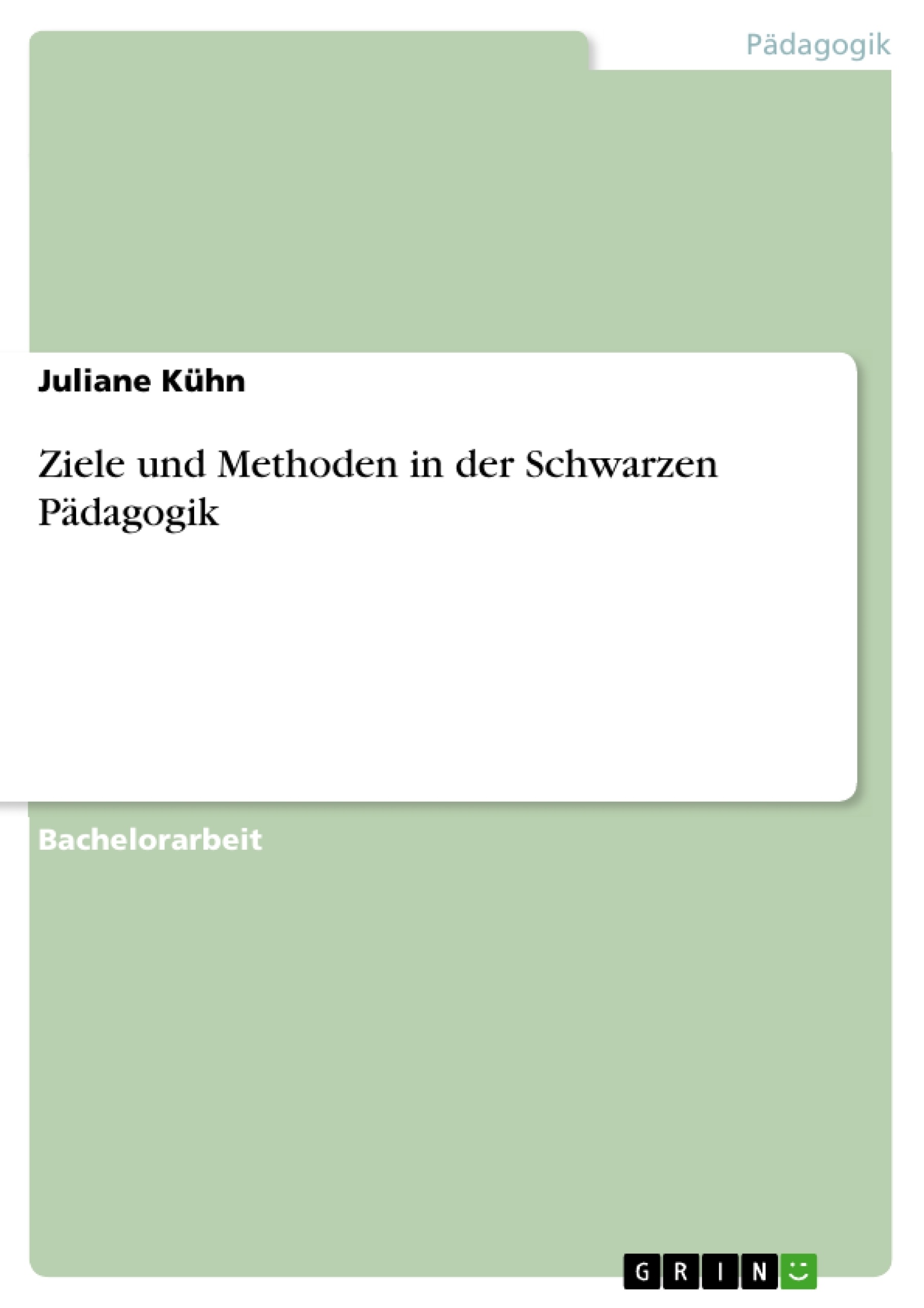„Wer einmal lügt, dem glaubt man nicht, und wenn er auch die Wahrheit spricht“.
„Wer nicht hören will, muss fühlen.“
Jedes Kind in unserer westlichen Gesellschaft ist mit solchen, oder ähnlichen Weisheiten aufgewachsen. Sie vermitteln ein Misstrauen gegenüber dem Kind und die Tatsache, dass jede Handlung auch Konsequenzen haben muss. Den meisten wird nicht bewusst sein, dass solche Aussagen starke Auswirkungen auf die emotionale Sicherheit des Kindes haben können und die Wurzeln der Sprüche in der Schwarzen Pädagogik liegen.
In dieser Arbeit wird die sogenannte Schwarze Pädagogik aus einer historischen Perspektive thematisiert. Dabei liegt der Fokus besonders auf den Zielen der Schwarzen Pädagogik und den Methoden, die verwendet wurden, um diese Ziele zu erreichen. Das erkenntnisleitende Interesse beinhaltet ebenfalls die Frage nach dem Begriff der Schwarzen Pädagogik. Inwiefern ist er angemessen und aktuell? Kann der Begriff verwendet werden, wenn über historische Begebenheiten und Erziehungsideale gesprochen wird? Dem erkenntnisleitenden Interesse wird nachgegangen durch die intensive Diskussion der Quellentexte und der Frage nach Aktualität des Themas.
Die Betrachtung der Thematik ist dabei auf das 16./17. Jahrhundert bis circa 1950 in Deutschland begrenzt. Der Fokus liegt auf dem 18. und 19. Jahrhundert und dabei vor allem auf der Zeit der Aufklärung. Aus diesem Grund wurden auch vorrangig Quellentexte aus dieser Zeit bearbeitet. Die Themen Heimerziehung und Missbrauch von Kindern wurden hingegen außen vor gelassen, da sie über die Thematik hinausgehen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Definitorische Annäherungen an den Begriff der Schwarzen Pädagogik
- Definitorische Annäherung nach Katharina Rutschky
- Definitorische Annährung nach Alice Miller
- Weitere definitorische Annäherungen
- Eigene Definition
- Historische Entwicklung der Schwarzen Pädagogik
- Entwicklung
- Vertreter der Schwarzen Pädagogik
- Dr. Daniel Gottlob Moritz Schreber
- Johanna Haarer
- Grundlagen der Schwarzen Pädagogik
- Menschenbild
- Das Bild vom Erwachsenen
- Das Bild vom Kind
- Das Bild vom Erzieher
- Zusammenfassung und Fazit
- Ziele der Schwarzen Pädagogik
- Die Unterordnung unter den Erwachsenen
- Die Erziehung zu bürgerlichen Tugenden
- Ordnung
- Dankbarkeit
- Ehrlichkeit
- Gehorsam
- Fleiß
- Bescheidenheit
- Keuschheit
- Die Konditionierung zum Nicht-merken der Kinder
- Zusammenfassung und Fazit
- Methoden in der Schwarzen Pädagogik
- Körperliche Gewalt
- Abschreckung und Ängstigung
- Lügen
- Strafe und Belohnung
- Verweigerung von Grundbedürfnissen und Abhärtung
- Liebesentzug
- Manipulation
- Kontrolle und Machtausübung
- Demütigung
- Zusammenfassung und Fazit
- Folgen der Schwarzen Pädagogik
- Alternativen zur Schwarzen Pädagogik
- „Weiße Pädagogik"
- Antipädagogik
- Reformpädagogik
- Fazit und Ausblick
- Zusammenfassung der Arbeit
- Schwarze Pädagogik aus Sicht der Gegenwart
- Fazit
- Ausblick
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der Schwarzen Pädagogik, einer Form der Erziehung, die in der Vergangenheit weit verbreitet war und auch heute noch in Teilen des Erziehungsverhaltens von Eltern und Pädagogen zu finden ist. Die Arbeit untersucht die historische Entwicklung, die Ziele und Methoden der Schwarzen Pädagogik und analysiert ihre Auswirkungen auf die Entwicklung von Kindern.
- Die Unterwerfung des Kindes unter den Erwachsenen
- Die Erziehung zu den bürgerlichen Tugenden
- Die Konditionierung zum Nicht-merken der Kinder
- Die Folgen der Schwarzen Pädagogik
- Alternativen zur Schwarzen Pädagogik
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer definitorischen Annäherung an den Begriff der Schwarzen Pädagogik, wobei die Definitionen von Katharina Rutschky und Alice Miller im Vordergrund stehen. Anschließend wird die historische Entwicklung der Schwarzen Pädagogik beleuchtet, wobei die Theorien von Philippe Aries und Lloyd deMause zur Geschichte der Kindheit eine wichtige Rolle spielen. Es werden exemplarisch zwei Pädagogen vorgestellt, die als Vertreter der Schwarzen Pädagogik gelten: Dr. Daniel Gottlob Moritz Schreber und Johanna Haarer. Des Weiteren werden die Grundlagen der Schwarzen Pädagogik, wie die Auslegung der Bibel und das elterliche Züchtigungsgesetz, erläutert.
Im folgenden Kapitel wird das Menschenbild der Schwarzen Pädagogik beschrieben, das von einer klaren Hierarchie zwischen Erwachsenen und Kindern geprägt ist. Die Erwachsenen werden als weise und allmächtig dargestellt, während die Kinder als unvollkommene und schwache Wesen gesehen werden. Die Erziehung wird als ein Prozess der Formung des Kindes nach den Vorstellungen der Erwachsenen verstanden. Die Arbeit beleuchtet anschließend die Ziele der Schwarzen Pädagogik, die sich in der Unterwerfung des Kindes unter den Erwachsenen und der Erziehung zu bürgerlichen Tugenden wie Ordnung, Dankbarkeit, Ehrlichkeit, Gehorsam, Fleiß, Bescheidenheit und Keuschheit manifestieren. Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die Konditionierung zum Nicht-merken der Kinder, die dazu dienen soll, die Grausamkeiten der Erziehung zu verschleiern.
Das Kapitel über die Methoden in der Schwarzen Pädagogik beschreibt verschiedene Vorgehensweisen, die zur Erreichung der Erziehungsziele eingesetzt wurden. Hierzu zählen Körperliche Gewalt, Abschreckung und Ängstigung, Lügen, Strafe und Belohnung, Verweigerung von Grundbedürfnissen und Abhärtung, Liebesentzug, Manipulation, Kontrolle und Machtausübung sowie Demütigung. Die Arbeit zeigt auf, dass diese Methoden zu nachhaltigen Folgen für die Entwicklung von Kindern führen können.
In einem weiteren Kapitel werden mögliche Alternativen zur Schwarzen Pädagogik, wie die „Weiße Pädagogik", die Antipädagogik und die Reformpädagogik, vorgestellt. Die Arbeit beleuchtet die kritischen Punkte dieser Konzepte und untersucht, inwiefern sie als Ausweg aus der Schwarzen Pädagogik dienen können.
Im Fazit wird die Arbeit zusammengefasst und die Frage nach der Aktualität des Begriffs der Schwarzen Pädagogik in der Gegenwart gestellt. Es werden die Veränderungen im Erziehungsverständnis in den letzten Jahren diskutiert und die Folgen der Schwarzen Pädagogik für die Gesellschaft beleuchtet. Die Arbeit endet mit einem Ausblick auf mögliche Themen für weitere Forschungsarbeiten.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen die Schwarze Pädagogik, die Geschichte der Kindheit, die Erziehung zu bürgerlichen Tugenden, die Unterwerfung des Kindes unter den Erwachsenen, die Konditionierung zum Nicht-merken der Kinder, die Folgen der Schwarzen Pädagogik und die Alternativen zur Schwarzen Pädagogik. Die Arbeit beleuchtet die historische Entwicklung der Schwarzen Pädagogik, analysiert ihre Ziele und Methoden und untersucht ihre Auswirkungen auf die Entwicklung von Kindern. Dabei werden die Theorien von Katharina Rutschky und Alice Miller zur Schwarzen Pädagogik sowie die Erkenntnisse aus der Entwicklungspsychologie und der Sozialisationstheorie herangezogen.
- Quote paper
- Juliane Kühn (Author), 2012, Ziele und Methoden in der Schwarzen Pädagogik, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/271672