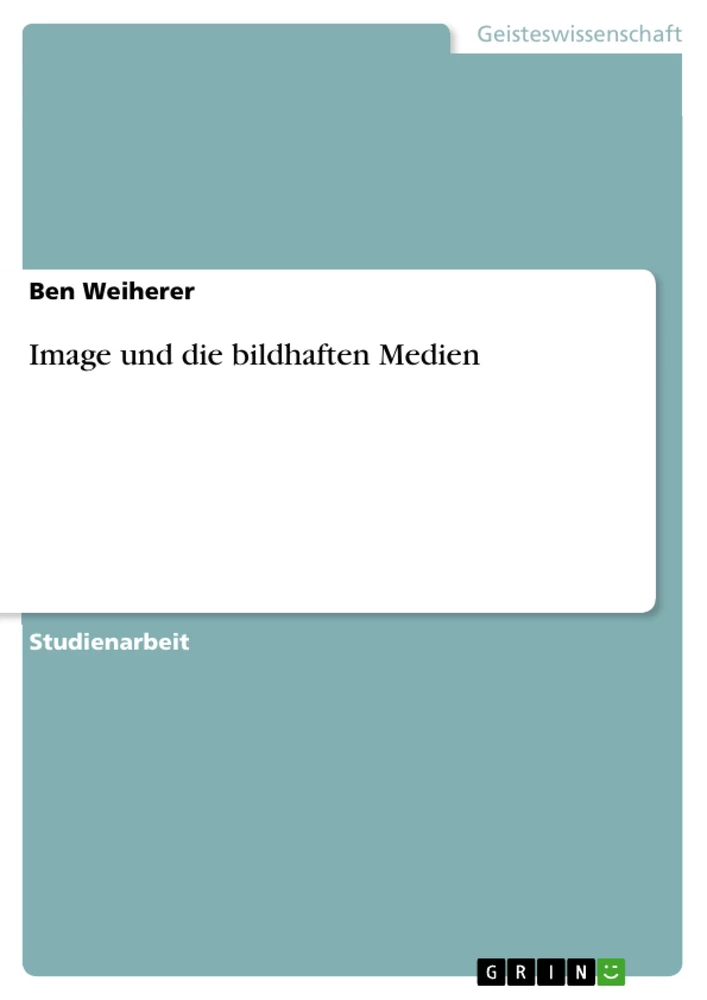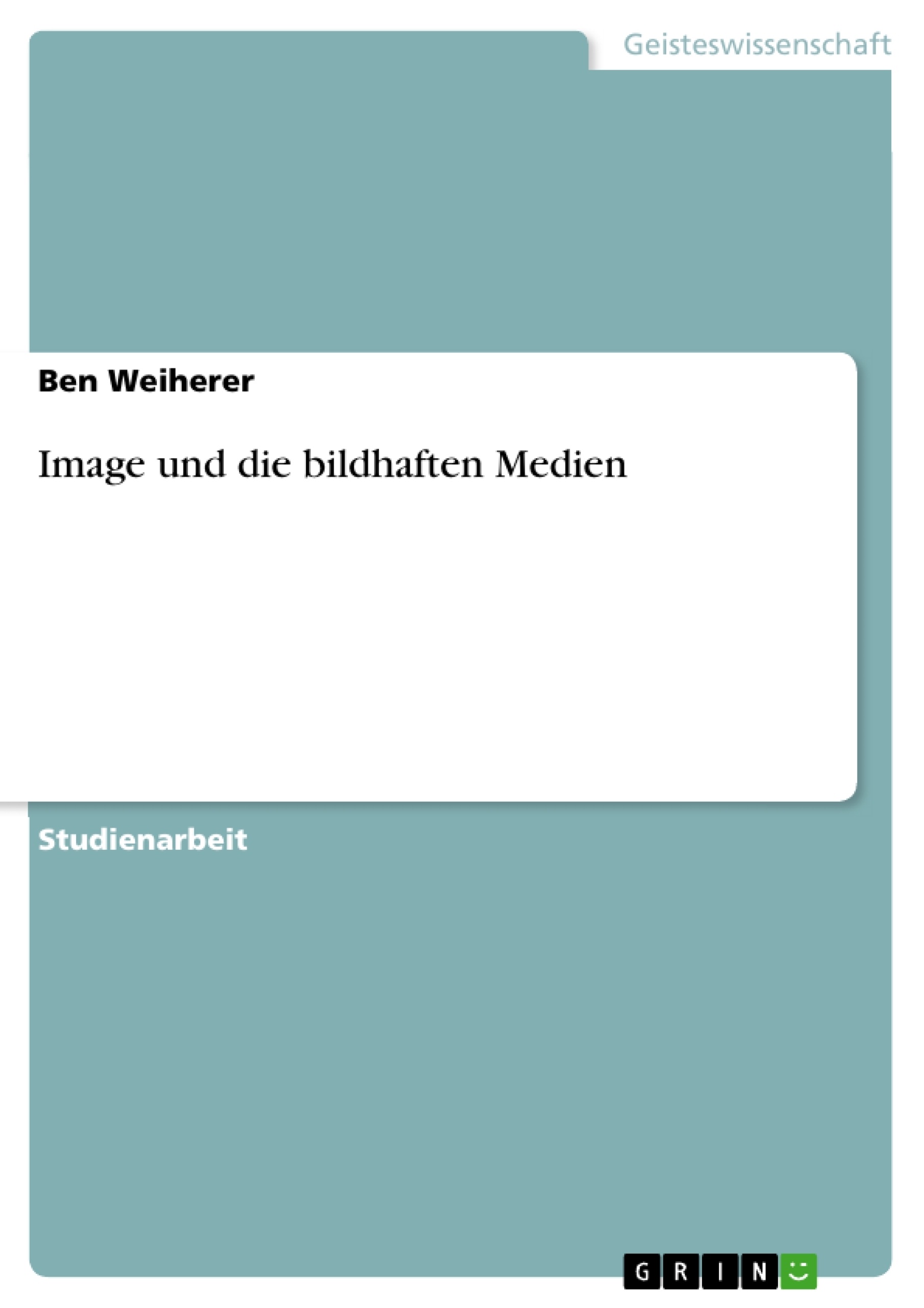Das Wort Image stammt von dem lateinischen Wort „Imago“ ab. Imago bedeutet übersetzt Bild oder Bilder. Das Wort Image lässt sich zum einen auf Personen übertragen, kann sich aber auch auf ganze Gruppen beziehen. Jede Person liefert Bilder, durch sein Verhalten oder sprachlichen Ausdruck. Kleidung kann beispielsweise auch dazu betragen. Jede Form von verbaler und non-verbaler Kommunikation trägt dazu bei, Bilder zu schaffen. Im Vordergrund dabei steht immer die Aufgabe des Image, wie bin ich und wie sollen mich andere sehen. Diese Aufgabe ist keinesfalls als ein einmalige Akt zu verstehen. Menschen ändern sich, beispielsweise auf Grund von Erfahrungen oder generell durch Erlebtes. Dadurch kann sich auch das “Image“, oder besser gesagt die “Images“, verändern. Durch die Betrachtung anderer, wird dem Individuum klarer, wie will ich wahrgenommen werden beziehungsweise wie möchte ich nicht von meiner Umwelt wahrgenommen werden. Jedes Individuum verarbeitet und liefert ständig Bilder. Diese Bilder wiederum werden von anderen aufgenommen und verarbeitet. Durch die Verarbeitung und Analyse der Bilder entstehen beim Betrachter wieder neue Bilder. Diese neuen Bilder führen zu wiederum neuen Bildern, welche den Betrachter zum Sender von Bildern macht. Es handelt sich also um einen ständigen Kreislauf. Jedes Individuum ist damit beschäftigt Bilder aufzunehmen und selbst Bilder auszusenden. Dieser Prozess kann allgemein als „Imagebildung“ verstanden werden. Der Mensch versucht sich über diese Bilder –Images – zu definieren. Wer bin ich und was versuche ich nach außen hin darzustellen? Diese Frage treibt Personen ständig an und kann zu einer möglichen Verwirrung führen. Durch eine Zunahme von Bildern durch eine von Globalisierung und medial geprägten Welt, ist der Mensch quasi in Vollzeit als „Imager“ zu verstehen. Er nimmt Bilder auf, verarbeitet sie und sendet sie wieder an andere “ Imager“ aus. Insbesondere die Zunahme von Fernsehen und dem Medium Internet macht die Arbeit zu einer Vollzeitbeschäftigung. Das Individuum hat immer mehr Zugriff auf andere Images und sendet somit auch immer mehr und verschiedene Images aus.
Inhaltsverzeichnis
- Vorwort
- I Einleitung
- 2 Image in moderne und vormoderner Gesellschaften
- 3 Die Zunahme der bildhaften Medien
- 4 Imagebildung in Bezug auf den Begriff des „Unterschichtenfernsehen"
- 5 Schlussbetrachtung
- Quellenverzeichnis
- Onlineverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Hausarbeit befasst sich mit dem Konzept des Images in modernen Gesellschaften und untersucht, wie die Zunahme von bildhaften Medien, insbesondere Fernsehen und Internet, die Imagebildung beeinflusst. Die Arbeit analysiert die Entwicklung der Mediennutzung in Deutschland und stellt einen Zusammenhang zwischen der steigenden Anzahl von Bildern und der Komplexität der Imagebildung her. Im Fokus steht dabei die kritische Auseinandersetzung mit dem Begriff des "Unterschichtenfernsehen" und dessen Einfluss auf die Wahrnehmung und Konstruktion von Images.
- Das Image als ein dynamisches Konstrukt, das durch die Interaktion mit anderen Bildern und Erfahrungen geformt wird.
- Die Zunahme von bildhaften Medien in modernen Gesellschaften und deren Einfluss auf die Imagebildung.
- Die Rolle des "Unterschichtenfernsehen" in der Konstruktion und Reproduktion von Stereotypen.
- Die Auswirkungen von bildhaften Medien auf die Selbstwahrnehmung und die Abgrenzung zu anderen sozialen Gruppen.
- Die Bedeutung des Images im Kontext der modernen, medialisierten Gesellschaft.
Zusammenfassung der Kapitel
-
Die Einleitung führt das Konzept des Images ein und stellt die zentrale Frage nach der Bedeutung von Bildern in modernen Gesellschaften. Es wird betont, dass das Image nicht als statisches Konzept zu verstehen ist, sondern sich durch die Interaktion mit anderen Images und Erfahrungen ständig verändert. Die Einleitung beleuchtet die Vielschichtigkeit des Images und die Herausforderungen, die sich aus der stetigen Flut von Bildern in der modernen Welt ergeben.
-
Kapitel 2 untersucht den Wandel des Imagebegriffs von vormodernen zu modernen Gesellschaften. Es wird argumentiert, dass die Quantität der Bilder, die wir verkörpern, in modernen Gesellschaften stetig gestiegen ist. Der Text bezieht sich auf Erving Goffmans Theorie der Selbstdarstellung und interpretiert das Image als eine „Überlebensfunktion" des Individuums, die uns in Gruppen und Gesellschaften integriert. Goffmans Konzept des „Theaters" wird als Metapher für die ständige Inszenierung unseres Images im Alltag verwendet.
-
Kapitel 3 beleuchtet die Zunahme von bildhaften Medien in der Bundesrepublik Deutschland. Anhand von Statistiken wird die Entwicklung der Fernsehnutzung seit den 1950er Jahren dargestellt und die steigende Bedeutung des Internets als Medium der Bildproduktion und -rezeption hervorgehoben. Die Kapitel zeigt, dass die Nutzung von bildhaften Medien in den letzten Jahrzehnten deutlich zugenommen hat und dass der Mensch in der heutigen Zeit einem ständigen Fluss von Bildern ausgesetzt ist.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen Image, Imagebildung, bildhafte Medien, Fernsehen, Internet, "Unterschichtenfernsehen", Stereotypen, soziale Gruppen, Selbstdarstellung, moderne Gesellschaft, Mediatisierung und gesellschaftliche Abgrenzung. Die Arbeit analysiert die Auswirkungen der Zunahme von bildhaften Medien auf die Konstruktion und Wahrnehmung von Images in der modernen Gesellschaft.
- Citation du texte
- B.A. Ben Weiherer (Auteur), 2013, Image und die bildhaften Medien, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/271860