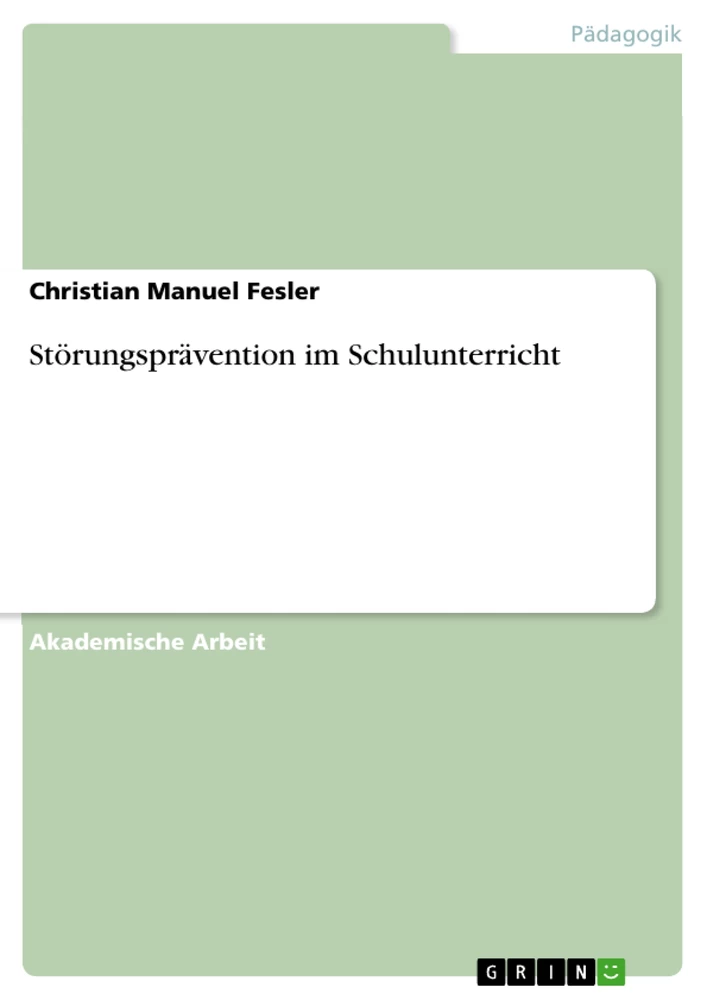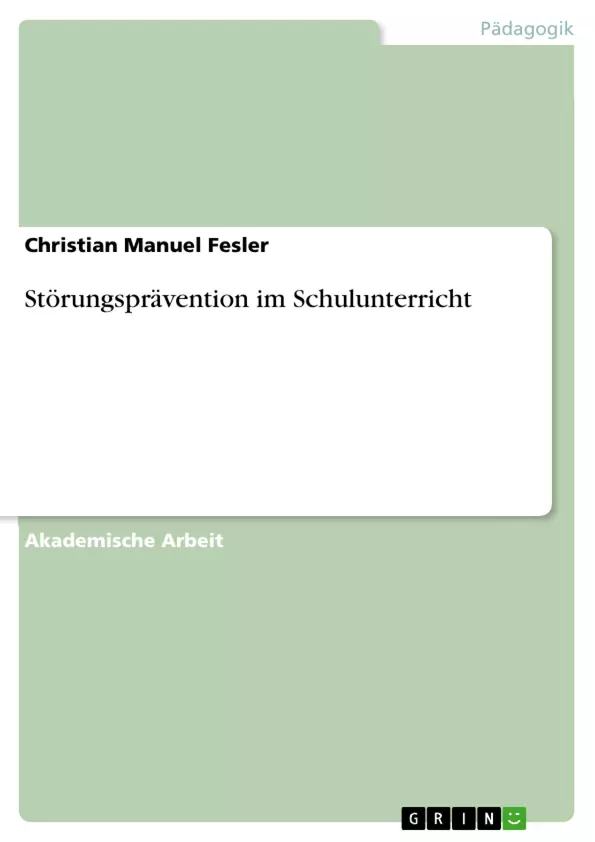Vorbeugen ist besser als heilen. Dieser Leitsatz, der ursprünglich aus der Medizin stammt, besagt in schlichter Weise, dass es oftmals besser ist, einen unerwünschten Zustand durch gezielte Gegenmaßnahmen im Vorfeld bereits abzuwenden, statt zeit- und arbeitsintensiv die Symptome zu bekämpfen. Im pädagogischen Kontext umfasst Störungsprävention sämtliche Verhaltensweisen und Techniken des Lehrers, um Disziplinprobleme erst gar nicht entstehen zu lassen. In Schüleräußerungen wie „Der kann sich halt nicht durchsetzen“ oder „Sie sind einfach viel zu gutmütig“ (vgl. Becker 2000, S. 120) spiegelt sich wider, dass für viele nach wie vor „Strenge“ der entscheidende Faktor zur Aufrechterhaltung von Disziplin und Ordnung im Klassenraum ist. Bei einer schriftlichen Befragung, die NOLTING im Rahmen seiner Studien unter Lehrern durchführte, stellte sich heraus, dass die meisten der Befragten die Aufstellung von Regeln als eine entscheidende Maßnahme zur Verhütung von Konflikten im Klassenraum sahen. Hinzu kamen Aspekte der Unterrichtsführung (interessant, gut vorbereitet und strukturiert) sowie der Aufbau sozial-emotionaler Beziehung zu den Schülern, die zur Störungsvermeidung betragen sollten. Viele der befragten Lehrer sahen auch die angemessene Reaktion auf auftretende Störungen als Beitrag zur Vermeidung von Disziplinproblemen in der Zukunft (vgl. Nolting 2002, S. 24ff.).
Die folgenden Abschnitte sollen zum einen die essentielle Bedeutung der Störungsvorbeugung verdeutlichen. Zum anderen soll eine Systematisierung der Präventivmaßnahmen zeigen, dass der Lehrer die Möglichkeit hat, bewusst, gezielt und effektiv Disziplinschwierigkeiten im Vorfeld abzuwenden. Dabei ist es nicht nötig, seine gesamte Lehrerpersönlichkeit zu ändern. Bei den folgenden Interventionskonzepten genügt es oftmals, einige Grundprinzipien zu beachten und persönliche, oftmals verfestigte Einstellungen zu hinterfragen. Basierend auf der Grundannahme, dass Situationen meist leichter zu verändern sind als Menschen, ist das allgemeine Präventionsziel die Gestaltung eines Gesamtfelds Schule, das „günstigen Einfluss ausübt und zugleich einen guten Nährboden für seine [des Lehrers] direkten Maßnahmen darstellt“ (Glöckel 2000, S. 67).
Inhaltsverzeichnis
- Generelle Problematik
- Störungsprävention auf der Unterrichtsebene
- Befunde Kounins
- Disziplinrelevante Bereiche des Lehrerverhaltens
- Breite Aktivierung
- Unterrichtsfluss
- Regeln
- Präsenz- und Stoppsignale
- Störungsprävention auf der Beziehungsebene
- Störungsprävention auf Organisationsebene
- Räumliche Gestaltungsmöglichkeiten
- Zusammenarbeit mit Kollegen
- Elternarbeit
- Zusammenfassende Übersicht der Maßnahmen zur Störungsprävention
- Literaturverzeichnis (inklusive weiterführender Literatur)
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Das Buch "Störungsprävention im Schulunterricht" von Christian Fesler (2006) befasst sich mit der Thematik von Unterrichtsstörungen und deren Vermeidung. Das Werk richtet sich an Lehrerinnen und Lehrer, die sich mit der Herausforderungen von Disziplinproblemen im Schulunterricht auseinandersetzen. Fesler geht dabei auf verschiedene Ebenen der Störungsprävention ein und bietet eine umfassende Darstellung der relevanten Theorien und Praxistipps.
- Ursachen und Folgen von Unterrichtsstörungen
- Störungsprävention auf der Unterrichtsebene
- Störungsprävention auf der Beziehungsebene
- Störungsprävention auf der Organisationsebene
- Zusammenfassende Übersicht der Maßnahmen zur Störungsprävention
Zusammenfassung der Kapitel
Das Buch beginnt mit einer allgemeinen Einführung in die Thematik der Störungsprävention. Fesler erläutert den Stellenwert von vorbeugenden Maßnahmen und die Bedeutung einer effektiven Unterrichtsgestaltung. Im zweiten Kapitel beleuchtet Fesler die Ergebnisse der Forschung von Jacob Kounin, der die Bedeutung von präventivem Lehrerverhalten für die Störungsvermeidung herausstellte. Kounin identifizierte vier Dimensionen des präventiven Lehrerverhaltens, die Fesler im Detail beschreibt und mit konkreten Beispielen aus der Praxis illustriert. Das dritte Kapitel behandelt die Störungsprävention auf der Beziehungsebene. Fesler betont dabei die Bedeutung eines professionellen Beziehungsmanagements zwischen Lehrer und Schüler. Er geht auf verschiedene Aspekte des Lehrerauftritts ein, wie Kleidung, Körpersprache und Sprache, und zeigt, wie diese Elemente zum Aufbau einer positiven Lehrer-Schüler-Beziehung beitragen können. Das vierte Kapitel befasst sich mit der Störungsprävention auf Organisationsebene. Fesler untersucht dabei die Rolle von räumlichen Gegebenheiten, der Zusammenarbeit mit Kollegen und der Elternarbeit. Er zeigt, wie diese Faktoren die Entstehung von Unterrichtsstörungen beeinflussen können und wie man durch gezielte Maßnahmen das Störungsrisiko minimieren kann.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen Unterrichtsstörungen, Störungsprävention, Lehrerverhalten, Beziehungsebene, Organisationsebene, Unterrichtsgestaltung, Klassenführung, Schülerverhalten, Beziehungsmanagement, Elternarbeit, Kollegiale Zusammenarbeit.
Häufig gestellte Fragen
Was bedeutet Störungsprävention im Unterricht?
Störungsprävention umfasst alle Techniken und Verhaltensweisen von Lehrkräften, die darauf abzielen, Disziplinprobleme gar nicht erst entstehen zu lassen, anstatt nur auf Symptome zu reagieren.
Welche Erkenntnisse lieferte Jacob Kounin zur Klassenführung?
Kounin identifizierte Dimensionen wie Allgegenwärtigkeit, Überlappung, Reibungslosigkeit und Schwung als entscheidende Faktoren für ein präventives Lehrerverhalten, das Unterrichtsstörungen minimiert.
Wie beeinflusst die Beziehungsebene die Disziplin?
Ein professionelles Beziehungsmanagement, das auch Körpersprache und wertschätzende Kommunikation einschließt, schafft eine positive Atmosphäre und verringert das Risiko von Konflikten.
Welche Rolle spielt die Organisationsebene bei der Vermeidung von Störungen?
Faktoren wie die räumliche Gestaltung des Klassenzimmers, die Zusammenarbeit im Kollegium und eine aktive Elternarbeit sind wesentliche organisatorische Pfeiler der Störungsprävention.
Ist „Strenge“ der wichtigste Faktor für Ordnung in der Klasse?
Nein, moderne pädagogische Ansätze zeigen, dass eine strukturierte Unterrichtsführung, klare Regeln und eine gute sozial-emotionale Beziehung zu den Schülern effektiver sind als reine Strenge.
- Quote paper
- Christian Manuel Fesler (Author), 2006, Störungsprävention im Schulunterricht, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/273392