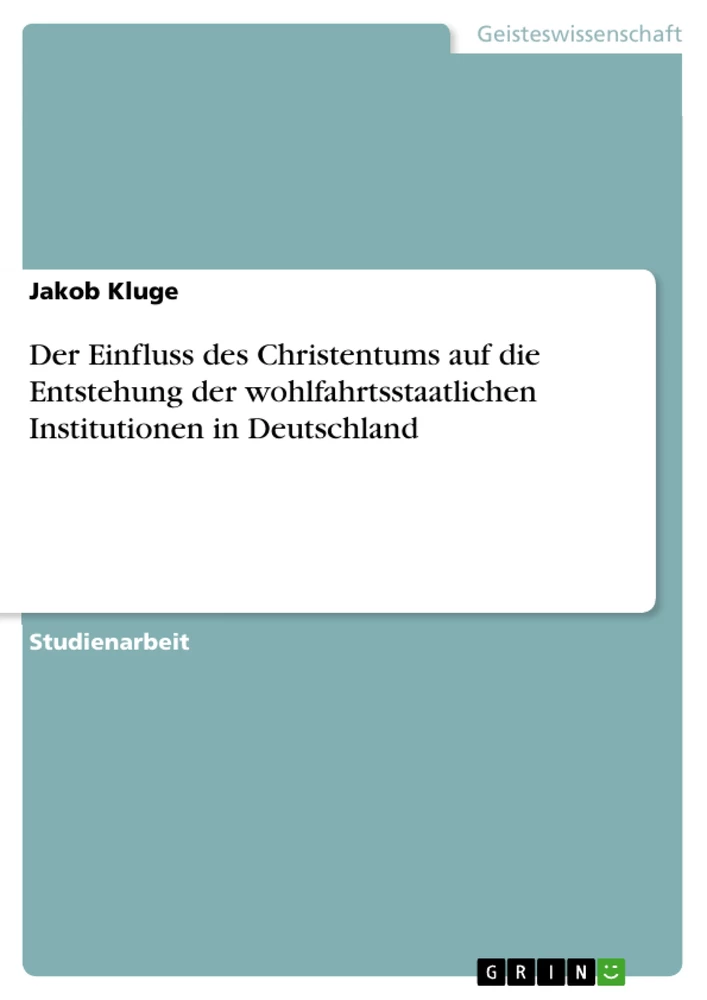Innerhalb der vergleichenden Sozialforschung ist der Einfluss der Religion auf die Herausbildung der wohlfahrtsstaatlichen Institutionen mittlerweile ein durchaus populäres Arbeitsfeld. Sprach Franz-Xaver Kaufmann 1989 noch von einem „vergessenen Thema“ (Kaufmann, 1989, S. 67), so finden sich mittlerweile diverse Arbeiten, die sich dieser Frage annehmen. Dafür verantwortlich ist auch ein Paradigmenwechsel in der Perzeption der Rolle der Religion für die gesellschaftliche Entwicklung. Sie beeinflusst die Definition von gerechter beziehungsweise ungerechter Verteilung und von gesellschaftlicher Solidarität (Manow, 2009, S. 13). Ich halte mich in meiner Arbeit an eine Definition, die Religion als „Theorie und Praxis der Letztwertbegründung“ (Opielka, 2002, S. 2) begreift. Das bedeutet, dass sie für - für das Individuum - nicht hinterfragbare Werte verantwortlich ist und so - ausgehend von dem Gedanken, dass jede politische Entscheidung einer moralischen Akzeptanz bedarf - erscheint es plausibel, zu untersuchen, inwieweit der Wohlfahrtsstaat auf religiösen Werten beruht.
Dahinter steht die These, dass religiöse Motive institutionelle Prozesse beeinflussen und wiederum von diesen beeinflusst werden. Das heißt, dass sich eine „Wahlverwandschaft“ (Max Weber) bildet zwischen religiösen Ideen und Prinzipien von Institutionen, die sich mit der Zeit zu einer „etablierten Verwandschaft“ entwickelt, die nicht so leicht zu ändern ist.
Um den Rahmen meiner Arbeit nicht zu sprengen, konzentriere ich mich auf den deutschen Raum, was es mir erlaubt, mich fast ausschließlich auf die Einflüsse des Protestantismus und des Katholizismus zu konzentrieren. Eine solche Gegenüberstellung wäre auf ganz Europa bezogen im Sinne einer wissenschaftlichen Herangehensweise nicht zulässig, gibt es doch enorme Unterschiede in der Sozialdoktrin, das heißt in der jeweiligen Aufgabenzuschreibung an Staat und Individuum zum Beispiel zwischen den protestantischen Staatskirchen in Nordeuropa und den lutherischen Sekten in Ländern wie der Schweiz, den Niederlanden, Großbritannien oder den USA (Manow, 2009, S. 8).
Inhalt
Einleitung
Die Anfänge des deutsche Wohlfahrtsstaats
Theorien der wohlfahrtsstaatlichen Politik
Die Sozioökonomische Schule
Die Machtressourcentheorie
Die Rolle des Christentums
Der Einfluss des Katholizismus
Der Protestantismus und die Säkularisierung
Fazit
Literaturverzeichnis
-
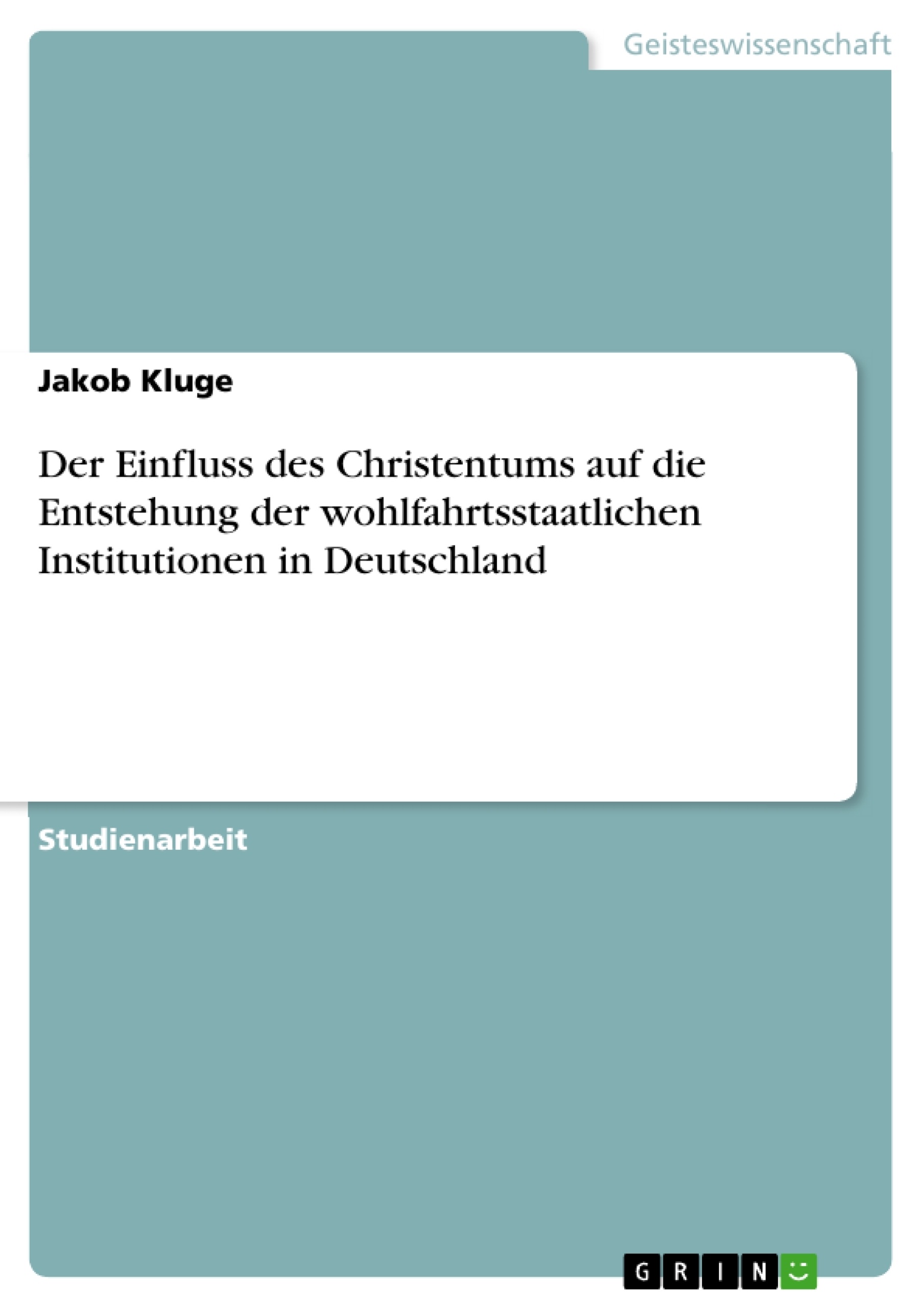
-

-

-
Laden Sie Ihre eigenen Arbeiten hoch! Geld verdienen und iPhone X gewinnen. -

-
Laden Sie Ihre eigenen Arbeiten hoch! Geld verdienen und iPhone X gewinnen. -

-
Laden Sie Ihre eigenen Arbeiten hoch! Geld verdienen und iPhone X gewinnen. -

-
Laden Sie Ihre eigenen Arbeiten hoch! Geld verdienen und iPhone X gewinnen. -

-
Laden Sie Ihre eigenen Arbeiten hoch! Geld verdienen und iPhone X gewinnen. -

-
Laden Sie Ihre eigenen Arbeiten hoch! Geld verdienen und iPhone X gewinnen.