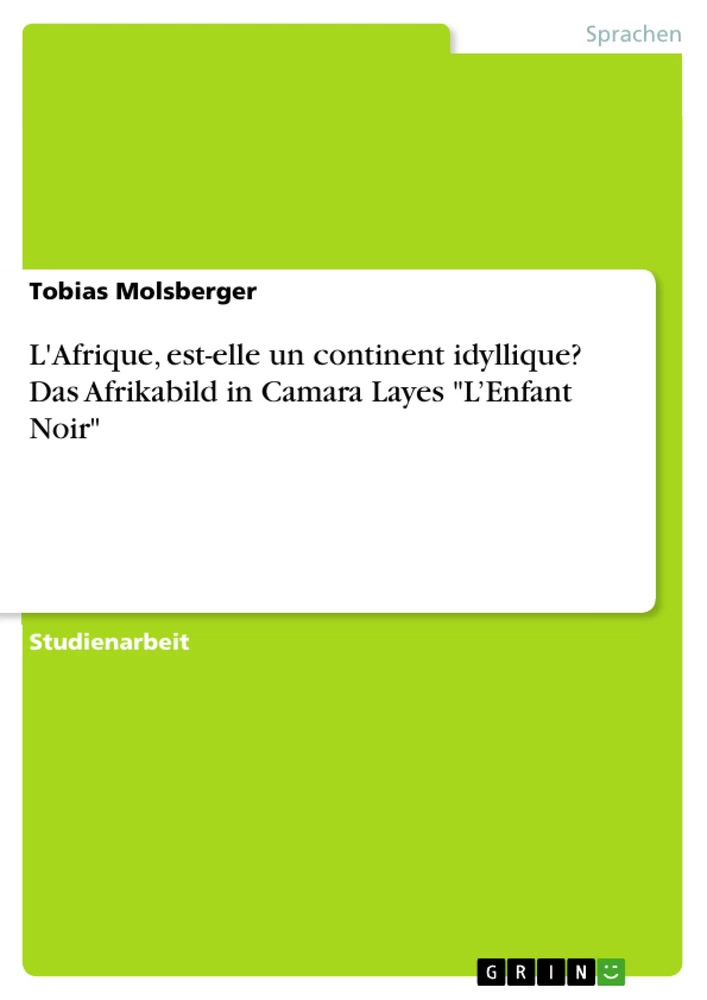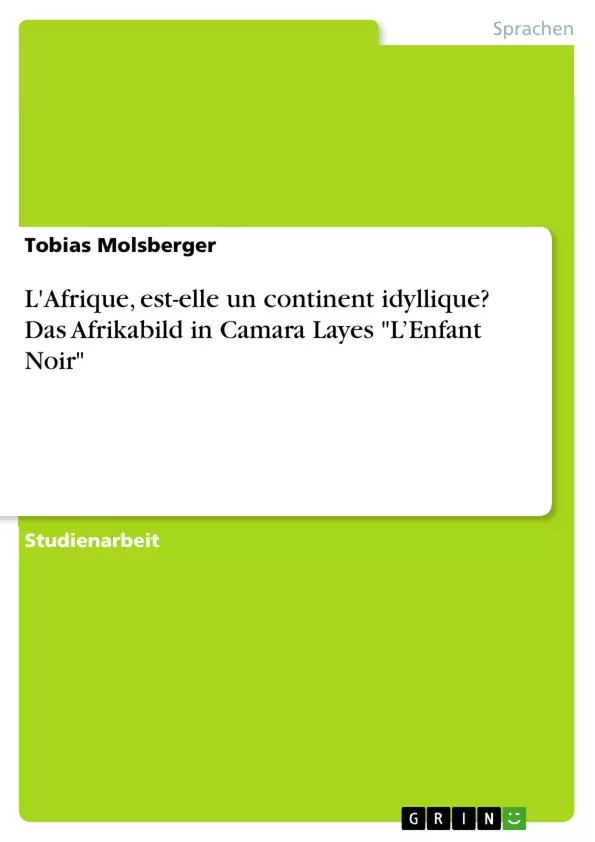Diese Hausarbeit beschäftigt sich zunächst mit der Analyse des weit über die geografischen Grenzen Afrikas hinaus bekannten und vielfach rezipierten und interpretierten Roman "L'Enfant noir" des guineischen Schriftstellers Camara Laye aus dem Jahre 1953.
Zur Situation Afrikas zur Entstehungszeit des Romans lässt sich konstatieren, dass zu jener Zeit, am Anfang der 1950er Jahre, ein Großteil des afrikanischen Territoriums unter europäischer Kolonialherrschaft stand und Staaten wie allen voran Großbritannien und Frankreich ihren politischen Einfluss nach Jahrzehnten der kolonialen Realitäten allmählich einzubüßen bangen mussten, da ab jener Zeit separatistische Tendenzen sowie Emanzipations- und Unabhängigkeitsbestrebungen in Teilen der afrikanischen Bevölkerung festzustellen sind:
"Seit den 50er Jahren kämpften die kolonisierten Völker Europas nicht mehr nur um die Anerkennung ihrer Würde, sondern auch politische Befreiung von den Kolonialherren. Manchen war zu Bewußtsein gekommen, daß wirtschaftlicher Wohlstand und soziale Sicherheit erst erreicht werden können, wenn diese Völker von der Vormundschaft der Kolonialmächte befreit wurden. Die Schriftsteller schrieben Werke, in denen sie Missstände denunzierten, die die Kolonialherren zu verantworten hatten. Damit wurde im kollektiven Bewußtsein die Rechtfertigung des Strebens nach Unabhängigkeit erreicht." (Ndeffo Tene 2010: 59).
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Camara Layes L'enfant noir im inhaltlichen Überblick
- Welches Afrikabild wird in L'enfant noir vermittelt? - Eine Annäherung anhand ausgewählter Textstellen
- Welche Aufgabe hat der afrikanische Romancier im kolonialen Afrika? - Die Kontroverse um das in L'enfant noir gezeichnete Afrikabild
- Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit analysiert Camara Layes Roman "L'enfant noir" im Kontext der spätkolonialen Debatte über die Rolle des afrikanischen Romanciers. Die Arbeit untersucht das in dem Roman präsentierte Afrikabild und setzt es in Beziehung zu den kontroversen Diskussionen über die Darstellung Afrikas in der Literatur jener Zeit. Ziel ist es, die Legitimität der Darstellung und die damit verbundenen Aufgaben des Romanciers zu hinterfragen.
- Das in "L'enfant noir" präsentierte Afrikabild
- Die Rolle des afrikanischen Romanciers im spätkolonialen Kontext
- Kontroversen um die Darstellung Afrikas in der Literatur
- Der Kontrast zwischen traditionellem Dorfleben und europäischer Kultur
- Der Prozess der kulturellen und persönlichen Entwicklung des Protagonisten
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in die Debatte um die Aufgaben des afrikanischen Romans im Kontext der bevorstehenden Unabhängigkeit ein. Sie stellt die zentrale Frage nach der Darstellung der kolonialen Realität gegenüber der traditionellen afrikanischen Kultur und kündigt die Analyse von Camara Layes "L'enfant noir" an. Der Kontext der Entstehung des Romans in den 1950er Jahren, geprägt von separatistischen Tendenzen und Unabhängigkeitsbestrebungen in Afrika, wird beleuchtet. Die Arbeit skizziert ihren methodischen Ansatz: eine Inhaltsanalyse von "L'enfant noir", eine Untersuchung des Afrikabildes im Roman und eine Diskussion der Reaktionen anderer afrikanischer Schriftsteller darauf.
2. Camara Layes L'enfant noir im inhaltlichen Überblick: Dieses Kapitel bietet einen knappen Überblick über den autobiografischen Roman "L'enfant noir". Es beschreibt die zentralen Handlungselemente: Camaras Kindheit in einem guineischen Dorf, seine Schulzeit, seine ersten Begegnungen mit der europäischen Kultur und seine Emigration nach Frankreich. Die beschriebenen Aspekte umfassen die liebevolle Familie, das magische Dorfleben, die strenge Koranschule, den wichtigen Übergangsritus der Beschneidung und den schwierigen Abschied vom Dorf bei der Übersiedlung nach Conakry. Der Fokus liegt auf der Darstellung des Kontrastes zwischen traditionellem und europäischem Leben.
Schlüsselwörter
L'enfant noir, Camara Laye, Afrikabild, Kolonialismus, Postkolonialismus, afrikanischer Roman, Romancier, Tradition, Moderne, Kulturkontrast, Identität.
Häufig gestellte Fragen zu Camara Layes "L'enfant noir" - Inhaltsanalyse
Was ist der Gegenstand dieser Hausarbeit?
Die Hausarbeit analysiert Camara Layes Roman "L'enfant noir" im Kontext der spätkolonialen Debatte über die Rolle des afrikanischen Romanciers. Im Mittelpunkt steht die Untersuchung des im Roman präsentierten Afrikabildes und dessen Einordnung in die kontroversen Diskussionen über die Darstellung Afrikas in der Literatur jener Zeit. Die Arbeit hinterfragt die Legitimität dieser Darstellung und die damit verbundenen Aufgaben des Romanciers.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themen: Das in "L'enfant noir" präsentierte Afrikabild, die Rolle des afrikanischen Romanciers im spätkolonialen Kontext, Kontroversen um die Darstellung Afrikas in der Literatur, den Kontrast zwischen traditionellem Dorfleben und europäischer Kultur sowie den Prozess der kulturellen und persönlichen Entwicklung des Protagonisten.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit und worum geht es in ihnen?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel mit inhaltlichem Überblick über "L'enfant noir", ein Kapitel zur Analyse des Afrikabildes im Roman, ein Kapitel zur Rolle des afrikanischen Romanciers und eine Schlussbetrachtung. Die Einleitung führt in die Debatte um die Aufgaben des afrikanischen Romans ein und skizziert den methodischen Ansatz. Das Kapitel zum inhaltlichen Überblick beschreibt die zentralen Handlungselemente von "L'enfant noir". Das Kapitel zur Analyse des Afrikabildes untersucht die Darstellung Afrikas im Roman und setzt sie in den Kontext der damaligen Diskussionen. Das Kapitel zur Rolle des afrikanischen Romanciers beleuchtet die Kontroversen um die Darstellung Afrikas in der Literatur.
Welches Afrikabild wird in "L'enfant noir" vermittelt?
Die Hausarbeit analysiert das in "L'enfant noir" präsentierte Afrikabild detailliert anhand ausgewählter Textstellen. Der Fokus liegt auf dem Kontrast zwischen dem traditionellen Dorfleben und der europäischen Kultur, der die kulturelle und persönliche Entwicklung des Protagonisten prägt.
Welche Rolle spielt der afrikanische Romancier im kolonialen Afrika laut der Arbeit?
Die Arbeit untersucht die kontroversen Diskussionen um die Aufgabe des afrikanischen Romanciers im spätkolonialen Afrika und setzt diese in Beziehung zu dem in "L'enfant noir" gezeichneten Afrikabild. Es wird hinterfragt, wie die koloniale Realität und die traditionelle afrikanische Kultur in der Literatur dargestellt werden sollten.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Arbeit?
Schlüsselwörter sind: L'enfant noir, Camara Laye, Afrikabild, Kolonialismus, Postkolonialismus, afrikanischer Roman, Romancier, Tradition, Moderne, Kulturkontrast, Identität.
- Citation du texte
- Tobias Molsberger (Auteur), 2013, L'Afrique, est-elle un continent idyllique? Das Afrikabild in Camara Layes "L’Enfant Noir", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/273736