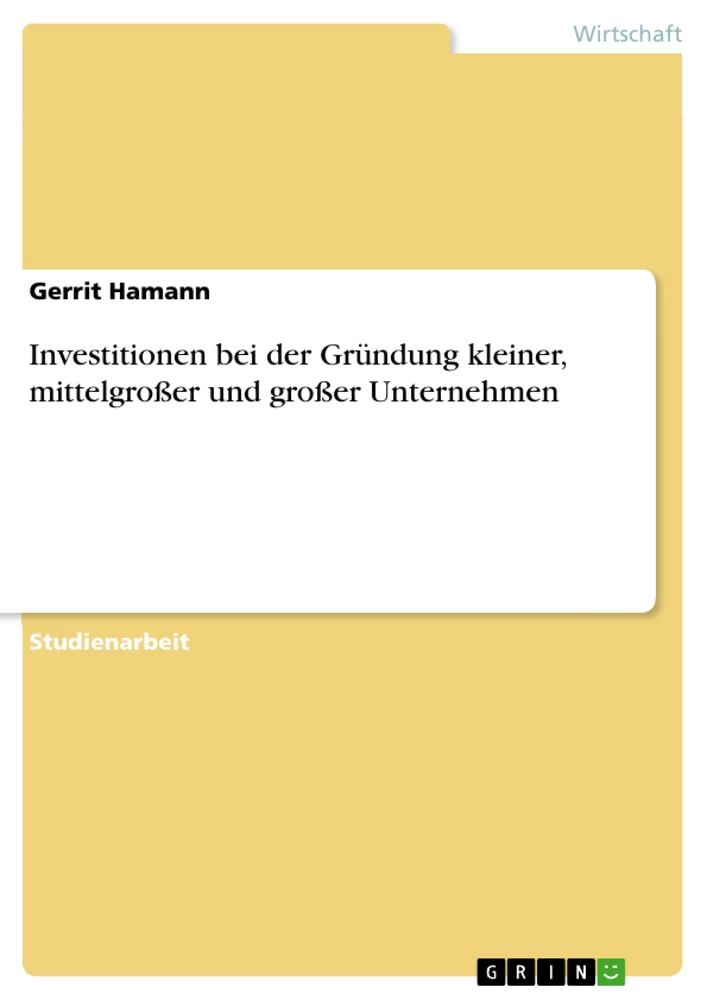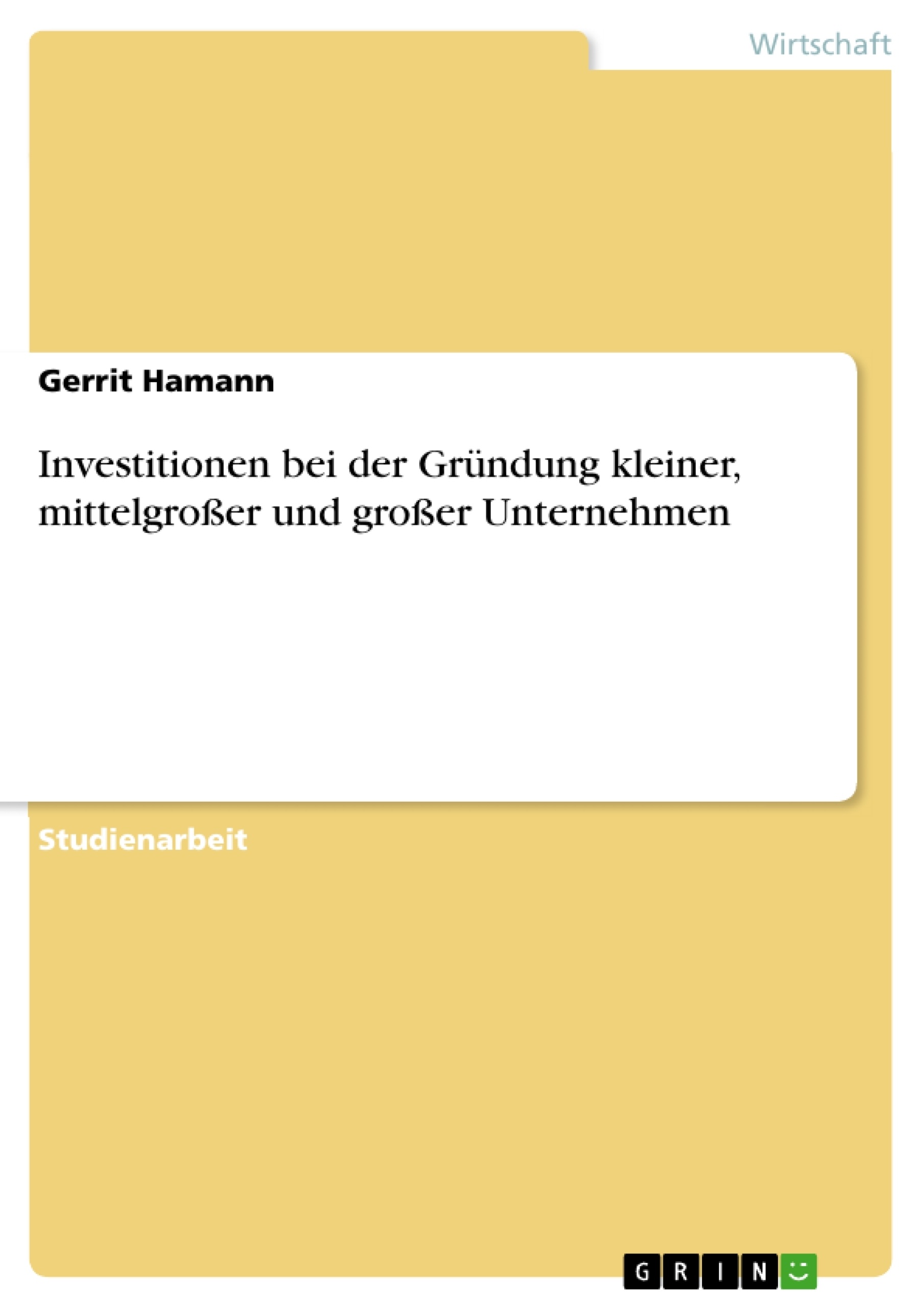Eine Abgrenzung des Investitionsbegriffs im Allgemeinen wird bereits in frühen Publikationen problematisiert. Bei einer dieser Arbeit vorangegangenen Literaturrecherche konnte festgestellt werden, dass keine Informationen gefunden werden konnten, die verwertbare Aussagen über das Investitionsverhalten bei der Gründung von Unternehmen unterschiedlicher Größe zulassen. Ebenso existieren im Vorfeld dieser Arbeit keinerlei verfügbaren Informationen über Gründungsinvestition bezogen auf unterschiedliche Gründungstypen, Branchen, Entwicklungsphasen und Standtorte. Diese Arbeit untersucht daher, inwieweit sich das Investitionsverhalten bei Gründung von Unternehmen unterschiedlicher Größe (klein, mittelgroß und groß) unterscheiden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Problemstellung
- Zielsetzung
- Vorgehensweise
- Investitionsbegriff
- Einflussfaktoren bei Gründungsinvestitionen mit mittelbarer Korrelation mit der Unternehmensgröße
- Untersuchung der Gründungstypen
- Untersuchung der Branche
- Beratung, Training und Coaching
- Gastronomie
- Produktion
- IT
- Untersuchung des Standorts
- Investitionen bei der Gründung von Unternehmen unterschiedlicher Größe
- Kleine Unternehmen
- Mittelgroße Unternehmen
- Große Unternehmen
- Zusammenfassung und kritische Würdigung
- Zusammenfassung
- Kritische Würdigung
- Literatur- und Quellenverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Seminararbeit befasst sich mit dem Investitionsverhalten bei der Gründung von Unternehmen unterschiedlicher Größe. Ziel ist es, zu untersuchen, inwieweit sich das Investitionsverhalten bei kleinen, mittelgroßen und großen Unternehmen unterscheidet. Die Arbeit basiert auf einer polymethodischen Vorgehensweise, die sowohl Literaturrecherche als auch Befragungen von Unternehmern einbezieht.
- Unterschiede im Investitionsverhalten bei der Gründung von Unternehmen unterschiedlicher Größe
- Einflussfaktoren auf das Investitionsverhalten, wie Gründungstypen, Branchen und Standorte
- Relevanz der Investitionsrechnung und -entscheidungen
- Rolle von Realinvestitionen, immateriellen Investitionen und Nominalinvestitionen
- Herausforderungen und kritische Würdigung der Arbeit
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Problemstellung der Arbeit dar, die sich auf die fehlende Literatur zum Investitionsverhalten bei der Gründung von Unternehmen unterschiedlicher Größe bezieht. Die Zielsetzung ist die Untersuchung der Unterschiede im Investitionsverhalten und die Falsifizierung der These, dass das Investitionsverhalten bei allen Unternehmensgrößen gleich oder sehr ähnlich ist. Die Vorgehensweise beinhaltet eine polymethodische Herangehensweise, die sowohl Literaturrecherche als auch Befragungen von Unternehmern einbezieht.
Kapitel 2 definiert den Investitionsbegriff anhand von Literaturrecherchen und stellt verschiedene Definitionen von Investitionen vor. Es wird auch der Zusammenhang zwischen Investitionen und Finanzierung beleuchtet, wobei die Finanzierung aufgrund der thematischen Einschränkung der Arbeit auf Gründungsinvestitionen nicht im Detail behandelt wird.
Kapitel 3 untersucht Einflussfaktoren auf das Investitionsverhalten, die zwar bei allen Unternehmensgrößen eine Rolle spielen, aber nicht eindeutig einer bestimmten Größe zugeordnet werden können. Hierzu gehören Gründungstypen, Branchen und Standorte. Die Kapitel beleuchtet die Unterschiede in der Investitionsintensität bei verschiedenen Gründungstypen, wie originäre Gründungen, derivative Gründungen und Mischformen. Es werden auch branchenspezifische Unterschiede anhand von Beispielen wie Beratung, Training und Coaching, Gastronomie, Produktion und IT dargestellt. Die Wahl des Standorts wird ebenfalls als entscheidender Faktor für die Investitionsentscheidung betrachtet.
Kapitel 4 untersucht die Investitionen bei der Gründung von Unternehmen unterschiedlicher Größe. Es wird argumentiert, dass die Investitionen in kleinen Unternehmen eher klein ausfallen und vor allem eine schnell umschlagende Investition sind, um Liquiditätsengpässe zu vermeiden. Bei mittelgroßen Unternehmen kommt es stark auf den Gründungstyp an, wobei sowohl originäre als auch derivative Gründungen relevant sind. Große Unternehmen zeichnen sich durch eine hohe Investitionsintensität aus, die vor allem von der Art der Gründung abhängt. Es werden auch Unterschiede in der Investitionsrechnung und -entscheidung sowie die Bedeutung von immateriellen und Nominalinvestitionen bei großen Unternehmen behandelt.
Die Zusammenfassung fasst die wichtigsten Ergebnisse der Arbeit zusammen und zeigt, dass die in der Zielsetzung formulierte These als falsifiziert betrachtet werden kann. Es werden die Unterschiede im Investitionsverhalten bei verschiedenen Unternehmensgrößen zusammengefasst und die Rolle von Gründungstypen, Branchen und Standorten hervorgehoben. Die kritische Würdigung der Arbeit weist auf die Herausforderungen hin, die sich aus der fehlenden Literatur zum Thema ergeben. Es werden auch die Grenzen der Arbeit aufgrund der starken Abhängigkeit von eigenen Überlegungen und der oberflächlichen Ausführungen aufgezeigt.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen Investitionsverhalten, Gründungsinvestitionen, Unternehmensgröße, Gründungstypen, Branchen, Standorte, Investitionsrechnung, Realinvestitionen, immaterielle Investitionen, Nominalinvestitionen, Liquidität, Umsatz, Gewinn, Professionalität, Komplexität, Internationalität, Falsifizierung, Literaturrecherche, Befragungen.
Häufig gestellte Fragen
Unterscheiden sich Investitionen je nach Unternehmensgröße?
Ja, kleine Unternehmen investieren meist kurzfristig in Liquidität, während große Gründungen oft hohe, langfristige Realinvestitionen erfordern.
Welche Rolle spielt die Branche bei Gründungsinvestitionen?
Die Investitionsintensität variiert stark: Eine IT-Gründung erfordert andere Mittel als ein Gastronomiebetrieb oder ein Produktionsunternehmen.
Was sind immaterielle Investitionen?
Dazu gehören Ausgaben für Patente, Lizenzen, Software oder auch das Branding, die besonders bei großen Unternehmen an Bedeutung gewinnen.
Was ist eine derivative Gründung?
Eine Gründung durch Übernahme eines bestehenden Betriebs, was oft höhere Anfangsinvestitionen (Kaufpreis) als eine originäre Neugründung bedeutet.
Warum ist der Standort für Investitionen entscheidend?
Der Standort beeinflusst Kosten für Miete, Infrastruktur und Zugang zu Märkten, was die gesamte Investitionsrechnung maßgeblich verändert.
- Arbeit zitieren
- Gerrit Hamann (Autor:in), 2014, Investitionen bei der Gründung kleiner, mittelgroßer und großer Unternehmen, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/273790