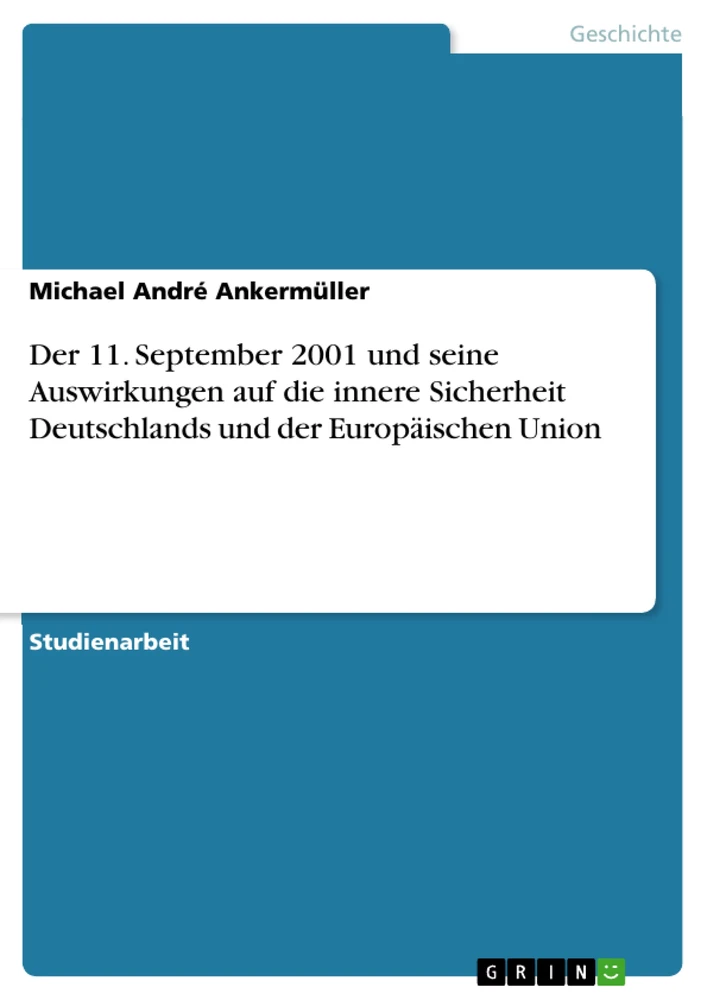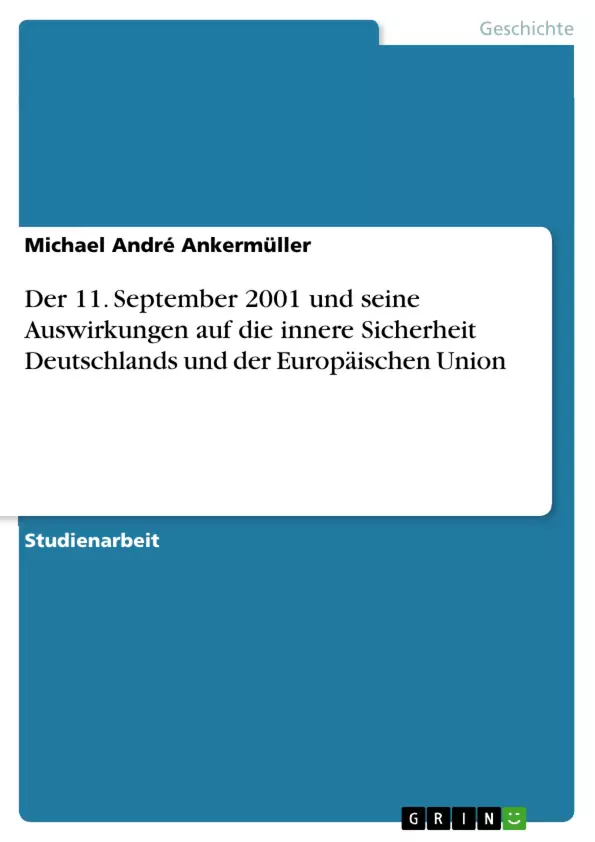Die Anschläge vom 11. September 2001 stellen eine entscheidende historische Zäsur dar und leiteten eine neue Ära des Terrorismus ein. Angesichts der furchtbaren Anschläge von New York und Washington schien die Menschheit für einen Moment wie gelähmt. Wer an den Fernsehgeräten mitverfolgte, wie United Airlines 175 im Südturm des World Trade Center verschwand und wenige Zeit später die Türme wie ein Kartenhaus in sich zusammenfiel, wird diese Bilder nie wieder vergessen können. Die weltweite Sicherheitspolitik musste sich mit einem Schlag so schnell wie möglich ändern.
Inhaltsverzeichnis
- Der 11. September und der Wandel der Sicherheitspolitik
- Forschungsstand
- Die Schwierigkeit einer Terrorismusdefinition
- „Innere Sicherheit“ - Was ist das eigentlich
- Die Akteure der „Inneren Sicherheit“
- Geschichtlicher Hintergrund der „Inneren Sicherheit“ in der Bundesrepublik Deutschland ab dem Jahr 1970 und die Reaktion auf den Terrorismus
- 9/11 als historische Zäsur im Kampf mit dem Terrorismus und dessen Folgen für die „Innere Sicherheit“ in Deutschland
- Welche Rolle nimmt Deutschland bei dem Anschlag auf das World Trade Center ein?
- Sicherheitspaket I oder das 1. Anti-Terror-Paket als Reaktion auf 9/11 in Deutschland
- Sicherheitspaket II oder Terrorismusbekämpfungsgesetz als Reaktion auf 9/11 in Deutschland
- Europäisierung der „Inneren Sicherheit“ als Folge der Anschläge auf das World Trade Center am 11. September 2001.
- Das Spannungsfeld von Sicherheit und Freiheit im Zuge der unzähligen Gesetzesnovellierungen der „Inneren Sicherheit“ nach dem 11. September
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Auswirkungen des Terroranschlags vom 11. September 2001 auf die Innere Sicherheit in Deutschland und der Europäischen Union. Der Fokus liegt dabei auf der Analyse der staatlichen Reaktionen auf den Terrorismus und der Veränderungen im Politikfeld der „Inneren Sicherheit“ nach 9/11.
- Definition und Abgrenzung des Begriffs „Terrorismus“
- Entwicklung des Politikfelds „Innere Sicherheit“ in Deutschland vor und nach dem 11. September
- Analyse der Gesetzesänderungen und Sicherheitsstrukturen, die als Reaktion auf den Terrorismus eingeführt wurden
- Die Rolle Deutschlands im Kampf gegen den Terrorismus nach 9/11
- Die Europäisierung der „Inneren Sicherheit“ im Kontext der Anschläge
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel behandelt den historischen Hintergrund der Anschläge vom 11. September 2001 und deren Bedeutung als historische Zäsur im Kampf gegen den Terrorismus. Das zweite Kapitel beleuchtet die Schwierigkeit einer einheitlichen Terrorismusdefinition und die unterschiedlichen Perspektiven auf den Begriff. Das dritte Kapitel stellt die Akteure der „Inneren Sicherheit“ in Deutschland vor und beleuchtet die Rolle des Staates und der Sicherheitsbehörden. Das vierte Kapitel behandelt den geschichtlichen Hintergrund der „Inneren Sicherheit“ in Deutschland ab dem Jahr 1970 und die Reaktion auf den Terrorismus der RAF. Das fünfte Kapitel analysiert die Folgen des 11. Septembers für die „Innere Sicherheit“ in Deutschland, insbesondere die Einführung von Sicherheitspaketen und Anti-Terrorgesetzen.
Schlüsselwörter
Terrorismus, Innere Sicherheit, 11. September, Sicherheitspolitik, Deutschland, Europäische Union, Terrorismusbekämpfung, Gesetzesänderungen, staatliche Reaktionen, Anti-Terror-Paket, Sicherheitsstrukturen, Freiheit, Spannungsfeld, Terrorismusdefinition.
Häufig gestellte Fragen
Wie beeinflusste 9/11 die deutsche Sicherheitspolitik?
Die Anschläge führten zur schnellen Einführung der Sicherheitspakete I und II, die weitreichende Befugnisse für Sicherheitsbehörden und neue Anti-Terror-Gesetze beinhalteten.
Was ist das Terrorismusbekämpfungsgesetz?
Es ist Teil des Sicherheitspakets II und dient der Verbesserung der Zusammenarbeit von Geheimdiensten und Polizei sowie der Identifizierung potenzieller Terroristen.
Was bedeutet „Innere Sicherheit“ in diesem Kontext?
Innere Sicherheit umfasst den Schutz des Staates und der Bevölkerung vor Kriminalität, Terrorismus und verfassungsfeindlichen Bestrebungen.
Wie hat sich die Europäische Union nach 9/11 sicherheitspolitisch verändert?
Es kam zu einer verstärkten Europäisierung, also einer engeren grenzüberschreitenden Zusammenarbeit der EU-Mitgliedstaaten bei der Terrorfahndung und Grenzsicherung.
Welches Spannungsfeld entstand durch die neuen Sicherheitsgesetze?
Es entstand ein dauerhafter Konflikt zwischen dem Bedürfnis nach maximaler Sicherheit und dem Schutz der individuellen Freiheit und Bürgerrechte.
- Citar trabajo
- Michael André Ankermüller (Autor), 2011, Der 11. September 2001 und seine Auswirkungen auf die innere Sicherheit Deutschlands und der Europäischen Union, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/274527