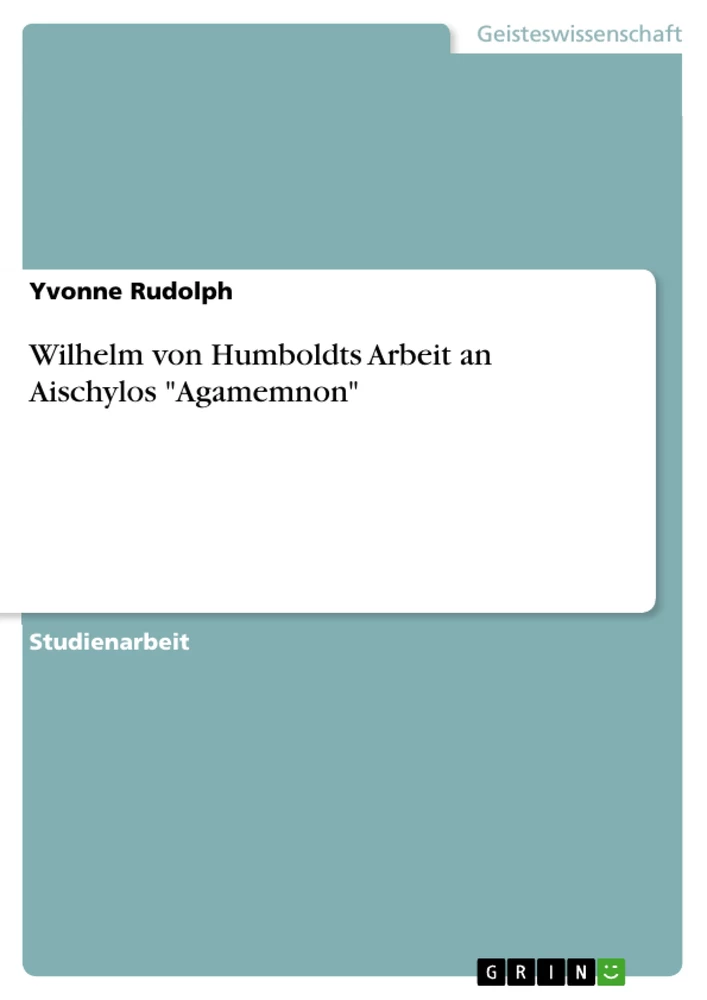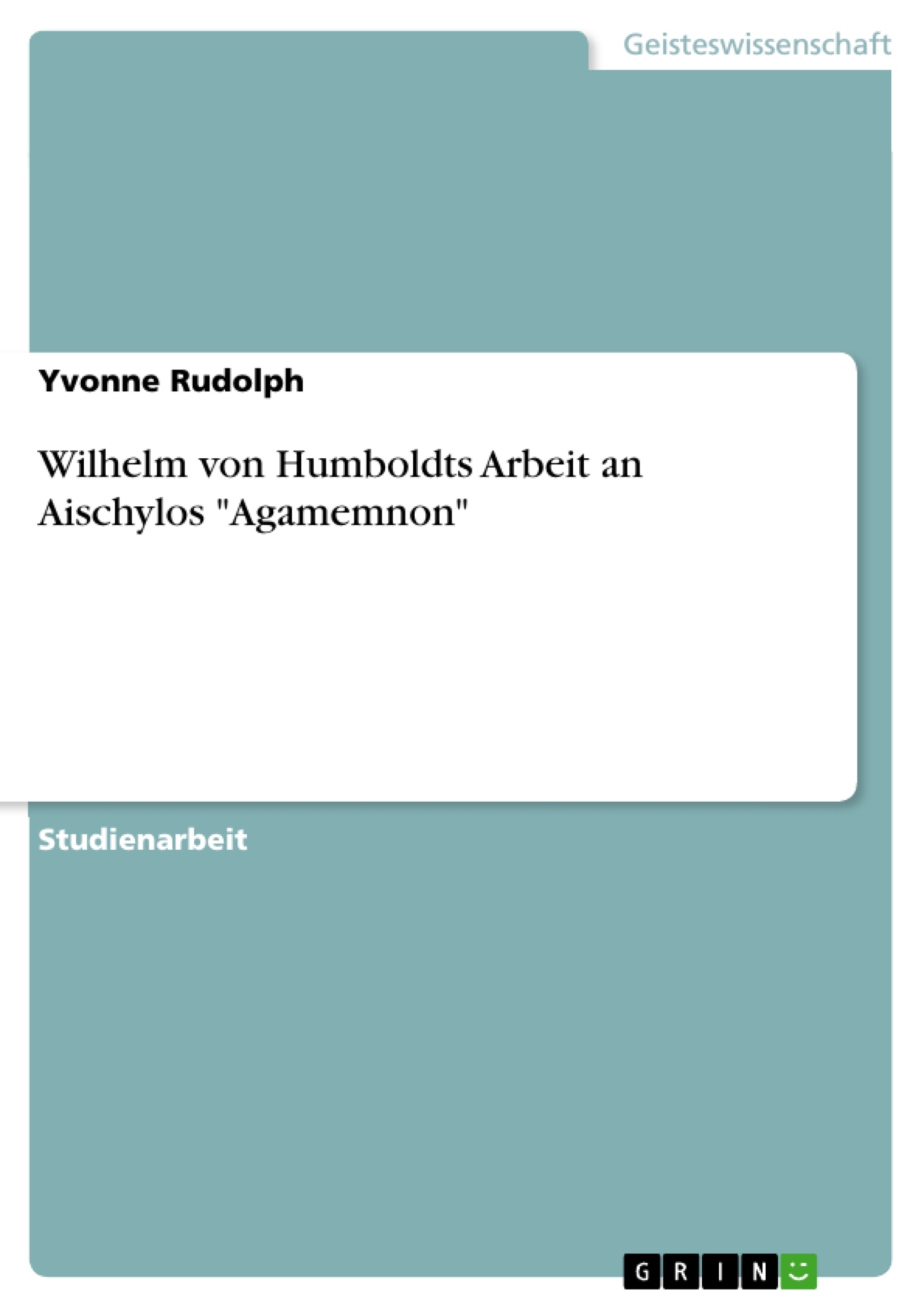In der vorliegenden Hausarbeit werden zunächst in einer Kurzbiographie die Eckdaten von Wilhelm von Humboldts Biographie genannt und ein kurzer Überblick über die Entstehungsgeschichte der Agamemnon-Übersetzung gegeben. Die inhaltliche Zielsetzung der Studie besteht darin, die Vorrede Humboldts wiederzugeben und die Maximen seiner Übersetzungstheorie darzustellen. In einem weiteren Schritt soll anhand ausgewählter Kategorien Stil, Integration des Fremden und Sprachgenauigkeit überprüft werden, inwiefern seine Maximen in der Agamemnon-Übersetzung realisiert wurden. Schließlich wird ein Textvergleich verschiedener Übersetzungen geschehen. Die erste und letzte Fassung Humboldts, die Agamemnon-Übersetzung J.J.C. Donners, Oscar Werners, sowie Peter Steins Orestie-Übersetzung sollen gegenübergestellt werden. Hierzu erfolgt teilweise eine Analyse der theoretischen, praktischen oder historischen Hintergründe, um zu erhellen welche Perspektive der jeweilige Übersetzer auf seine Arbeit gerichtet und nach welchen Kriterien er übersetzt hat. Die grundsätzlichen Hauptunterschiede im Übersetzungsdenken um 1800 und dem des 20.Jahrhunderts sollen exemplarisch anhand der Texte dargestellt werden. Abschließend soll kurz erläutert werden, welche Anforderungen die heutige Übersetzungspraxis an das Theater stellt.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Biographische Information zu Wilhelm von Humboldt
- Entstehungsgeschichte der Agamemnon-Übersetzung
- Die Einleitung zu Agamemnon oder: Humboldts Übersetzungsmaximen
- Vergleich der verschiedenen Übersetzungen des Prologs/ der Wächterszene und der Chorpartien
- Wilhelm von Humboldts älteste Fassung und die Druckversion von 1816
- J.J.C. Donners Agamemnon-Übersetzung von 1855
- Oskar Werner Agamemnon-Übersetzung von 1943
- Peter Steins Agamemnon-Übersetzung von 1980
- Abschließende Beobachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Hausarbeit befasst sich mit Wilhelm von Humboldts Übersetzung des „Agamemnon“ von Aischylos. Sie analysiert zunächst die biografischen Eckdaten von Humboldt und beleuchtet die Entstehungsgeschichte seiner Agamemnon-Übersetzung. Der Schwerpunkt liegt auf der Darstellung der Übersetzungstheorie Humboldts, die im Rahmen der Analyse seiner Einleitung zum „Agamemnon“ beleuchtet wird.
- Humboldts Übersetzungstheorie im Kontext seiner Agamemnon-Übersetzung
- Vergleich verschiedener Agamemnon-Übersetzungen hinsichtlich Stil, Integration des Fremden und Sprachgenauigkeit
- Untersuchung der theoretischen, praktischen und historischen Hintergründe der verschiedenen Übersetzungen
- Darstellung der grundlegenden Hauptunterschiede im Übersetzungsdenken um 1800 und im 20. Jahrhundert
- Anforderungen der heutigen Übersetzungspraxis am Theater
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung stellt die Zielsetzung der Arbeit vor und erläutert die methodischen Ansätze zur Analyse von Humboldts Agamemnon-Übersetzung.
- Biographische Information zu Wilhelm von Humboldt: Dieses Kapitel gibt einen Überblick über Humboldts Leben, seine akademischen Stationen und seine Rolle in der deutschen Bildungspolitik.
- Entstehungsgeschichte der Agamemnon-Übersetzung: Das Kapitel beleuchtet den Entstehungsprozess der Übersetzung, die Einflussnahme von bedeutenden Persönlichkeiten wie Wolf, Schiller, Goethe und den Gebrüdern Schlegel, sowie die Herausforderungen, die Humboldt im Laufe der Übersetzung bewältigen musste.
- Die Einleitung zu Agamemnon oder: Humboldts Übersetzungsmaximen: Dieses Kapitel analysiert Humboldts Einleitung zum „Agamemnon“ und zeigt seine zentralen Übersetzungsmaximen auf. Es wird insbesondere auf Humboldts Verständnis von Aischylos’ Tragödie und die Rolle des Schicksals in der Handlung eingegangen.
- Vergleich der verschiedenen Übersetzungen des Prologs/der Wächterszene und der Chorpartien: In diesem Kapitel werden verschiedene Übersetzungen des Agamemnon, darunter Humboldts eigene Fassungen, Donners, Werners und Steins Übersetzung, miteinander verglichen. Es wird auf die unterschiedlichen Ansätze der Übersetzer im Hinblick auf Stil, Sprachgenauigkeit und Integration des Fremden eingegangen.
Schlüsselwörter
Die Arbeit konzentriert sich auf die Übersetzung von Aischylos' „Agamemnon" durch Wilhelm von Humboldt. Zentral sind Themen wie Übersetzungstheorie, Sprachvergleich, Stilistik, Integration des Fremden, Textanalyse und die Darstellung des Übersetzungsdenkens im Kontext des 19. und 20. Jahrhunderts. Darüber hinaus werden wichtige Persönlichkeiten wie Wolf, Schiller, Goethe, die Gebrüder Schlegel, Donner, Werner und Stein sowie die Friedrich-Wilhelms-Universität Berlin und das neuhumanistische Gymnasium in Preußen erwähnt.
- Citation du texte
- Magistra artium Yvonne Rudolph (Auteur), 2003, Wilhelm von Humboldts Arbeit an Aischylos "Agamemnon", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/27530