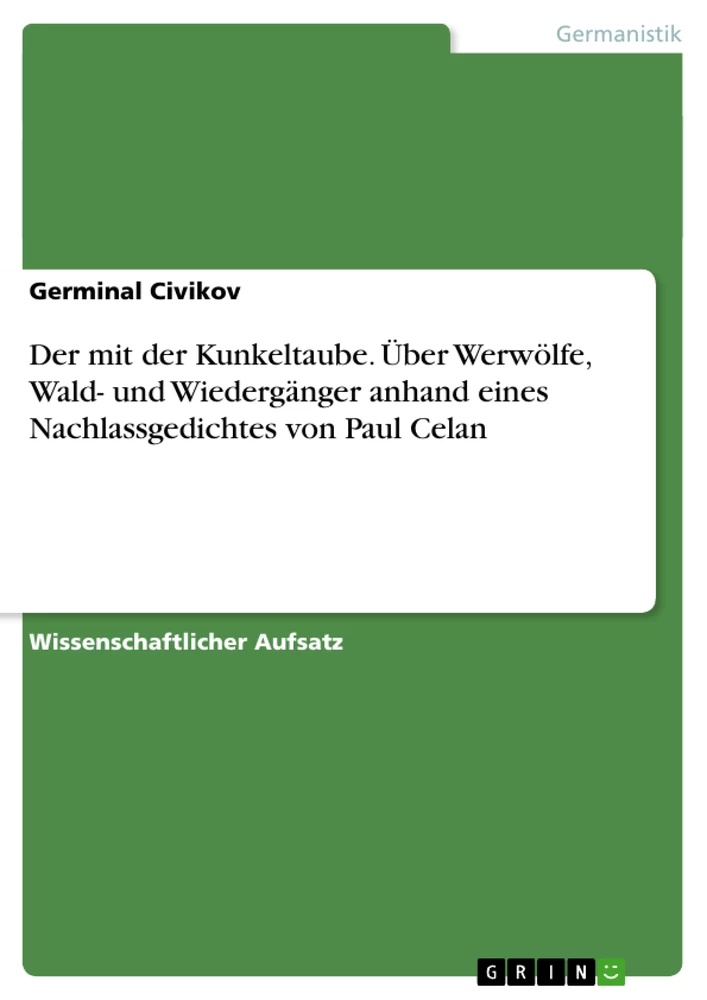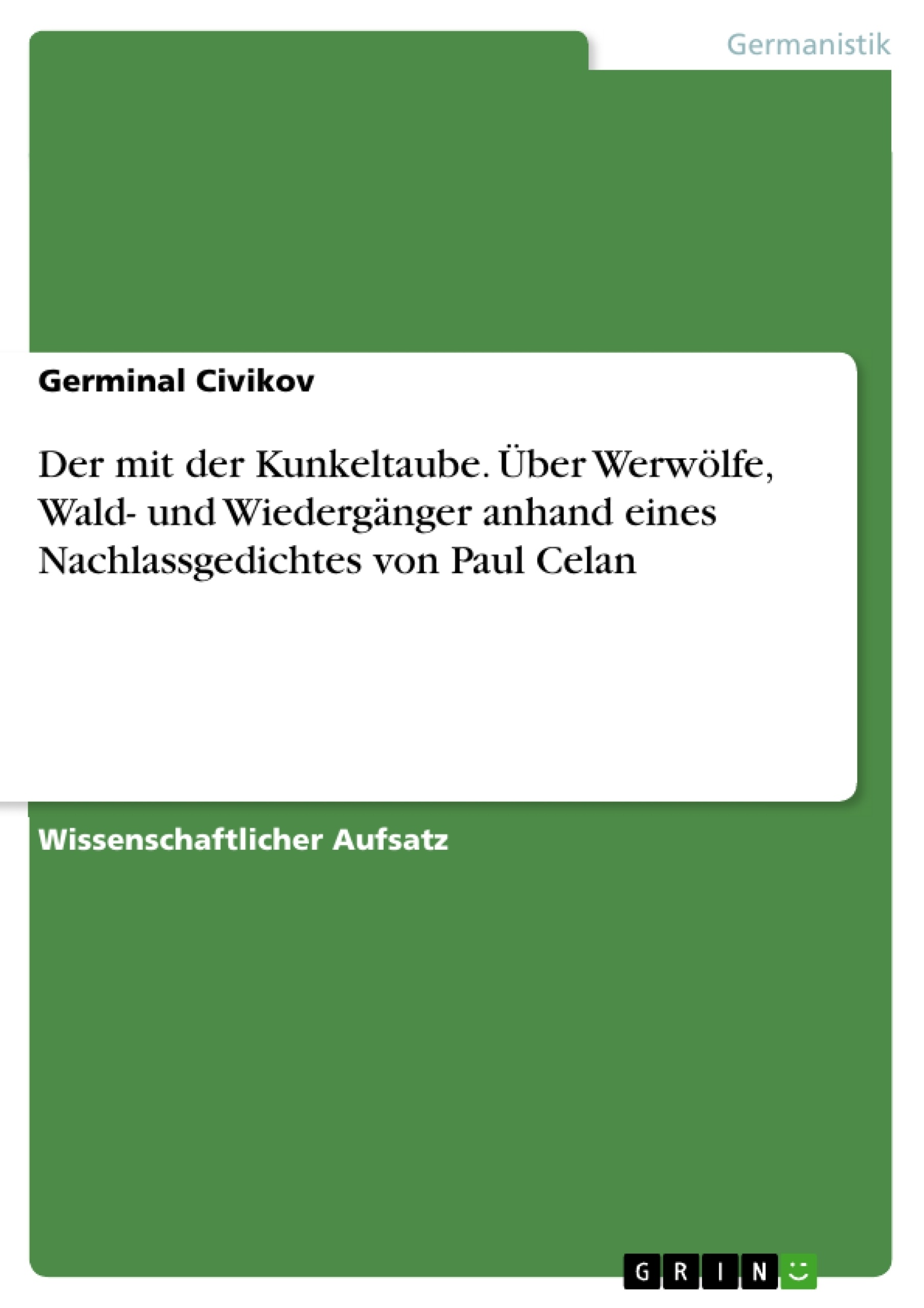Ein Brief von Paul Celan an Ernst Jünger erregte 2005 die Gemüter. Der 1951 noch unbekannte deutschsprachige Dichter hatte aus Paris dem prominenten deutschnationalen „Anarchen“ in Wilflingen geschrieben und ihm eine Auswahl seiner Gedichte vorgelegt. Bei seinen Forschungen im Jünger-Archiv hat der Publizist Tobias Wimbauer den Brief entdeckt und in der Frankfurter Allgemeine Zeitung wirkungsgerecht unter dem Titel „In Dankbarkeit und Verehrung“ publiziert. So lautet nämlich die Abschiedsformel dieses Briefes vom 11. Juni 1951, in dem Celan um Jüngers Aufmerksamkeit und Unterstützung wirbt. Anhand des Briefes widersprach Wimbauer der Auffassung, Celan habe mit Jünger „Probleme“ gehabt und sein Verhalten im Krieg missbilligt. Ähnliche „Mutmaßungen“ des Celan-Biographen John Felstiner und der Celan-Editorin Barbara Wiedemann fand Wimbauer nun durch diesen Brief ausgeräumt. Vielmehr habe sich Ernst Jünger zu Zeiten des Dritten Reiches untadelig verhalten und Celan habe es vermutlich ihm zu verdanken, dass die Deutsche Verlagsanstalt 1952 „Mohn und Gedächtnis“ gedruckt hat. „Hilfe kommt aus Wilflingen“, lautet denn auch der Untertitel des Artikels. Damit löste Wimbauer eine heftige Debatte aus, die hauptsächlich in der FAZ ausgetragen wurde.
Inhaltsverzeichnis
- Germinal Civikov Der mit der Kunkeltaube. Über Werwölfe, Wald- und Widergänger anhand eines Nachlassgedichtes von Paul Celan
- SIGLEN OFT ZITIERTER WERKE
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit untersucht die komplexe Beziehung zwischen Paul Celan und Ernst Jünger anhand eines Nachlassgedichts von Celan, „Mit der Kunkeltaube". Der Text analysiert den Briefwechsel zwischen Celan und Jünger sowie die Reaktionen auf diesen Briefwechsel, um die Ambivalenz und Spannung in Celans Verhältnis zu Jünger aufzuzeigen.
- Celans Brief an Ernst Jünger und die Reaktionen darauf
- Die Rolle des „Zivilisationsjuden" in Jüngers Werk
- Celans Auseinandersetzung mit dem Antisemitismus in der deutschen Nachkriegsliteratur
- Die Gestalt des Werwolfs als Symbol der Ambivalenz und des Widergängers
- Die poetologische Bedeutung der „Atemwende" in Celans Werk
Zusammenfassung der Kapitel
- Germinal Civikov
Der mit der Kunkeltaube. Über Werwölfe, Wald- und Widergänger anhand eines Nachlassgedichtes von Paul Celan
- Der Briefwechsel zwischen Celan und Jünger: Ein Brief von Celan an Ernst Jünger aus dem Jahr 1951 erregte im Jahr 2005 großes Aufsehen. Der Brief, in dem Celan um Jüngers Aufmerksamkeit und Unterstützung wirbt, wurde von Tobias Wimbauer im Jünger-Archiv entdeckt und in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung veröffentlicht.
- Die Interpretationen des Briefes: Wimbauers Interpretation des Briefes, die Celans vermeintliche Unversöhnlichkeit gegenüber Jünger in Frage stellt, löste eine kontroverse Debatte aus. Jean Bollack interpretierte den Brief als ein akribisches Maskenspiel, in dem Celan alles tut, um Jüngers Unterstützung anzunehmen, ohne zu lügen. Theo Buck hingegen kritisierte Bollacks Interpretation und stellte die Hintergründe des Briefes in ein anderes Licht.
- Die jüdische Herkunft Celans: Der Briefwechsel zeigt, dass Celans Freund Klaus Demus, der Celan dazu ermutigte, sich an Jünger zu wenden, Celans jüdische Herkunft gegenüber Jünger verschwieg. Celans jüdische Herkunft wurde in der Nachkriegsliteratur oft verschwiegen oder verharmlost, was Celan selbst jedoch nicht störte.
- Jüngers Antisemitismus: Ernst Jüngers Artikel „Über Nationalismus und Judenfrage" aus dem Jahr 1930 zeigt seine antisemitische Haltung. Jünger betrachtet den assimilierten Juden als „Zivilisationsjuden", der sich als Deutscher mimt und für die deutsche Gestalt gefährlich sein kann.
- Celans Gedicht „Mit der Friedenstaube": Das Gedicht, das vermutlich Ende August 1962 entstand, verweist deutlich auf Jüngers Essays „Der Friede" und „Der Waldgang". Die Friedenstaube, mit der der Werwolf im Gedicht daherkommt, steht im Kontrast zu seiner Gestalt als Waldgänger und Widergänger.
- Die Interpretation des Werwolfs: Der Werwolf im Gedicht ist eine komplexe Gestalt, die sich aus verschiedenen mythologischen Figuren zusammensetzt. Er ist ein Waldgänger, ein Widergänger und ein Werwolf, der mit der Friedenstaube daherkommt.
- Die Bedeutung der Friedenstaube: Die Friedenstaube im Gedicht ist ein Symbol der Friedensbotschaft, die der Werwolf verkündet. Sie steht aber auch im Kontrast zu seiner Gestalt als Waldgänger und Widergänger, die eher mit Krieg und Gewalt assoziiert werden.
- Die Gestalt des Werwolfs als Symbol der Ambivalenz: Der Werwolf mit der Friedenstaube steht für die Ambivalenz, die Celan in seinem Verhältnis zu Jünger empfand. Er ist gleichzeitig ein Freund und ein Feind, ein Friedensbote und ein Widergänger.
- Die „Infamie" der Goll-Affäre: Die Goll-Affäre, in der Celan Plagiat vorgeworfen wurde, war für ihn eine erniedrigende und schmerzhafte Erfahrung. Die Affäre brachte auch antisemitische Denkmuster und Klischees zutage, die Celan besonders empfindlich traf.
- Die Freundschaft mit Rolf Schroers: Celans Freundschaft mit Rolf Schroers zerbrach an Schroers' Versuch, das „Jüdische" zu definieren und zu unterscheiden. Schroers' antisemitische Denkweise, die sich in seinem Buch „Der Partisan '38" deutlich zeigt, war für Celan unerträglich.
- Der Einfluss von Jünger und Schmitt: Celans Gedicht „Mit der Friedenstaube" verweist auf die Denkweisen von Jünger und Schmitt, die den Juden als „wahren Feind" oder als „Zivilisationsjuden" betrachteten.
- Die „Atemwende" in Celans Werk: Celans Gedicht „Die Wende" ist ein poetologisches Gedicht, das eine sprachliche und psychische Wende ankündigt. Die Sprache, die im Gedicht „Weggeben" aus dem Band „Atemwende" ihren Ausdruck findet, ist eine neue, radikale Sprache, die sich von der Sprache der Vergangenheit emanzipiert.
- SIGLEN OFT ZITIERTER WERKE
- GA - Barbara Wiedemann: Die Goll-Affäre Dokumente einer »Infamie«. Suhrkamp, Ffin. 2000.
- HKA — Paul Celan: Historisch-kritische Ausgabe. Hg. v. der Bonner Arbeitsstelle fiir die Celan-Ausgabe. Suhrkamp, Ffin. 1990 - 2006.
- PC/GN - Paul Celan: Die Gedichte aus dem Nachlass. Hg. v. Bertrand Badiou, Jean-Claude-Rambach u. Barbara Wiedemann. Suhrkamp, Ffin. 1997.
- PC/GCL - Paul Celan - Giséle Celan-Lestrange: Briefwechsel. Hrsg. u. komment. v. Bettrand Badiou in Verbind. m. Eric Celan. Mit einer Ausuahl von Briefen Paul Celans an seinen Sohn Eric. Aus d. Französ. v. Eugen Helmle. Anmerk. übertr. u. einger. v. Barbara Wiedemann. Suhrkamp, Ffin. 2001
- PC/KND - Paul Celan — Klaus und Nani Demus: Briefwechsel. Mit einer Auswahl aus dem Briefwechsel zwischen Giséle Celan-Lestrange und Klaus und Nani Demus. Hg.v. Joachim Seng. Suhrkamp, Ffin. 2009.
- PCM - Paul Celan: Der Meridian. Endfassung — Entuürfe — Materialien. Hg. v. Bernhard Böschenstein u. Heino Schmull, unter Mitarbeit v. Michael Schwarzkopf u. Christiane Wittkop. Tübinger Ausgabe, Suhrkamp, Ffin.1999.
- Mikrolithen - Paul Celan: > Mikrolithen sinds, Steinchen c. Die Prosa aus dem Nachlaß. Kritische Ausgabe. Hg. v. Barbara Wiedemann u. Bertrand Badiou. Suhrkamp, Ffin. 2005.
- RF - Paul Celan - Heinrich Böll, Paul Schallück, Rolf Schroers. Briefwechsel mit den rheinischen Freunden, Hg. von Barbara Wiedemann. Suhrkamp, Berlin 2011.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen Paul Celan, Ernst Jünger, Nachlassgedicht, „Mit der Kunkeltaube", Briefwechsel, Antisemitismus, „Zivilisationsjude", Werwolf, Waldgänger, Widergänger, „Atemwende", Goll-Affäre, Rolf Schroers, Carl Schmitt, deutsche Nachkriegsliteratur, poetologie.
Häufig gestellte Fragen
Welche Beziehung hatten Paul Celan und Ernst Jünger?
Die Beziehung war hochkomplex und ambivalent; Celan suchte 1951 Jüngers Unterstützung, setzte sich aber später kritisch mit Jüngers Werk und dessen antisemitischer Vergangenheit auseinander.
Was löste die Debatte um Celans Brief an Jünger aus?
Die Entdeckung eines Briefes von 1951, in dem Celan Jünger „Dankbarkeit und Verehrung“ aussprach, was die bisherige Sicht auf Celans Ablehnung Jüngers in Frage stellte.
Was symbolisiert der Werwolf in Celans Gedicht?
Der Werwolf ist eine komplexe Figur der Ambivalenz, ein „Wiedergänger“, der gleichzeitig Friedensbotschaften (Friedenstaube) und die Schrecken der Vergangenheit verkörpert.
Was war die Goll-Affäre?
Eine Kampagne, in der Celan fälschlicherweise des Plagiats bezichtigt wurde, was für ihn eine traumatische Erfahrung mit antisemitischen Untertönen war.
Was bedeutet der Begriff „Atemwende“ bei Celan?
Es bezeichnet eine radikale sprachliche und psychische Wende in Celans Werk hin zu einer neuen, kargen und wahrhaftigen Poesie.
- Citation du texte
- Germinal Civikov (Auteur), 2014, Der mit der Kunkeltaube. Über Werwölfe, Wald- und Wiedergänger anhand eines Nachlassgedichtes von Paul Celan, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/275497