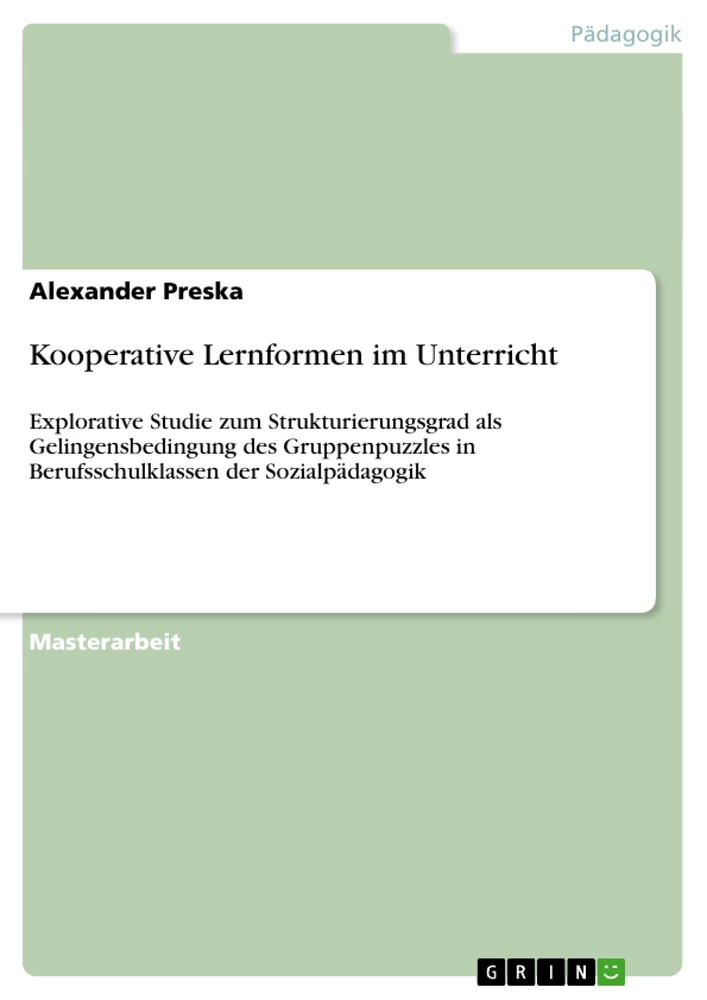„Gruppenarbeit? Nein Danke.“ Negativ erlebte Phänomene herkömmlicher Gruppenarbeiten erscheinen vielfältig (Renkl 2007) und erstrecken sich von allgemeiner Ablehnung, über nicht ausreichend verstandene Arbeitsaufträge bis hin zu populären Effekten, wie beispielsweise dem „sucker- oder free-rider-Effekt“ nach SALOMON & GLOBERSON (1989). Auf Lehrerseite werden solche, in der Praxis gefürchtete, dennoch bekannte, Phänomene durchaus wahrgenommen und beklagt (Götz 2005).
Eine äußerst erfolgversprechende Lernform, um diesen Effekten entgegenzuwirken, stellen die kooperativen Lernformen dar. Die vornehmlich im amerikanischen Sprachraum rezipierten Hinweise zur Wirksamkeit kooperativer Lernformen betonen soziale Fähigkeiten. Doch um einer kritischen Betrachtung standhalten und konkurrieren zu, wächst die Frage nach der Effektivität. Jüngst wurde diese Debatte im Rahmen der Hattie-Studie verschärft.
Eine beliebte und von einschlägigen Schulbuchverlagen empfohlene Methode ist die des Gruppenpuzzles. Empirische Erkenntnisse verweisen jedoch auf eine Notwendigkeit der Lehrkraft als Professional zur Einführung von Inhalten (Wellenreuther 2012). Brisanterweise wäre dementsprechend das oft als Grundprinzip des kooperativen Lernens beschriebene „Think, Pair, Share“ nach BRÜNING & SAUM (2009) empirisch gesehen wenig wirksam, insbesondere im Hinblick auf die Methode des Gruppenpuzzles. Dementsprechend stellt sich die Frage nach Verbesserungsmöglichkeiten, die sich aus einer stärkeren Strukturierung ergeben. So könnten klare Arbeitsanweisungen und Fragen zum Inhalt zu einem höheren Elaborationsniveau führen (Hänze 2008) und einer Überforderung der Lernenden, insbesondere einer oberflächlichen Bearbeitung (Cohen 1994), entgegenkommen. Ebenfalls dem oft geäußerten Wunsch nach mehr Anleitung und Struktur (Kraft 2001) könnte entsprochen werden.
Die Arbeit gibt einen Überblick über zentrale Bedingungen für das Gelingen kooperativer Lernformen. Dabei wird ein umfassender Überblick über den empirischen Forschungsstand gegeben, die theoretischen Grundannahmen zur Lernwirksamkeit diskutiert und die Methode des Gruppenpuzzles anhand dieser kritisch reflektiert.
Zuletzt soll anhand einer quasi-experimentellen Interventionsstudie mit Kontrollgruppe (mit Pre- und Posttest) explorativ geprüft werden, ob sich eine stärkere Strukturierung auf die Methode auswirkt.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2 Theoretischer Teil
- 2.1 Der Gruppenunterricht: Verbreitung und Effektivität
- 2.1.1 Die Theorie der subjektiven Imperative
- 2.2 Das kooperative Lernen
- 2.2.1 Theoretische Grundannahmen zur Lernwirksamkeit
- 2.2.1.1 Neue Ansätze zum Lernen und Lehren
- 2.2.1.2 Die motivationale Perspektive
- 2.2.1.3 Die kognitive Perspektive
- 2.2.2 Empirischer Forschungsstand
- 2.3 Das selbstorganisierte Lernen (SOL)
- 2.4 Das Gruppenpuzzle (Jigsaw)
- 2.4.1 Das Gruppenpuzzle mit unmittelbar abschließendem Test
- 2.4.2 Das Gruppenpuzzle mit einer Kontroll- bzw. Evaluationsphase
- 2.4.3 Das Gruppenpuzzle ohne eine weitere, abschließende Phase
- 2.4.4 Das Gruppenpuzzle unter der Prämisse des SOL
- 2.5 Die Bedeutung der Struktur
- 2.6 Der Einfluss des kognitiven Orientierungsstils
- 3 Fragestellung und Hypothesen
- 4 Methodischer Teil
- 5 Ergebnisse
- 5.1 Überprüfung der Hypothesen
- 5.2 Ergebnisse weiterer Fragestellungen
- 5.3 Zusammenfassung der Ergebnisse
- 6 Diskussion
- 7 Fazit und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht die Effektivität kooperativer Lernformen, insbesondere des Gruppenpuzzles, im Berufsschulunterricht der Sozialpädagogik. Ziel ist es, den Einfluss des Strukturierungsgrades auf den Lernerfolg zu analysieren und Verbesserungsmöglichkeiten aufzuzeigen.
- Effektivität kooperativer Lernformen im Vergleich zu traditionellen Methoden
- Der Einfluss des Strukturierungsgrades auf den Lernerfolg beim Gruppenpuzzle
- Die Rolle der Lehrkraft bei der Gestaltung und Umsetzung kooperativer Lernformen
- Motivationale und kognitive Aspekte des kooperativen Lernens
- Verbesserungsmöglichkeiten des Gruppenpuzzles
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung stellt das Problem negativer Erfahrungen mit Gruppenarbeit sowohl bei Schülern als auch Lehrern dar und führt in die Thematik kooperativer Lernformen ein. Sie betont die zunehmende Popularität kooperativer Lernformen, insbesondere des Gruppenpuzzles, und deren vielversprechende Effekte. Gleichzeitig werden kritische Stimmen und die Ergebnisse der Hattie-Studie erwähnt, die die Effektivität kooperativer Lernformen in Frage stellen. Die Einleitung endet mit der Problematik des Gruppenpuzzles und der Notwendigkeit, diese Methode zu verbessern.
2 Theoretischer Teil: Dieser Teil beleuchtet den theoretischen Hintergrund des Gruppenunterrichts und des kooperativen Lernens. Es werden verschiedene Theorien und Ansätze diskutiert, darunter die Theorie der subjektiven Imperative, motivationale und kognitive Perspektiven, sowie empirische Forschungsstände. Der Fokus liegt auf dem selbstorganisierten Lernen (SOL) und dem Gruppenpuzzle (Jigsaw) in seinen verschiedenen Ausprägungen. Die Bedeutung von Struktur und der Einfluss des kognitiven Orientierungsstils werden ebenfalls behandelt, um die Basis für die empirische Untersuchung zu legen.
3 Fragestellung und Hypothesen: Dieses Kapitel formuliert die zentrale Forschungsfrage der Arbeit und leitet daraus konkrete Hypothesen ab. Die Fragestellung konzentriert sich auf den Zusammenhang zwischen dem Strukturierungsgrad des Gruppenpuzzles und dem Lernerfolg. Die Hypothesen geben präzise Vorhersagen über den zu erwartenden Einfluss der Strukturierung auf verschiedene Aspekte des Lernprozesses an.
4 Methodischer Teil: Dieser Teil beschreibt die Methodik der empirischen Untersuchung. Das Untersuchungsdesign, die Unterrichtsreihe, die verwendeten Instrumente, die Stichprobe und die Auswertungsstrategie werden detailliert dargestellt. Die Beschreibung der Methodik soll die Nachvollziehbarkeit und Reproduzierbarkeit der Studie gewährleisten.
5 Ergebnisse: Das Kapitel präsentiert die Ergebnisse der empirischen Untersuchung. Es beginnt mit der Überprüfung der aufgestellten Hypothesen und analysiert die Ergebnisse im Detail. Darüber hinaus werden Ergebnisse zu weiteren Forschungsfragen dargestellt. Eine umfassende Zusammenfassung der Ergebnisse bildet den Abschluss dieses Kapitels und leitet zur Diskussion über.
6 Diskussion: Dieses Kapitel ist für diese Vorschau nicht enthalten um Spoiler zu vermeiden.
Schlüsselwörter
Kooperatives Lernen, Gruppenpuzzle (Jigsaw), Strukturierung, Lernwirksamkeit, Berufsschule, Sozialpädagogik, Empirische Studie, Gruppenarbeit, Selbstorganisiertes Lernen (SOL), kognitiver Orientierungsstil.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Arbeit: Effektivität kooperativer Lernformen, insbesondere des Gruppenpuzzles, im Berufsschulunterricht der Sozialpädagogik
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die Effektivität kooperativer Lernformen, insbesondere des Gruppenpuzzles (Jigsaw), im Berufsschulunterricht der Sozialpädagogik. Der Fokus liegt auf dem Einfluss des Strukturierungsgrades des Gruppenpuzzles auf den Lernerfolg.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt verschiedene Aspekte des kooperativen Lernens, darunter die Theorie des Gruppenunterrichts, verschiedene kooperative Lernmethoden (z.B. selbstorganisiertes Lernen (SOL)), motivationale und kognitive Perspektiven auf Lernen, die Rolle der Lehrkraft und die Bedeutung der Strukturierung bei kooperativen Lernformen. Ein Schwerpunkt liegt auf der Analyse des Gruppenpuzzles in verschiedenen Varianten (mit und ohne abschliessende Testphase, unter der Prämisse von SOL).
Welche Forschungsfrage wird gestellt?
Die zentrale Forschungsfrage untersucht den Zusammenhang zwischen dem Strukturierungsgrad des Gruppenpuzzles und dem Lernerfolg der Schüler. Konkrete Hypothesen werden formuliert, um diesen Zusammenhang zu überprüfen.
Welche Methode wurde angewendet?
Die Arbeit verwendet ein empirisches Untersuchungsdesign. Der methodische Teil beschreibt detailliert das Untersuchungsdesign, die Unterrichtsreihe, die verwendeten Messinstrumente, die Stichprobe und die statistische Auswertungsstrategie. Die Beschreibung soll die Nachvollziehbarkeit und Reproduzierbarkeit der Studie gewährleisten.
Welche Ergebnisse werden präsentiert?
Das Kapitel "Ergebnisse" präsentiert die Ergebnisse der empirischen Untersuchung. Es beinhaltet die Überprüfung der aufgestellten Hypothesen, eine detaillierte Analyse der Ergebnisse und eine Zusammenfassung der wichtigsten Befunde. Zusätzliche Ergebnisse zu weiteren Forschungsfragen werden ebenfalls dargestellt.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit ist in folgende Kapitel gegliedert: Einleitung, Theoretischer Teil (mit Unterkapiteln zu Gruppenunterricht, kooperativem Lernen, SOL, Gruppenpuzzle und dem Einfluss kognitiver Orientierungsstile), Fragestellung und Hypothesen, Methodischer Teil, Ergebnisse (mit Unterkapiteln zur Hypothesenprüfung, weiteren Ergebnissen und Zusammenfassung), Diskussion und Fazit/Ausblick.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Kooperatives Lernen, Gruppenpuzzle (Jigsaw), Strukturierung, Lernwirksamkeit, Berufsschule, Sozialpädagogik, Empirische Studie, Gruppenarbeit, Selbstorganisiertes Lernen (SOL), kognitiver Orientierungsstil.
Welche Ziele werden verfolgt?
Die Arbeit zielt darauf ab, die Effektivität kooperativer Lernformen im Vergleich zu traditionellen Methoden zu analysieren, den Einfluss des Strukturierungsgrades auf den Lernerfolg beim Gruppenpuzzle zu untersuchen, die Rolle der Lehrkraft zu beleuchten, motivationale und kognitive Aspekte des kooperativen Lernens zu berücksichtigen und Verbesserungsmöglichkeiten des Gruppenpuzzles aufzuzeigen.
- Arbeit zitieren
- Bachelor of Arts Alexander Preska (Autor:in), 2014, Kooperative Lernformen im Unterricht, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/275584