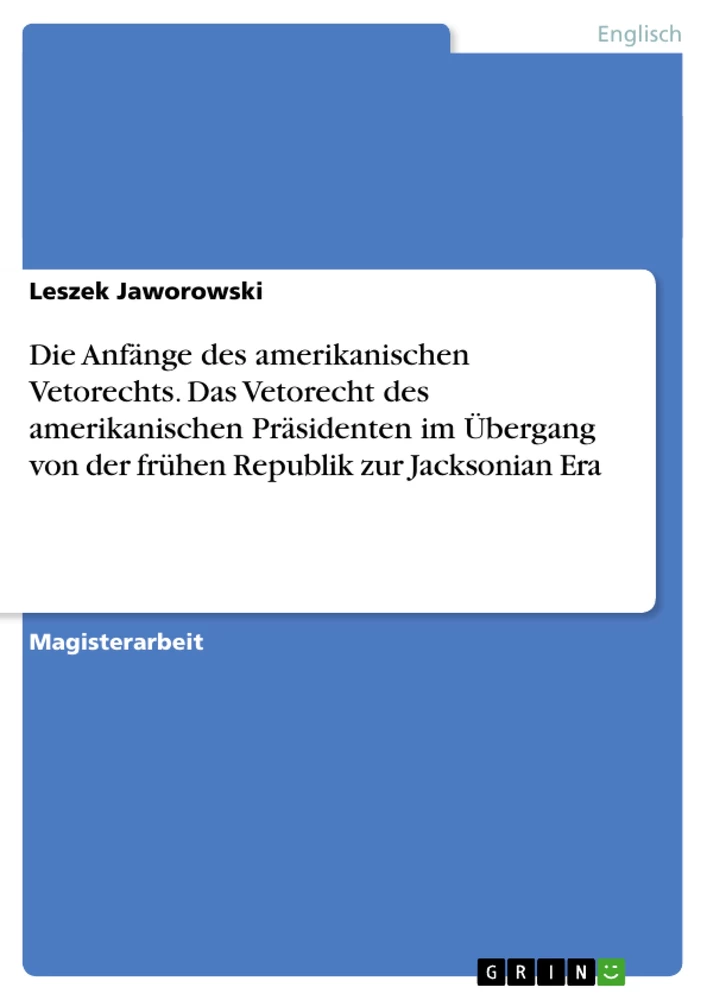Die Entstehung der amerikanischen Verfassung war gleichzeitig die Auferstehung des Vetorechts auf der Ebene des Präsidenten und natürlich die Einrichtung dieses hohen Amtes. Wie viel Macht der Präsident haben sollte, war eine der zentralen Fragen bei der Ausarbeitung des Verfassungsentwurfes. Dabei tauchte immer wieder die grundsätzliche Frage auf, ob ein Staatsoberhaupt erfahrener sein kann als andere hohe Politiker, um auf vernünftige Weise von einem absoluten oder qualifizierten Veto Gebrauch machen zu können.
Die Magisterarbeit ist in einen allgemeinen und einen historisch-staatswissenschaftlichen Teil untergliedert. Im allgemeinen Teil wird das Veto des amerikanischen Präsidenten als solches vorgestellt und beschrieben. Im historisch-staatswissenschaftlichen Teil werden die Vetos der Präsidenten von George Washington bis einschließlich Andrew Jackson analysiert.
Inhaltsverzeichnis
- A. Kategorisierung, Begriffsdefinitionen, rechtliche Bestimmungen, Herangehensweise an die Thematik des Vetorechts
- I. Historische Heranführung an das Vetorecht des Präsidenten
- II. Die Verankerung des Vetorechts in der Verfassung
- III. Gerichtsurteile und Vorgangsbestimmungen im Rahmen der reconsideration
- IV. Fragestellungen, Hauptthese und Methodik der Arbeit
- B. Das Veto als Instrument zur Errichtung einer starken Exekutive in der frühen Republik
- I. George Washington: Hüter der Verfassung
- II. Die Nullrunden von John Adams und Thomas Jefferson
- III. James Madison: erster Vetoschmied
- IV. James Monroes Veto: Initiator zukünftiger Vetos gegen Infrastrukturmaßnahmen
- V. Die Nullrunde von John Quincy Adams
- VI. Andrew Jackson
- C. Die Pflicht der Einmischung in die Legislative
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht das Vetorecht des amerikanischen Präsidenten im Übergang von der frühen Republik zur Jacksonian Era. Ziel ist es, die Entwicklung und Funktion des Vetorechts in diesem Zeitraum zu analysieren und dessen Bedeutung für die Stärkung der Exekutive zu beleuchten.
- Die historische Entwicklung des Vetorechts in den amerikanischen Kolonien und der frühen Republik.
- Die Verankerung des Vetorechts in der Verfassung und seine rechtlichen Bestimmungen.
- Die Anwendung des Vetorechts durch verschiedene Präsidenten der frühen Republik.
- Der Einfluss des Vetorechts auf die Machtbalance zwischen Exekutive und Legislative.
- Die Rolle des Vetorechts in der Stärkung der Präsidentschaft.
Zusammenfassung der Kapitel
A. Kategorisierung, Begriffsdefinitionen, rechtliche Bestimmungen, Herangehensweise an die Thematik des Vetorechts: Dieses Kapitel legt den methodologischen und konzeptionellen Rahmen der Arbeit fest. Es untersucht die historische Entwicklung des Vetorechts, beginnend mit den kolonialen Gouverneuren und der Konföderation, bis hin zur Verankerung in der Verfassung. Es werden verschiedene Interpretationen des Vetorechts beleuchtet und die Unterschiede zum englischen Recht herausgestellt. Der Fokus liegt auf der Klärung der Begrifflichkeiten und der rechtlichen Grundlagen, um die nachfolgende Analyse des Präsidentenvetos fundiert zu gestalten. Das Kapitel bereitet den Boden für die Untersuchung der Rolle des Vetos als Instrument der Exekutive.
B. Das Veto als Instrument zur Errichtung einer starken Exekutive in der frühen Republik: Dieses Kapitel analysiert die Anwendung des Vetorechts durch verschiedene Präsidenten der frühen Republik, von George Washington bis Andrew Jackson. Es untersucht, wie das Veto als Instrument zur Stärkung der Exekutive eingesetzt wurde und welche politischen und ideologischen Faktoren dabei eine Rolle spielten. Jedes Präsidentenamt wird einzeln beleuchtet, wobei die Häufigkeit und der Kontext der Vetos, sowie deren Auswirkungen auf die Gesetzgebung, untersucht werden. Das Kapitel zeigt auf, wie das Veto sich als ein wichtiges Mittel der Präsidentschaft zur Durchsetzung der politischen Agenda entwickelte.
Schlüsselwörter
Vetorecht, amerikanischer Präsident, frühe Republik, Jacksonian Era, Verfassung, Exekutive, Legislative, Machtbalance, politische Geschichte, Präsidentschaft, George Washington, John Adams, Thomas Jefferson, James Madison, James Monroe, John Quincy Adams, Andrew Jackson.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Arbeit: Das Vetorecht des amerikanischen Präsidenten im Übergang von der frühen Republik zur Jacksonian Era
Was ist der Gegenstand der Arbeit?
Die Arbeit analysiert das Vetorecht des amerikanischen Präsidenten im Zeitraum vom Beginn der frühen Republik bis zur Jacksonian Era. Sie untersucht die Entwicklung und Funktion des Vetorechts in diesem Zeitraum und dessen Bedeutung für die Stärkung der Exekutive.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die historische Entwicklung des Vetorechts, seine Verankerung in der Verfassung und die rechtlichen Bestimmungen. Sie untersucht die Anwendung des Vetorechts durch verschiedene Präsidenten (Washington, Adams, Jefferson, Madison, Monroe, Quincy Adams, Jackson), den Einfluss auf die Machtbalance zwischen Exekutive und Legislative und die Rolle des Vetorechts bei der Stärkung der Präsidentschaft.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in drei Hauptteile: A) Kategorisierung, Begriffsdefinitionen, rechtliche Bestimmungen und Methodik; B) Das Veto als Instrument zur Errichtung einer starken Exekutive in der frühen Republik (inkl. detaillierter Betrachtung der jeweiligen Präsidenten); und C) Die Pflicht der Einmischung in die Legislative. Jedes Kapitel enthält eine Zusammenfassung.
Welche Methodik wird angewendet?
Die Arbeit legt zunächst einen methodologischen und konzeptionellen Rahmen fest, in dem sie die historische Entwicklung des Vetorechts von den kolonialen Gouverneuren bis zur Verfassung beleuchtet. Sie klärt Begrifflichkeiten und rechtliche Grundlagen, um die Analyse des Präsidentenvetos fundiert zu gestalten.
Welche Präsidenten werden im Detail untersucht?
Die Arbeit analysiert die Anwendung des Vetorechts durch George Washington, John Adams, Thomas Jefferson, James Madison, James Monroe, John Quincy Adams und Andrew Jackson. Dabei werden die Häufigkeit und der Kontext der Vetos sowie deren Auswirkungen auf die Gesetzgebung untersucht.
Welche Schlussfolgerungen werden gezogen?
Die Arbeit zeigt auf, wie sich das Veto als wichtiges Mittel der Präsidentschaft zur Durchsetzung der politischen Agenda entwickelte und wie es zur Stärkung der Exekutive beitrug. Die genauen Schlussfolgerungen ergeben sich aus der detaillierten Analyse der einzelnen Kapitel.
Welche Schlüsselwörter sind relevant?
Vetorecht, amerikanischer Präsident, frühe Republik, Jacksonian Era, Verfassung, Exekutive, Legislative, Machtbalance, politische Geschichte, Präsidentschaft, George Washington, John Adams, Thomas Jefferson, James Madison, James Monroe, John Quincy Adams, Andrew Jackson.
- Arbeit zitieren
- Leszek Jaworowski (Autor:in), 2009, Die Anfänge des amerikanischen Vetorechts. Das Vetorecht des amerikanischen Präsidenten im Übergang von der frühen Republik zur Jacksonian Era, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/276116