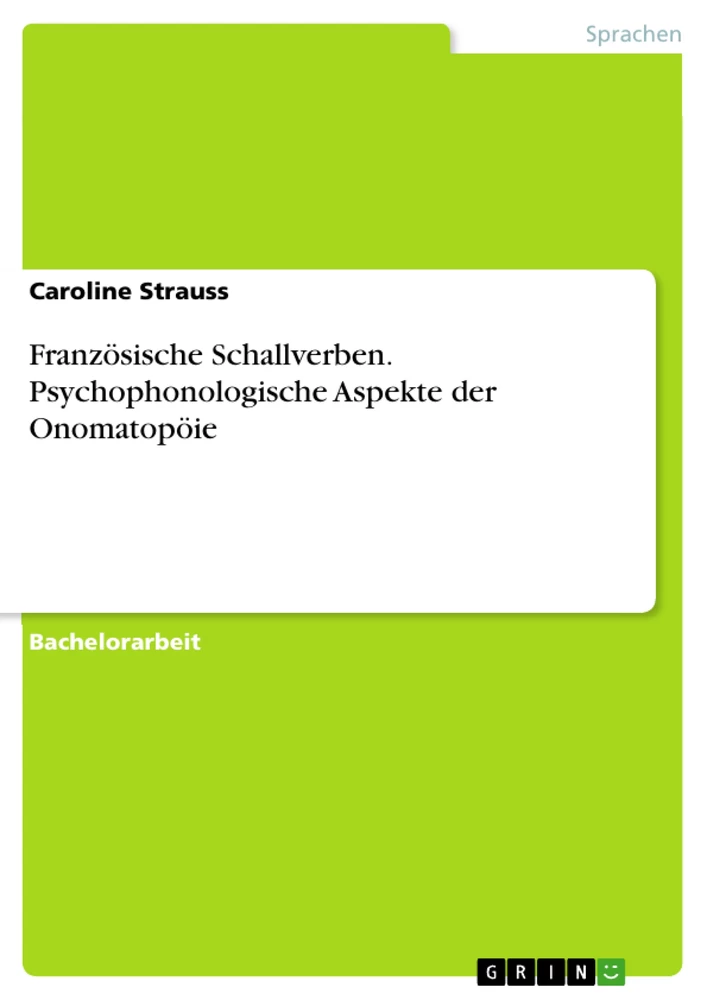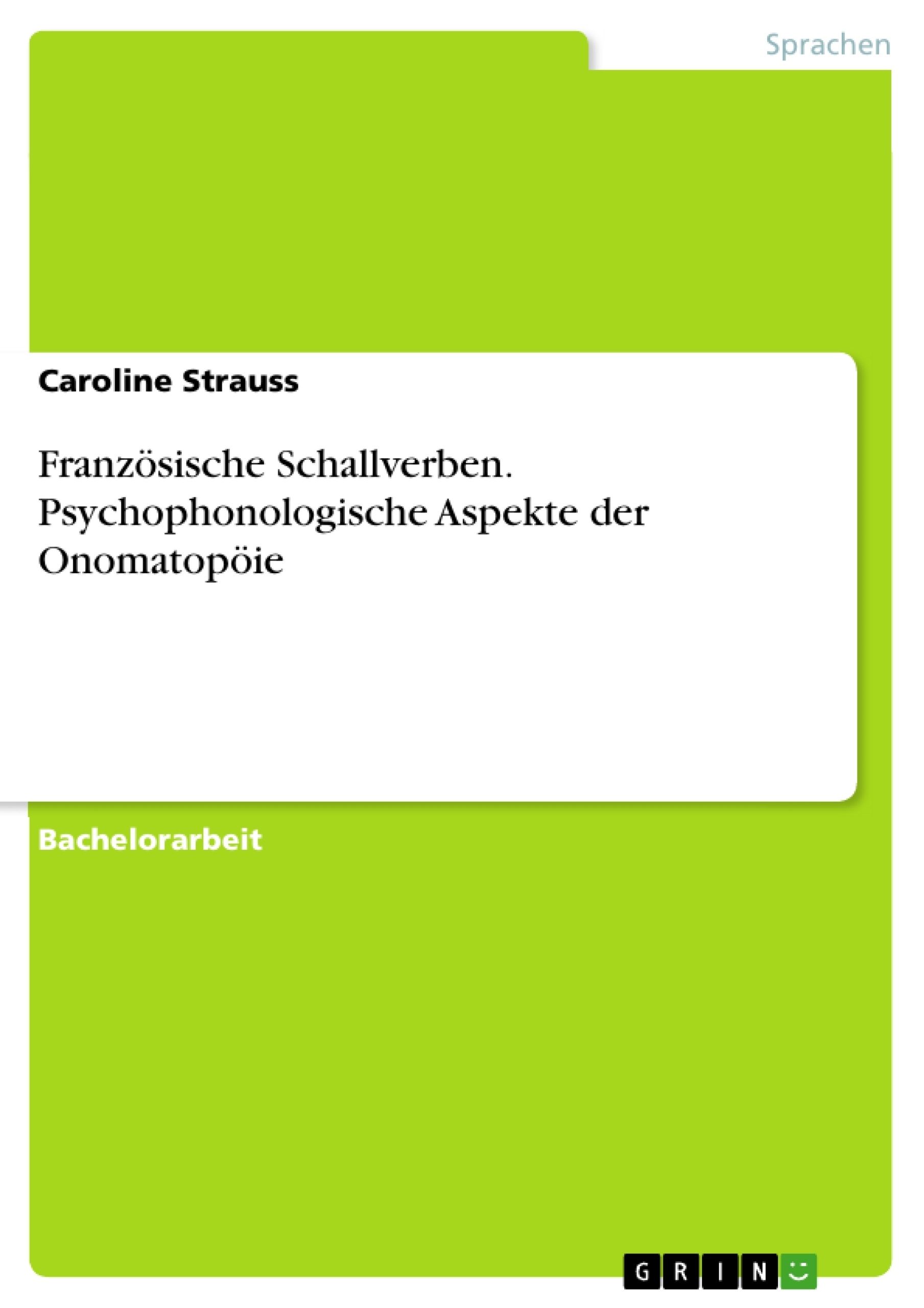Die vorliegende Arbeit soll Onomatopoetika sowohl in ihrer Rolle innerhalb des theoretischen Sprachsystems erfassen, als auch ihre Bedeutung für den Charakter einer einzelnen Sprache am Beispiel des Französischen zeigen. Hierzu soll als nüchternes Gegengewicht zur Sprachtheorie die kognitionswissenschaftliche und psychoakustische Seite der Sprache beleuchtet werden.
Innerhalb des Wortgebiets der Onomatopoetika sollen onomatopoetische Verben, also schallbezeichnende, einer genaueren Untersuchung unterzogen werden, weil sie bezüglich der zu betrachtenden Grenzfallbeziehung zwischen Sprach- und Wahrnehmungssystem durch die hier maximale Parallelisierbarkeit von Phonem- und Schallkategorisierung der menschlichen Kognition besonders geeignet sind.
1. Zu diesem Zweck soll zunächst die Zeichentheorie von Charles Sanders Peirce als Grundstock für das Verhältnis des Onomatopoetikums zu allem weiteren Sprachmaterial herangezogen werden. Insbesondere der Gegensatz von ikonischer und symbolischer Zeichenübertragung dieser Zeichentheorie soll als Orientierungspunkt dienen für eine anschließende kritische Auseinandersetzung mit Saussures Arbitraritätshypothese des sprachlichen Zeichens, die das Onomatopoetikum ernsthaft in Frage stellt.
2. Im Hinblick auf die naturwissenschaftliche Gegebenheiten einbeziehende Vergleichsstudie deutscher und französischer Schallverben soll die kognitionslinguistische Perspektive auf sprachliche Formgebung mentaler Inhalte der streng formalistischen strukturalistischen Sicht auf die Wortgenese gegenübergestellt werden. Die neurowissenschaftlichen Einflüsse dieser jungen Disziplin, die zerebrale Verarbeitungsmechanismen perzeptueller und konzeptueller Elemente gegeneinanderstellt und darin ihre Forschungshypothese der phonematischen Rasterbildung einbettet, soll auf die Untersuchung französischer Schallverben hinführen, die sowohl naturwissenschaftliche, als auch sprachtheoretische Seiten in sich aufnehmen soll, sowie konkrete phonoartikulatorische Unterschiede zwischen Deutsch und Französisch.
[...]
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Aufbau und Zielsetzung der Arbeit
- Theoretischer Teil
- Semiotik und Strukturalismus: Arbitraritätsgrade des sprachlichen Zeichens → Peirce und Saussure
- Semiotik - Ch. S. Peirces Zeichenlehre
- Strukturalismus – Onomatopoetika als Herausforderer von Saussures Arbitraritätsprinzip
- Kognitive Linguistik und Psychoakustik
- Kognitionswissenschaftliche Grundlagen
- Psychoakustik – Kognitive Reizverarbeitung von Schällen
- Genese und morphologische Eigenheiten von Onomatopoetika – Verhältnis zwischen Ikonizität und Symbolik/Konzeptualität und Formgebung
- Semiotik und Strukturalismus: Arbitraritätsgrade des sprachlichen Zeichens → Peirce und Saussure
- Empirischer Vergleich
- Schallverben
- deutsche (Kategorisierungsparameter nach C. Lehmann)
- französische
- Zusammenfassung
- Ausblick
- Schallverben
- Literaturverzeichnis
- Anhang:
- Tabellen zur Schallkategorisierung nach Lehmann 2004
- Liste französischer Schallverben (nach de Rudder)
- Liste deutscher Schallverben (nach C. Lehmann)
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit dem Phänomen der Onomatopoetika und untersucht deren Rolle im Sprachsystem sowie deren Bedeutung für den Charakter einer einzelnen Sprache, am Beispiel des Französischen. Die Arbeit verfolgt das Ziel, die theoretische Sprachsystemik mit kognitionswissenschaftlichen und psychoakustischen Erkenntnissen zu verbinden, um ein umfassendes Verständnis der Onomatopoetika zu erlangen. Im Fokus stehen onomatopoetische Verben, die aufgrund ihrer engen Beziehung zwischen Phonem und Schallkategorisierung besonders geeignet sind, um die Grenzfallbeziehung zwischen Sprach- und Wahrnehmungssystem zu beleuchten.
- Die Rolle von Onomatopoetika im Sprachsystem
- Die Bedeutung von Onomatopoetika für den Charakter einer einzelnen Sprache
- Die Verbindung von Sprachsystemik und kognitionswissenschaftlichen Erkenntnissen
- Die Untersuchung von onomatopoetischen Verben als Grenzfallbeziehung zwischen Sprach- und Wahrnehmungssystem
- Der Vergleich von deutschen und französischen Schallverben
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema der Onomatopoetika ein und stellt die Forschungsfrage nach den spezifischen lautmalerischen Abbildungsarten in verschiedenen Sprachen. Es wird die Frage aufgeworfen, ob Geräusche von Ohren verschiedener Sprachgemeinschaften anders gehört werden oder ob lediglich die sprachliche Reproduktion eines Schalls durch die sprachgemeinschaftlich gebundene Artikulatorenformung spezifiziert ist. Die Arbeit stellt die beiden Herangehensweisen an das Phänomen der Onomatopoetika vor: die idealistische Sprachtheorie und die naturwissenschaftlich gespeisterte Kognitionslinguistik.
Der theoretische Teil der Arbeit befasst sich zunächst mit der Semiotik und dem Strukturalismus. Es wird die Zeichentheorie von Charles Sanders Peirce vorgestellt, insbesondere der Gegensatz von ikonischer und symbolischer Zeichenübertragung. Anschließend wird die Arbitraritätshypothese von Ferdinand de Saussure kritisch beleuchtet, die das Onomatopoetikum in Frage stellt. Im zweiten Teil des theoretischen Teils werden die kognitionswissenschaftlichen Grundlagen und die Psychoakustik behandelt. Es werden die neurowissenschaftlichen Einflüsse auf die Untersuchung von Onomatopoetika beleuchtet, die zerebrale Verarbeitungsmechanismen perzeptueller und konzeptueller Elemente gegeneinanderstellt und darin ihre Forschungshypothese der phonematischen Rasterbildung einbettet.
Der empirische Vergleich untersucht deutsche und französische Schallverben anhand der Analyse von Christian Lehmann. Es werden Gemeinsamkeiten und Unterschiede in den Verhältnissen von Ikonizität und Symbolik, beziehungsweise Formgebung und Konzeptualität der deutschen und französischen Sprache freigelegt. Der Fokus liegt dabei auf der Phonologie und der Morphologie, Aspekte der syntaktischen Eingliederung werden ausgespart.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen Onomatopoetika, Schallverben, Sprachsystem, Kognitionslinguistik, Psychoakustik, Semiotik, Strukturalismus, Arbitraritätsprinzip, Ikonizität, Symbolik, Konzeptualität, Formgebung, Deutsch, Französisch, Vergleich, Sprachvergleich.
Häufig gestellte Fragen
Was sind Onomatopoetika?
Onomatopoetika sind lautmalerische Wörter, die Geräusche aus der Natur oder der Umwelt sprachlich nachahmen.
Warum werden speziell Schallverben untersucht?
Schallverben eignen sich besonders gut, um die Grenzbeziehung zwischen Sprachsystem und menschlicher Wahrnehmung (Kognition) zu analysieren.
Was besagt Saussures Arbitraritätsprinzip?
Es besagt, dass die Beziehung zwischen einem Wort (Bezeichnenden) und seiner Bedeutung (Bezeichneten) willkürlich ist – Onomatopoetika fordern dieses Prinzip heraus.
Gibt es Unterschiede zwischen deutschen und französischen Schallverben?
Ja, die Arbeit untersucht, ob Geräusche unterschiedlich wahrgenommen werden oder ob lediglich die artikulatorische Umsetzung sprachlich bedingt variiert.
Welche Rolle spielt die Psychoakustik in dieser Arbeit?
Die Psychoakustik hilft zu verstehen, wie das menschliche Gehirn akustische Reize verarbeitet und in phonematische Raster (Sprache) einordnet.
- Citation du texte
- Caroline Strauss (Auteur), 2013, Französische Schallverben. Psychophonologische Aspekte der Onomatopöie, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/276226