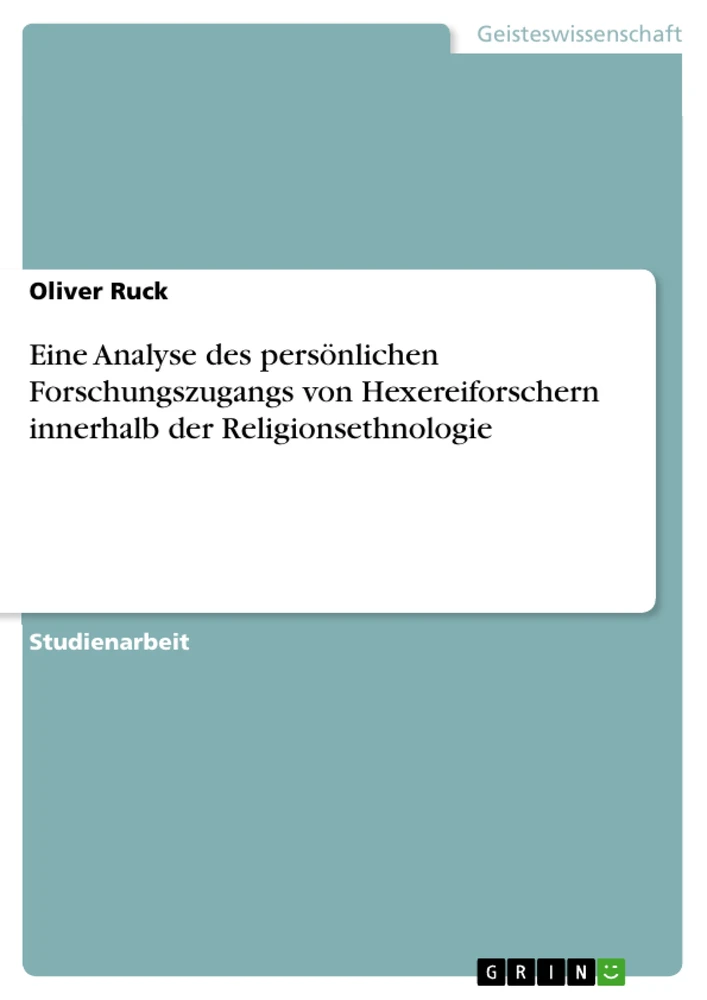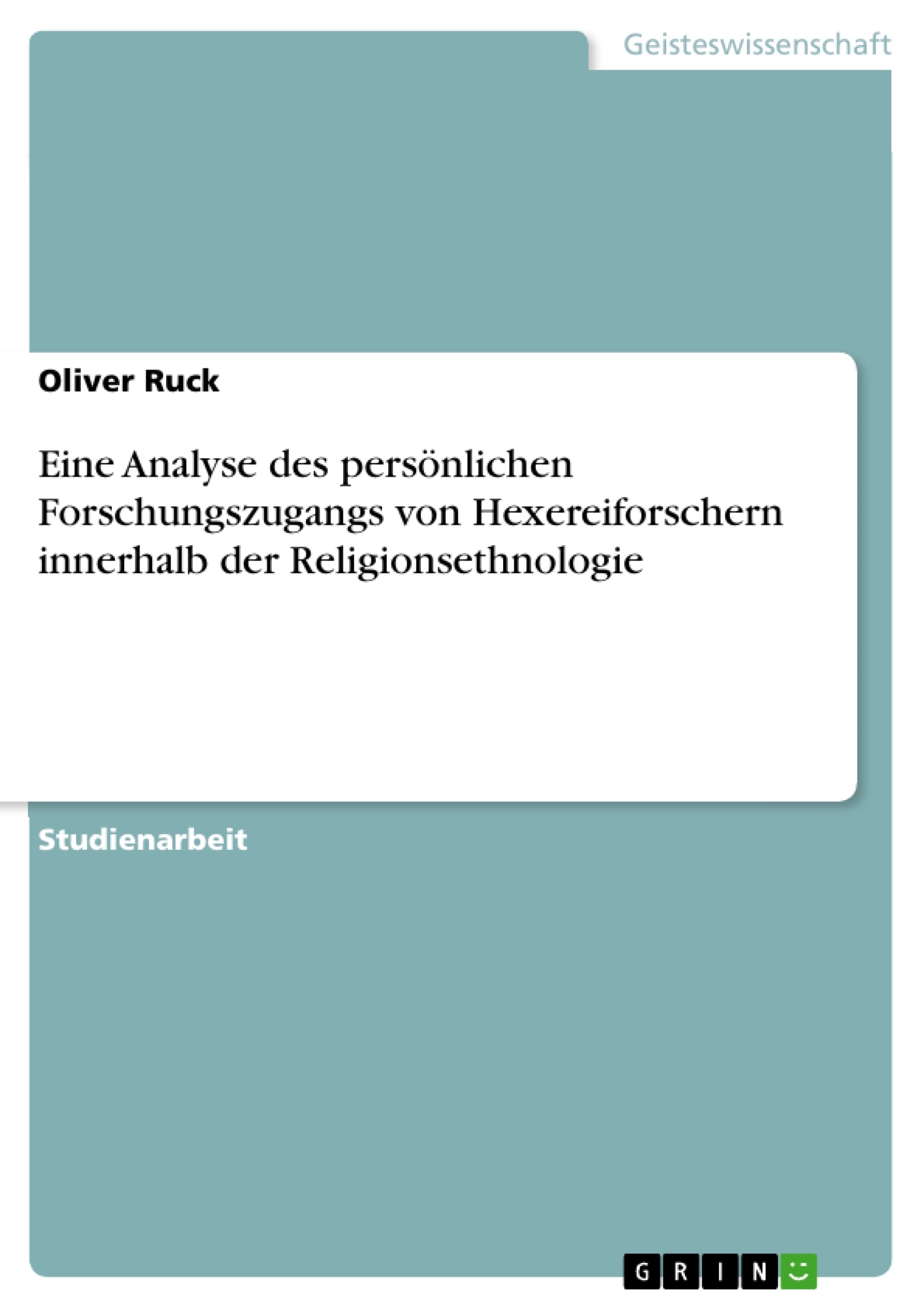Diese Hausarbeit untersucht den Umgang ethnologischer Forscher mit dem Phänomen der Hexerei. Im Vordergrund der Betrachtung steht dabei der persönliche Zugang des Forschers zu seiner ethnographischen Frage. Bei diesem persönlichen Zugang spielt insbesondere der Umgang mit Religion und Übernatürlichem eine Rolle. Die von der Arbeit zu beantwortende Frage lässt sich demnach wie folgt formulieren: Gibt es den einen richtigen ethnologischen Forschungszugang? Um diese Fragen zu beantworten, werden zunächst allgemeine Methoden der Ethnologie wie in etwa die Feldforschung thematisiert. Außerdem wird die Entwicklung des methodischen Zugangs dargestellt und danach wird eine Kritik an ethnologischer Arbeit im Allgemeinen vorgestellt. Die Aufgabe der Ethnologie, Hexerei nachvollziehbar und verständlich zu machen, wird im Anschluss anhand von zwei ethnographischen Beispielen analysiert. Diese Ethnographien sollen zeigen, wie Ethnologen Hexerei sichtbar und verständlich machen. Es handelt sich bei den Ethnographien einerseits um das für die Religionsethnologie prägendste Werk von Edward E. Evans-Pritchard „Witches, Oracles, and Magic among the Zande“ aus dem Jahr 1937, sowie den ethnographischen Roman „Madumo – A Man bewitched“ von Adam Ashforth aus dem Jahr 2000. Die beiden ausgewählten Ethnographien lassen sich kontrastierend gegenüberstellen, weil sie einerseits eine große zeitliche Differenz aufweisen, aber auf der anderen Seite auch im Umgang der Ethnologen mit der Religion Unterschiede aufweisen.
Inhaltsverzeichnis
- Themeneingrenzung
- Definition und Entwicklung religionsethnologischer Forschungsarbeit
- Persönlicher Zugang des Forschers zur Feldforschung
- Methodologischer Agnostizismus
- Glaube als Instrument bei Evans-Pritchard
- Allgemeine Kritik an der ethnologischen Arbeitsweise
- Ethnographische Beispiele
- Methodologie von Evans-Pritchard
- Methodologie von Ashforths
- Der richtige Zugang?
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit befasst sich mit der Analyse des persönlichen Forschungszugangs von Ethnologen, die sich mit dem Phänomen der Hexerei auseinandersetzen. Im Mittelpunkt steht dabei die Frage, wie der persönliche Zugang des Forschers zu seiner ethnographischen Fragestellung die Ergebnisse beeinflussen kann, insbesondere im Hinblick auf den Umgang mit Religion und Übernatürlichem. Die Arbeit untersucht, ob es einen „richtigen“ ethnologischen Forschungszugang gibt und welche Methoden und Herangehensweisen sich in der Praxis bewährt haben.
- Die Bedeutung des persönlichen Forschungszugangs in der Religionsethnologie
- Die Entwicklung der Feldforschungsmethode in der Ethnologie
- Der methodologische Agnostizismus und seine Anwendung in der Hexereiforschung
- Die Rolle des Glaubens im Forschungsansatz von Evans-Pritchard
- Ethnographische Beispiele und ihre unterschiedlichen Zugänge zur Hexerei
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel legt den Fokus auf die Themeneingrenzung und die zentrale Frage der Arbeit: Gibt es den einen richtigen ethnologischen Forschungszugang, insbesondere im Bereich der Hexerei? Die Arbeit beleuchtet die Bedeutung des persönlichen Zugangs des Forschers und die Herausforderungen, die mit der Erforschung übernatürlicher Phänomene einhergehen.
Kapitel 2 widmet sich der Definition und Entwicklung religionsethnologischer Forschungsarbeit, insbesondere der Feldforschung. Es zeichnet die historische Entwicklung der Methode nach, beginnend mit Bronislaw Malinowskis Einführung der Feldforschung als zentrale Methode der Ethnologie im Jahr 1922. Der Einfluss von Emile Durkheim und seine funktionalistische Sicht auf Religion werden ebenso beleuchtet wie die Kritik an der frühen Ethnologie, die vor allem auf die Sammlung von Details ohne theoretische Hinterfragung ausgerichtet war.
Kapitel 3 beschäftigt sich mit dem persönlichen Zugang des Forschers zur Feldforschung und stellt zwei kontrastierende Zugänge vor: den methodologischen Agnostizismus und den gläubigen Ansatz von Evans-Pritchard. Der methodologische Agnostizismus, der die Frage nach übernatürlichen Mächten unbeantwortet lässt, wird anhand der Arbeiten von Hubert Knoblauch und Matthew Engelke erläutert. Das Kapitel analysiert die Vor- und Nachteile dieses Ansatzes und beleuchtet die Schwierigkeit, völlige Wertneutralität in der Forschung zu erreichen.
Kapitel 4 präsentiert zwei ethnographische Beispiele, die unterschiedliche Zugänge zur Erforschung von Hexerei aufzeigen: „Witches, Oracles, and Magic among the Zande“ von Edward E. Evans-Pritchard und „Madumo A Man bewitched“ von Adam Ashforth. Die Kapitel analysieren die jeweiligen Methoden der beiden Ethnologen und zeigen, wie sie mit den Herausforderungen der Hexereiforschung umgegangen sind.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit zentralen Begriffen und Themen der Religionsethnologie, darunter Hexerei, Feldforschung, methodologischer Agnostizismus, Glaube, Ethnographie, Evans-Pritchard, Ashforth, „Witches, Oracles, and Magic among the Zande“, „Madumo A Man bewitched“, übernatürliche Phänomene, und die Bedeutung des persönlichen Forschungszugangs. Sie untersucht, wie sich diese Aspekte auf die Analyse und Interpretation von übernatürlichen Phänomenen in verschiedenen Kulturen auswirken.
Häufig gestellte Fragen
Gibt es den einen richtigen Forschungszugang in der Ethnologie?
Die Arbeit untersucht diese Frage kritisch und zeigt auf, dass der persönliche Zugang des Forschers, insbesondere der Umgang mit Religion, die Ergebnisse stark beeinflusst.
Was bedeutet "methodologischer Agnostizismus"?
Es ist ein Forschungsansatz, der die Frage nach der tatsächlichen Existenz übernatürlicher Mächte bewusst offen lässt, um eine wertneutrale Beobachtung religiöser Phänomene zu ermöglichen.
Wie unterschied sich der Ansatz von Evans-Pritchard?
In seinem Werk über die Zande nutzte Evans-Pritchard den Glauben zeitweise als "Instrument", um in die Lebenswelt der Probanden einzutauchen, auch wenn er später eine eher funktionalistische Sicht einnahm.
Welche Rolle spielt Adam Ashforths Werk in der Arbeit?
Ashforths "Madumo – A Man bewitched" dient als modernes Gegenbeispiel, das zeigt, wie ein Forscher durch eine enge persönliche Beziehung zu einer "verhexten" Person Hexerei sichtbar macht.
Wer begründete die Feldforschung als zentrale Methode?
Bronislaw Malinowski führte 1922 die teilnehmende Beobachtung (Feldforschung) als wissenschaftlichen Standard in der Ethnologie ein.
- Quote paper
- Oliver Ruck (Author), 2012, Eine Analyse des persönlichen Forschungszugangs von Hexereiforschern innerhalb der Religionsethnologie, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/277463