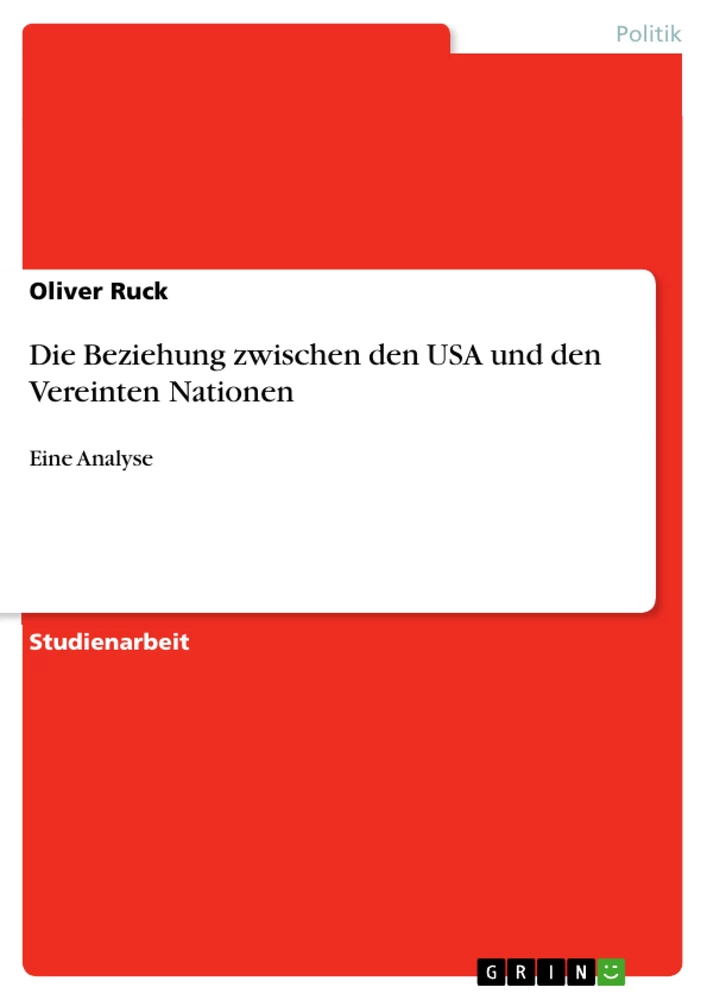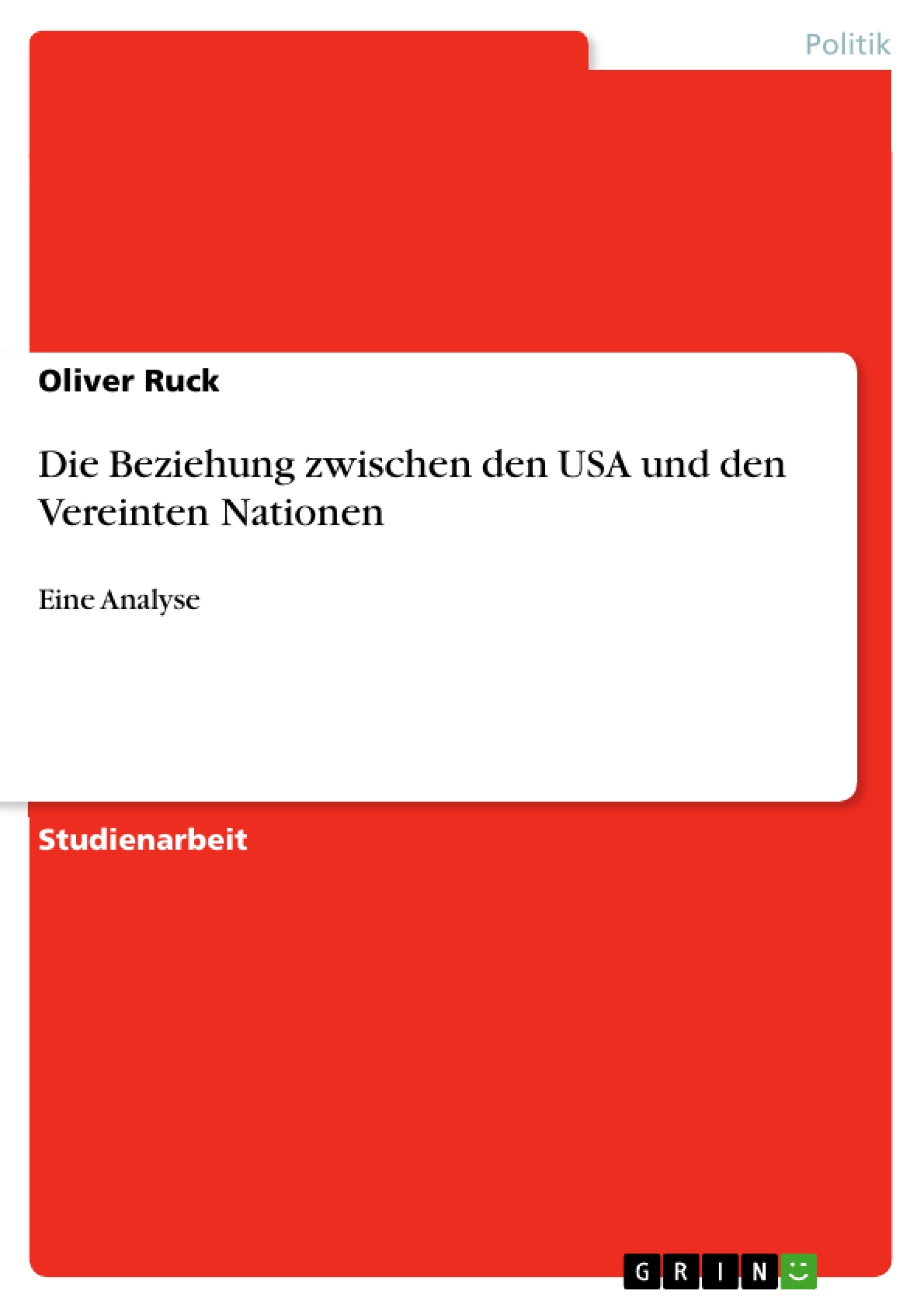USA und Vereinte Nationen – eine echte Partnerschaft?
Diese Hausarbeit untersucht das Verhältnis zwischen den Vereinigten Staaten von Amerika (USA) und den Vereinten Nationen (UNO/UN). Sie wird insbesondere aus der US-amerikanischen Perspektive die Beziehung der beiden Akteure beleuchten. Zunächst erfolgt eine kurze Analyse der Beziehung von der Gründung der UNO über den Kalten Krieg bis hin zu den 90er-Jahren nach dem Fall des Eisernen Vorhangs. Danach soll durch aktuellere Beispiele die Möglichkeit gegeben werden, den Status quo der Beziehung zwischen USA und UNO zu erfassen und die zukünftige Entwicklung zu prognostizieren. Als Beispiel eignet sich zunächst ein genauerer in das politische System der USA. Der Präsident und der Kongress stehen sich nicht immer wohlgesonnen gegenüber und deshalb lässt sich vermuten, dass die innenpolitische Struktur auch die Außenpolitik zu den Vereinten Nationen beeinflusst. Die sogenannten checks and balances des politischen Systems spielen dabei eine besondere Rolle. Diese These gilt es zu überprüfen.
Danach soll die strukturelle Bedeutung der USA für die UNO geklärt werden. Als größter Beitragszahler scheint die UNO auf die Vereinigten Staaten angewiesen. Es soll geprüft werden, inwieweit die Interessen der Vereinten Staaten nicht mit den UNO-Interessen konform sind. Dabei gilt zu untersuchen, ob die UNO für die Vereinigten Staaten nur eine Art Instrument darstellt, um eigene Interessen zu verfolgen ober ob eine gemeinsame Zielbasis überwiegt. Diese Frage soll anhand konkreter Beispiele beantwortet werden. Auf der einen Seite wird die fehlende US-amerikanische Zahlungsmoral der Mitgliedsbeiträge für die Vereinten Nationen beleuchtet. Auf der anderen Seite steht der Krieg im Irak im Jahr 2003 im Fokus, den die Vereinigten Staaten trotz fehlender UN-Resolution begonnen haben. Beide Beispiele verweisen auf eine unilaterale amerikanische Außenpolitik, die sich gegen den Multilateralismus der UNO zu richten scheint.
Somit kann die Hauptfragestellung der Arbeit wie folgt formuliert werden: Sehen die Vereingten Staaten die UNO nur als Instrument ihrer Interessen oder besteht ein ernsthaftes Interesse an einer konstruktiven, partnerschaftlichen Zusammenarbeit? Inwieweit bestimmt Unilateralismus die US-amerikanische Außenpolitik und drängt damit den Multilateralismus der UN in den Hintergrund?
Inhaltsverzeichnis
- Thema
- Eine Analyse der Beziehung zwischen den USA und den Vereinten Nationen
- USA und Vereinte Nationen – eine echte Partnerschaft?
- Entwicklung der Beziehung zwischen den USA und der UNO
- Die Vereinten Nationen als Instrument der USA?
- Der Einfluss des politischen Systems der USA auf die Außenpolitik zur UNO
- Fehlende Zahlungsdisziplin der USA gegenüber der UNO
- Irakkrieg 2003
- Notwendigkeit einer intakten Beziehung zwischen den USA und der UNO
- Fazit
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Hausarbeit analysiert die Beziehung zwischen den Vereinigten Staaten von Amerika (USA) und den Vereinten Nationen (UNO) aus der US-amerikanischen Perspektive. Sie untersucht die Entwicklung der Beziehung von der Gründung der UNO bis zur Gegenwart und beleuchtet die Frage, ob die USA die UNO als Instrument ihrer Interessen betrachten oder ob ein ernsthaftes Interesse an einer partnerschaftlichen Zusammenarbeit besteht.
- Entwicklung der Beziehung zwischen den USA und der UNO von der Gründung bis zur Gegenwart
- Der Einfluss des politischen Systems der USA auf die Außenpolitik zur UNO
- Die Rolle der USA als größter Beitragszahler der UNO
- Die Frage, ob die USA die UNO als Instrument ihrer Interessen nutzen
- Die Bedeutung des Irakkrieges 2003 für das Verhältnis zwischen den USA und der UNO
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel beleuchtet die Beziehung zwischen den USA und der UNO von der Gründung der UNO bis in die 1990er Jahre. Es wird die Rolle der USA als einer der Gründungsmitglieder und die Bedeutung des Sicherheitsrates für die amerikanische Außenpolitik hervorgehoben.
Das zweite Kapitel analysiert die Entwicklung der Beziehung zwischen den USA und der UNO während des Kalten Krieges. Es wird die Spaltung des Sicherheitsrates in zwei Lager und die daraus resultierende Blockadehaltung in der UN-Politik beschrieben.
Das dritte Kapitel untersucht die Frage, ob die USA die UNO als Instrument ihrer Interessen nutzen. Es wird der Einfluss des politischen Systems der USA auf die Außenpolitik zur UNO, die fehlende Zahlungsdisziplin der USA gegenüber der UNO und der Irakkrieg 2003 als Beispiele für eine unilaterale amerikanische Außenpolitik analysiert.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen die Beziehung zwischen den USA und den Vereinten Nationen, die amerikanische Außenpolitik, der Sicherheitsrat der UNO, der Irakkrieg 2003, der Einfluss des politischen Systems der USA auf die Außenpolitik, die Zahlungsdisziplin der USA gegenüber der UNO und die Frage, ob die USA die UNO als Instrument ihrer Interessen nutzen.
Häufig gestellte Fragen
Wie ist das Verhältnis der USA zu den Vereinten Nationen?
Das Verhältnis ist ambivalent. Die USA sind Gründungsmitglied und größter Beitragszahler, agieren aber oft unilateral, wenn nationale Interessen berührt sind.
Warum zahlen die USA ihre UN-Beiträge oft unregelmäßig?
Die Arbeit untersucht, wie der US-Kongress die Beitragszahlungen oft als politisches Druckmittel nutzt, um Reformen innerhalb der UN zu erzwingen.
Welche Rolle spielte der Irakkrieg 2003 für die Beziehung?
Der Irakkrieg, der ohne UN-Mandat begann, gilt als Paradebeispiel für US-amerikanischen Unilateralismus und belastete das Verhältnis zur Weltorganisation schwer.
Nutzen die USA die UN nur als Instrument?
Die Arbeit prüft die These, ob die UN für die USA primär ein Werkzeug zur Durchsetzung eigener außenpolitischer Ziele ist oder ob ein echtes Interesse an Multilateralismus besteht.
Was bedeutet "Checks and Balances" in diesem Kontext?
Das System der Gewaltenteilung in den USA führt oft zu Konflikten zwischen Präsident und Kongress über die UN-Politik, was die amerikanische Position schwächen oder verändern kann.
- Quote paper
- Oliver Ruck (Author), 2013, Die Beziehung zwischen den USA und den Vereinten Nationen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/277464