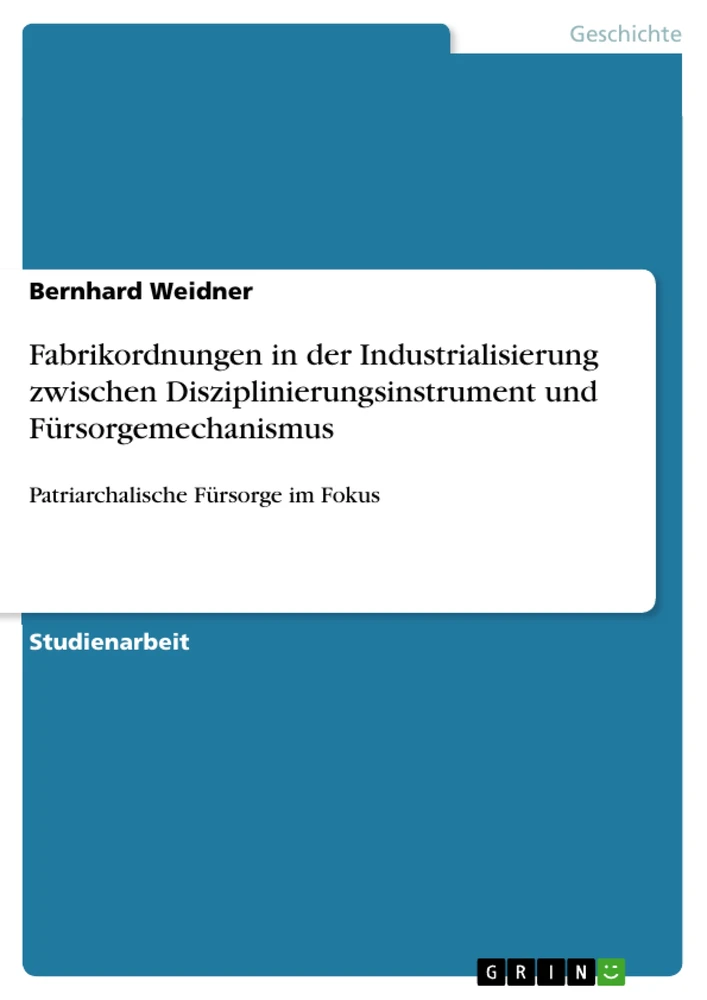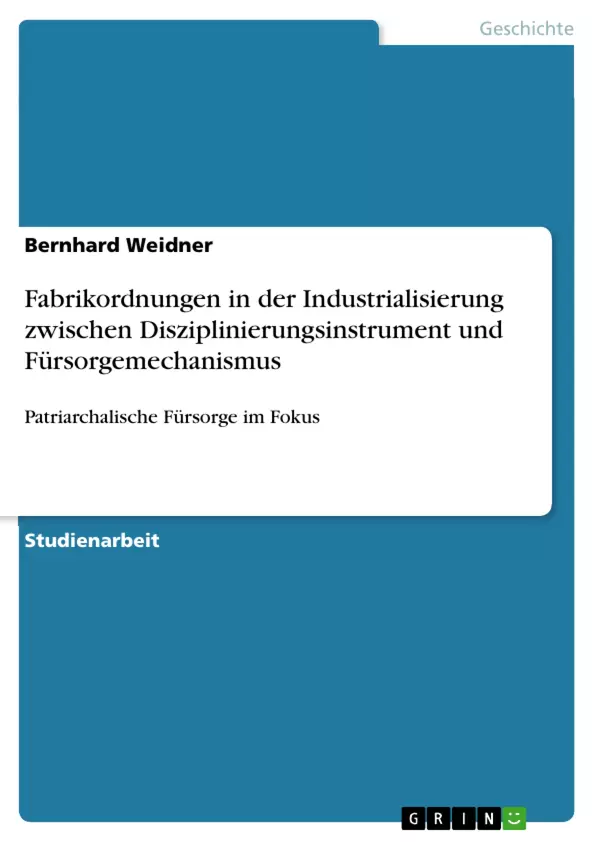Der Epochenbegriff Industrialisierung bezeichnet den technisch-wirtschaftlichen Übergangsprozess vom primären Sektor (Jean Fourastié) zu industrieller Produktionsweise, welcher sich für Deutschland ab etwa 1830-40 beobachten lässt. Im stark agrarisch geprägten Bayern entwickeln sich im 19. und 20. Jahrhundert allerdings nur punktuelle Industrialisierungszonen in den großstädtischen Räumen um Augsburg, Nürnberg/Fürth, Hof und München. Mit der zunehmenden Durchdringung der Arbeitswelt durch maschinelle und verarbeitende Fertigung, entsteht ein neues Anforderungsprofil: Das des treuen, fleißigen, willigen und disziplinierten Fabrikarbeiters. Jenes junge soziale Milieu der arbeitenden Klasse verdient sich den Lebensunterhalt in städtischen Werken und Fabriken und folgt noch in der Entwicklung begriffenen Arbeitsnormen. Durch die grundlegend veränderte Arbeitswelt, war eine Neustrukturierung des Arbeitsverhaltens notwendig, unterscheidet sich doch der Werks- und Fabrikalltag grundlegend von der Arbeitsstruktur in Manufakturen, Handwerk, Verlagswesen oder zünftischem Gewerbe . Deshalb standen Fabrikbesitzer vor der enormen Herausforderung, die Arbeitsgewohnheiten der Menschen nach den Maschinen in der automatisierten Fabrik zu takten und das Arbeitsverhalten entsprechend zu normieren. Verhaltensansprüche der Fabrikherren manifestieren sich in Verhaltens- und Disziplinarkodizes, den sogenannten Fabrikordnungen. Dass diese Ordnungen vordergründig der Sozialdisziplinierung dienten, ist hinreichend bekannt - zwar waren Normenimplementierung, die Genese und Einhaltung von Kardinaltugenden und bisweilen umfassende Strafenkataloge die Kerninhalte derartiger Fabrikgesetze, aber neben Führungs- und Kontrollzwecken lässt sich auch eine weitere Dimension dieser Arbeitsordnungen identifizieren: Die eines Instruments zur sozialen Versorgung, der Festlegung von Arbeiterrechten und der patriarchalischen Fürsorge. Gerade letztere Gesichtspunkte werden oft vernachlässigt, weshalb eine Untersuchung der sozialen Aspekte von Fabrikordnungen neue Puzzleteilchen für die Beschreibung der Lebenswirklichkeit von Fabrikarbeitern in Bayern liefern kann. Die Realisierung der sozialpädagogischen Vorsorge erfolgte über die Einrichtung von betrieblichen Kassen, die in ihren Statuten Leistungen bei Krankheitsfällen, Verwundungen oder sonstigen Notfällen festlegten.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Grundlagen der Themenbearbeitung
- Vorüberlegungen
- Thematischer Fokus, Fragestellung, Aufbau, regionale Pointierung
- Quellenlage und Forschung
- Untersuchungszeitraum und ein Wendepunkt
- Sozialdisziplinierung als Handlungsrahmen
- Begrifflichkeiten
- Reichweite der Regulierungen
- Patriarchalische Fürsorge im Fokus
- Analyse der Fabrikordnungen
- Untersuchungen zum Inhalt
- Fabrikordnungen vor 1891
- Fabrikordnungen nach 1891
- Untersuchungen zur Verteilung
- Fabrikordnungen vor 1891
- Fabrikordnungen nach 1891
- Querschnitt und Fazit
- Statuten für den Kranken-Unterstützungs-Verein der leonischen Drahtfabrik
- Untersuchungen zum Inhalt
- Mechanismen der sozialen Versorgung
- Sozialleistungen und Versicherungen
- Betriebsbindung und weiteres
- Analyse der Fabrikordnungen
- Sozialdisziplinierung als Instrument der Fabrikkultur
- Patriarchalische Fürsorge als Element der Fabrikordnungen
- Entwicklung der sozialen Inhalte in den Fabrikordnungen
- Bedeutung der Fabrikordnungen als Sozialgesetze betrieblicher Natur
- Machtgefüge und soziale Abhängigkeiten in der industriellen Arbeitswelt
- Die Einleitung führt in die Thematik der Industrialisierung in Bayern ein und stellt die Bedeutung von Fabrikordnungen als Spiegel der Arbeits- und Lebenswelt der Industriearbeiterschaft heraus.
- Das Kapitel "Grundlagen der Themenbearbeitung" definiert den thematischen Fokus und die Fragestellung der Arbeit. Es beleuchtet die Quellenlage und die bisherige Forschungsliteratur sowie den Untersuchungszeitraum.
- Im Kapitel "Sozialdisziplinierung als Handlungsrahmen" werden die theoretischen Grundlagen des Begriffs der Sozialdisziplinierung erörtert. Die Reichweite der Regulierungen in den Fabrikordnungen wird analysiert.
- Das Kapitel "Patriarchalische Fürsorge im Fokus" analysiert die Inhalte der Fabrikordnungen, um Hinweise auf soziale Kriterien, Belohnungssysteme und Fürsorgemaßnahmen zu finden. Dabei werden die Ordnungen aus verschiedenen Zeitperioden und Regionen miteinander verglichen.
- Im Kapitel "Mechanismen der sozialen Versorgung" werden die Mechanismen der betrieblichen Vorsorge im Hinblick auf Krankenschutz, Unfallschutz und Altersschutz untersucht. Die Entwicklung von Sozialleistungen und Versicherungen im Kontext der Fabrikordnungen wird beleuchtet.
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Hausarbeit beschäftigt sich mit der Untersuchung der sozialen Aspekte von Fabrikordnungen in Bayern während der Industrialisierung. Sie zielt darauf ab, die Rolle von Fabrikordnungen als Instrumente der Sozialdisziplinierung und der patriarchalen Fürsorge zu analysieren. Dabei liegt der Fokus auf der Frage, wie sich soziale Inhalte in den Fabrikordnungen manifestieren und wie diese sich über die Zeit hinweg entwickeln.
Zusammenfassung der Kapitel
Schlüsselwörter
Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit den Themen der industriellen Revolution in Bayern, Fabrikordnungen, Sozialdisziplinierung, patriarchale Fürsorge, Arbeiterrechte, Betriebsbindung, Sozialleistungen und Versicherungen. Die Forschung basiert auf Quellenstudien von Fabrikordnungen aus Nürnberg, Fürth und Augsburg im Zeitraum von 1838 bis 1912.
Häufig gestellte Fragen
Was waren Fabrikordnungen in der Industrialisierung?
Fabrikordnungen waren Verhaltens- und Disziplinarkodizes, die das Arbeitsverhalten der Menschen an den Takt der Maschinen anpassen und normieren sollten.
Dienten Fabrikordnungen nur der Disziplinierung?
Nein, neben der Sozialdisziplinierung dienten sie auch als Instrumente der patriarchalischen Fürsorge und legten Arbeiterrechte sowie soziale Versorgungsmechanismen fest.
Wie wurde die soziale Versorgung in Fabriken realisiert?
Oft geschah dies über betriebliche Kassen (Kranken-Unterstützungs-Vereine), die Leistungen bei Krankheit, Unfällen oder Notfällen vorsahen.
Welche regionalen Schwerpunkte hat die Untersuchung?
Die Arbeit konzentriert sich auf die Industrialisierungszonen in Bayern, insbesondere in den Räumen Augsburg, Nürnberg/Fürth und München.
Was änderte sich durch die Gewerbeordnung von 1891?
Die Arbeit vergleicht Fabrikordnungen vor und nach 1891, um die Entwicklung der sozialen Inhalte und der rechtlichen Normierung aufzuzeigen.
- Quote paper
- Bernhard Weidner (Author), 2012, Fabrikordnungen in der Industrialisierung zwischen Disziplinierungsinstrument und Fürsorgemechanismus, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/277515