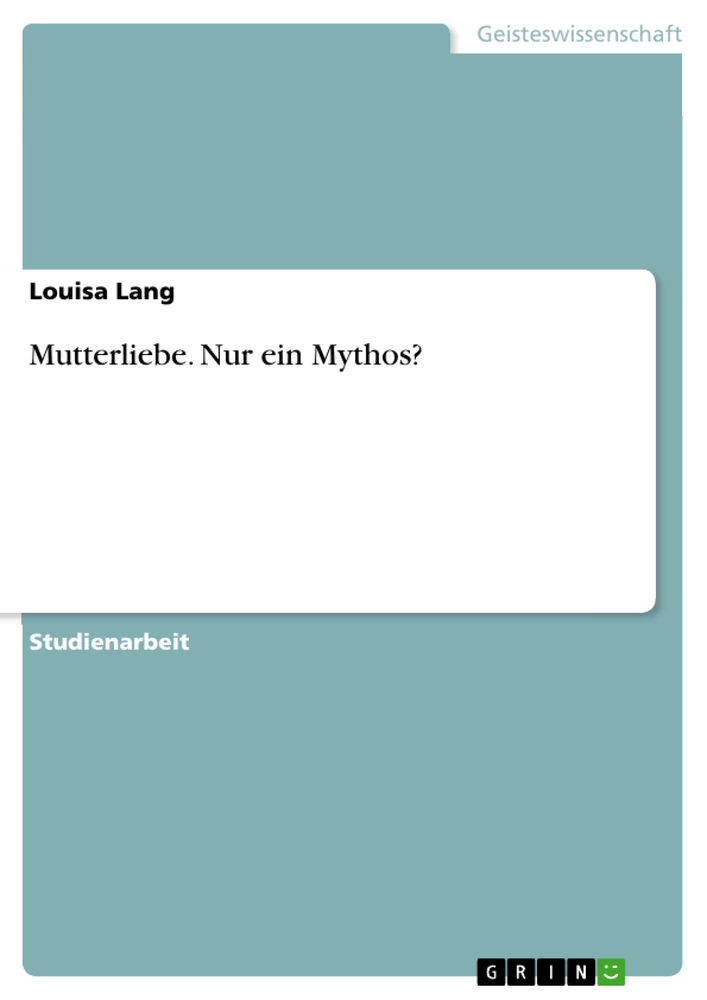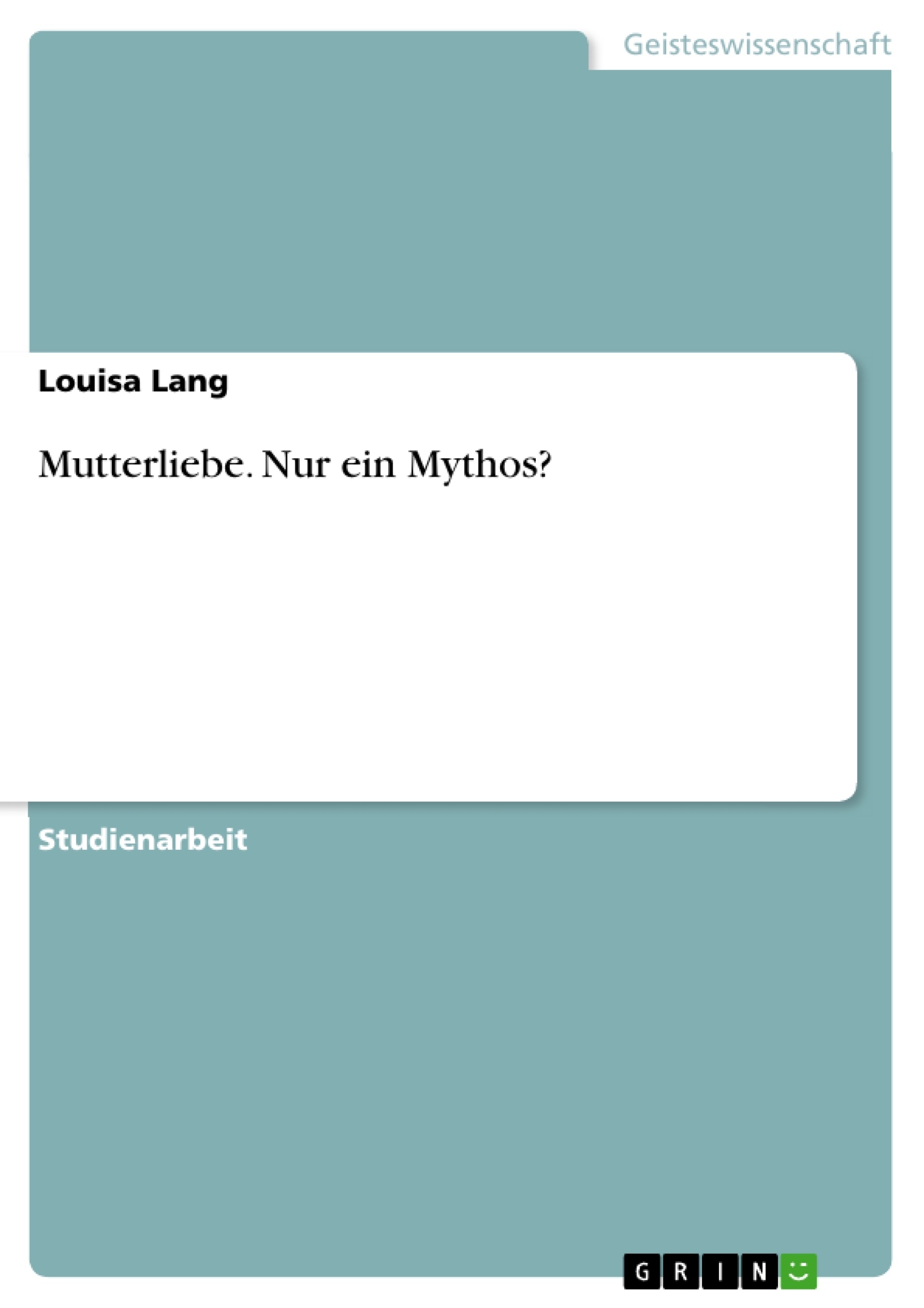Es scheint uns so selbstverständlich wie kaum etwas anderes. Frauen liebe ihre Kinder, es liegt in ihrer Natur. Auf diese Weise wurde lange argumentiert. Daraus ergab sich, dass sich Frauen aufgrund ihrer Nähe zur Natur und ihrer Fähigkeit zu gebären, von Männern unterscheiden. Sie sind im Gegensatz zum Mann liebliche, sanfte und nach Freud masochistische und passive Wesen (vgl. Badinter 1991, S.267ff). Auf diese Weise wurde nicht nur die sexistische Unterdrückung der Frau legitimiert, sondern ihr auch der Zugang zu öffentlichen Bereichen und in Folge ein beruflicher Aufstieg untersagt. Das weibliche Geschlecht wurde dem Reproduktionsbereich zugeordnet und wurde nach Simone de Beauvoir (1949) als „das andere Geschlecht“ angesehen, während der Mann das „Absolute“ repräsentierte (vgl. Beauvoir 1949/1987, S.11). Die Frau stand folglich stets unter dem Mann und zeichnete sich nach und nach durch eine Unterwerfungsbereitschaft aus (vgl. ebd. S.11f).
Während der industriellen Entwicklung, als die Frau allmählich an der Produktion teilhaben wollte, wurde sie zurück „an den Herd“ gedrängt und sollte sich der Kindererziehung widmen (vgl. ebd. S.12). Mutterliebe wurde als ein „Instinkt der Natur“ oder ein Sozialverhalten dargestellt (vgl. Badinter 1991, o.S.), an dem sich die Frau zu orientieren und dem sie sich zu fügen hatte. Rousseau und Freud interpretierten die Hingabe und Opferbereitschaft der Frau sogar „als Wesensmerkmale“ (ebd.).
Erst in den 1960er Jahren breitete sich eine feministische Bewegung von den USA aus, die sich mit der Konstruiertheit scheinbarer Wesensmerkmale auseinandersetzte. Die Frauenrechtsbewegung sprach sich für neue weibliche Verhaltensweisen, einen strukturellen gesellschaftlichen Wandel und die Gleichberechtigung der beiden Geschlechter aus. Besonders der Freudsche Mythos und seine phallogozentrischen Normvorstellungen der Psychoanalyse1 gerieten ins Visier, begannen ins Wanken zu geraten und an Glaubwürdigkeit zu verlieren. Einflussfaktoren wie Sozialisation und Erziehung, die eine wesentliche Rolle bei der Entwicklung der Geschlechtsidentität spielen, bekamen einen höheren Stellenwert.
Elisabeth Badinter (1991) versucht in ihrem Werk „Die Mutterliebe. Geschichte eines Gefühls vom 17. Jahrhundert bis heute“ die Mutterrolle als ein Konstrukt zu entlarven. In diesem Sinne beschäftigt sich die vorliegende Hausarbeit mit ihrer Argumentation gegen die Natürlichkeit der Mutterliebe. Es wird den Frage nachgegangen, wie Weiblichkeit konstruie
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitung
- II. Weiblichkeit aus feministischer Perspektive
- II.1 Liebe als weibliches Attribut
- II.2 ,,Man kommt nicht als Frau zur Welt..." - Erziehung, Sozialisation und Geschlecht
- III. Die „Bestimmung als Hausfrau und Mutter"?
- III.1 Mutterrolle als Konstrukt? - Argumente wider ihrer Natürlichkeit
- III.2 Von der Mutterliebe zur Vaterliebe?
- IV. Fazit
- Bibliografie
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Hausarbeit befasst sich mit der Frage, ob Mutterliebe ein natürliches Gefühl ist oder ob es sich um ein soziales Konstrukt handelt. Sie analysiert die Argumentation von Elisabeth Badinter, die in ihrem Werk „Die Mutterliebe. Geschichte eines Gefühls vom 17. Jahrhundert bis heute“ die Mutterrolle als ein Konstrukt entlarvt.
- Konstruktion von Weiblichkeit und Mutterrolle
- Kritik an der Natürlichkeit der Mutterliebe
- Einfluss von Sozialisation und Erziehung auf die Geschlechtsidentität
- Feministische Perspektiven auf Weiblichkeit und Liebe
- Die Rolle der Liebe in der geschlechtsspezifischen Arbeitsteilung
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die These auf, dass Mutterliebe ein soziales Konstrukt ist und nicht, wie lange angenommen, ein natürliches Gefühl. Sie beleuchtet die historische Entwicklung des Mutterliebe-Mythos und die damit verbundene Unterdrückung der Frau.
Kapitel II beleuchtet die feministische Perspektive auf Weiblichkeit und Liebe. Es werden die Ansichten von Simone de Beauvoir und Iris Young vorgestellt, die die Konstruktion von Weiblichkeit und die damit verbundenen gesellschaftlichen Normen kritisieren. Kapitel II.1 analysiert die Rolle der Liebe als weibliches Attribut und die damit verbundene Legitimation der geschlechtsspezifischen Arbeitsteilung. Kapitel II.2 beleuchtet den Einfluss von Erziehung und Sozialisation auf die Geschlechtsidentität und die Konstruktion von Weiblichkeit.
Kapitel III befasst sich mit der Frage, ob die Mutterrolle ein Konstrukt ist. Es werden Argumente gegen die Natürlichkeit der Mutterliebe vorgestellt und die Rolle der Liebe in der Entwicklung der Mutterrolle analysiert.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen die Mutterliebe, die Konstruktion von Weiblichkeit, die feministische Perspektive, die Sozialisation und Erziehung, die geschlechtsspezifische Arbeitsteilung und die Kritik an der Natürlichkeit der Mutterrolle. Der Text analysiert die historische Entwicklung des Mutterliebe-Mythos und die damit verbundene Unterdrückung der Frau. Er beleuchtet die Rolle der Liebe in der Konstruktion von Weiblichkeit und die Auswirkungen von Sozialisation und Erziehung auf die Geschlechtsidentität.
Häufig gestellte Fragen
Ist Mutterliebe ein natürlicher Instinkt?
Die Arbeit analysiert die These von Elisabeth Badinter, dass Mutterliebe kein angeborener Instinkt, sondern ein historisch gewachsenes soziales Konstrukt ist.
Wie wurde der Mythos der Mutterliebe historisch genutzt?
Er diente oft dazu, Frauen in den Reproduktionsbereich (Haus und Kinder) zu drängen und ihre Unterordnung unter den Mann biologisch zu legitimieren.
Welchen Einfluss hat die Sozialisation auf die Mutterrolle?
Feministische Perspektiven betonen, dass Weiblichkeit und mütterliches Verhalten durch Erziehung und gesellschaftliche Erwartungen erlernt werden.
Was kritisierte Simone de Beauvoir an der Rolle der Frau?
Sie prägte den Satz „Man kommt nicht als Frau zur Welt, man wird es“ und kritisierte die Zuweisung der Frau als „das andere Geschlecht“.
Welche Rolle spielt die Psychoanalyse in dieser Debatte?
Die Arbeit beleuchtet die Kritik an Freuds phallogozentrischen Normvorstellungen, die Frauen oft als passiv und masochistisch darstellten.
- Citation du texte
- Louisa Lang (Auteur), 2014, Mutterliebe. Nur ein Mythos?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/278094