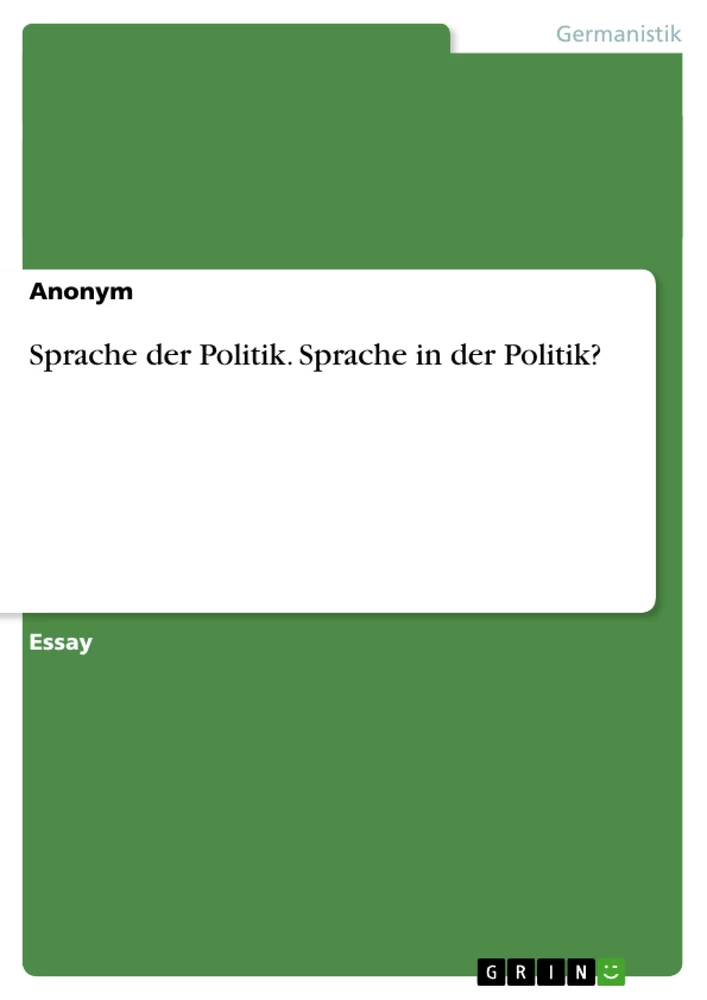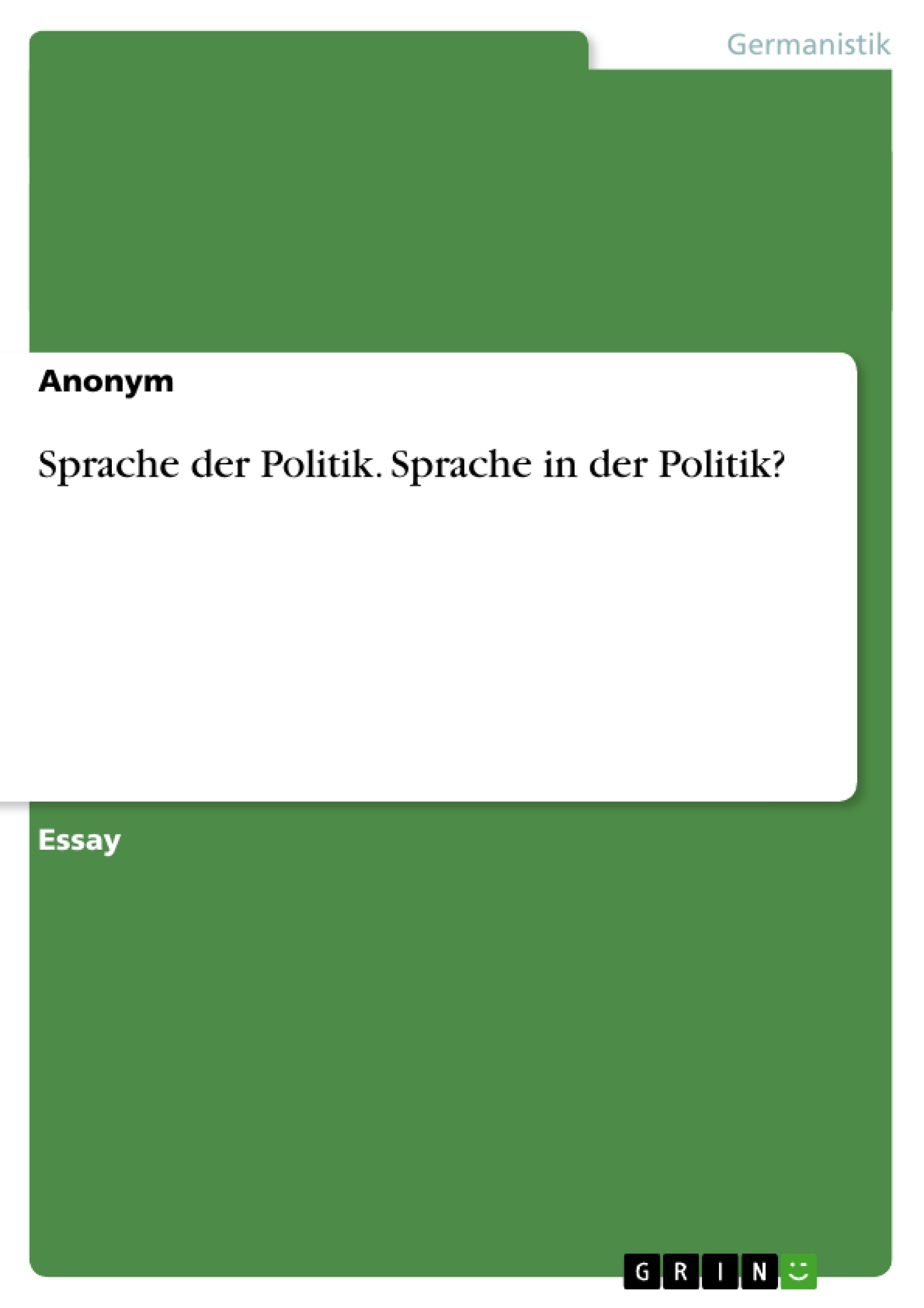Das Essay gibt einen Überblick über Themenbereiche und Ergebnisse des sprachwissenschaftlichen Teilbereichs "Sprache in der Politik" und geht hierbei auf die Frage ein, ob es eine eigene Sprache der Politik oder "lediglich" Sprache in der Politik gibt.
Inhaltsverzeichnis
- Sprache der Politik - Sprache in der Politik?
- Linguistische Definitionen von Politik
- Sprache und Ideologie
- Forschungsüberblick
- Sprache und Politik: Bewertung
- Sprache-und-Politik-Forschung: Bereiche
- Sprache im Nationalsozialismus
- Sprache in der DDR
- Sprache der Wende
- Pragmalinguistische Grundlagen
- Öffentlichkeit und Politik
- Mehrfachadressiertheit
- Handlungsfeld der Sprache in der Politik
- Sprachfunktionen in der Politik
- Das Lexikon der Politik
- Nominationsakte
- Persuasion
- Fazit
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Der Essay befasst sich mit der Sprache der Politik und untersucht die vielfältigen Funktionen und Besonderheiten der Sprachverwendung in diesem Kontext. Er analysiert die Beziehung zwischen Sprache und Politik, die Rolle der Ideologie, die Entwicklung der Sprache-und-Politik-Forschung sowie die pragmalinguistischen Grundlagen der politischen Kommunikation.
- Die enge Verbindung von Sprache und Politik
- Die Rolle der Ideologie in der politischen Kommunikation
- Die Entwicklung der Sprache-und-Politik-Forschung
- Pragmalinguistische Grundlagen der politischen Kommunikation
- Die verschiedenen Sprachfunktionen in der Politik
Zusammenfassung der Kapitel
Der Essay beginnt mit einer Einführung in das Thema Sprache der Politik und stellt die These auf, dass Sprache nicht nur ein Instrument der Politik ist, sondern die Bedingung ihrer Möglichkeit. Es werden verschiedene linguistische Definitionen von Politik vorgestellt, die die enge Verbindung von Öffentlichkeit und Politik hervorheben. Anschließend wird die Rolle der Ideologie in der politischen Kommunikation beleuchtet und die Unterscheidung zwischen einer Alltagsdefinition und einer wertneutralen Definition von Ideologie erläutert.
Im weiteren Verlauf des Essays wird ein Forschungsüberblick über die Sprache-und-Politik-Forschung der letzten Jahrzehnte gegeben. Es werden zwei Hauptrichtungen unterschieden: die lexikonorientierte und die text-diskursive Richtung. Die lexikonorientierte Richtung untersucht die Wirkungskraft von Wörtern im Persuasionsprozess, während die text-diskursive Richtung den Blickwinkel um die Komponente Text erweitert und die Bedeutung des Kontextes für die Interpretation von Wörtern betont.
Der Essay befasst sich anschließend mit der Frage, ob die Sprache-und-Politik-Forschung Sprache bewerten darf. Es werden ein sprachkritischer Ansatz und ein sprachwissenschaftlicher Ansatz unterschieden. Der sprachkritische Ansatz bewertet den Untersuchungsgegenstand, während der sprachwissenschaftliche Ansatz diesen lediglich beschreibt. Der Essay stellt fest, dass selbst eine deskriptive Analyse sprachkritisch sein kann, da sie das aufdeckt, was Politiker bei ihren Äußerungen womöglich lieber verborgen hätten.
Im weiteren Verlauf des Essays werden drei Bereiche der Sprache-und-Politik-Forschung näher beleuchtet: Sprache im Nationalsozialismus, Sprache in der DDR und Sprache der Wende. Im Bereich Sprache im Nationalsozialismus wird der Missbrauch von Wörtern während des Nationalsozialismus untersucht und das Weiterleben dieser Wörter in den Köpfen der Menschen thematisiert. Im Bereich Sprache in der DDR wird die Sprachlenkung in totalitären Staaten untersucht, insbesondere der Versuch, die Kommunikation bewusst und zielgerichtet zu verändern.
Der Essay befasst sich anschließend mit der Sprache der Wende und untersucht die Rolle der Sprache in der Revolution und der Wiedervereinigung Deutschlands. Es werden die verschiedenen Sprechhaltungen, Stile und Redeweisen in Ost- und Westdeutschland analysiert. Der Essay stellt fest, dass ostdeutsches Sprechen eher als langsam, ruhig, monoton, leiernd oder roboterhaft empfunden wird, während man hingegen schnelles, akzentuiertes Sprechen sowie deutliche und sinnhafte Pausensetzungen als Merkmale westlichen Sprechens ansieht.
Im weiteren Verlauf des Essays werden die pragmalinguistischen Grundlagen der Sprache-und-Politik-Forschung erläutert. Es wird betont, dass Sprache kein Selbstzweck ist, sondern stets in bestimmten Situationen stattfindet, sich immer an ein Gegenüber richtet und zielorientiert ist. Die primäre Intention eines Politikers ist es, Zustimmung seitens der Öffentlichkeit zu erreichen. Der Essay stellt fest, dass politisches Handeln und somit Sprechen zu einem großen Teil öffentlich stattfindet und demnach auf die Öffentlichkeit bezogen ist.
Der Essay befasst sich anschließend mit dem Merkmal der Mehrfachadressiertheit in der Sprache der Politik. Es wird festgestellt, dass eine sprachliche Handlung meist an mehrere Adressaten gleichzeitig gerichtet ist. Der Essay erläutert die Bedeutung der Inszenierung in der politischen Kommunikation, bei der eine Diskussion zwischen zwei politischen Gegnern inszeniert wird, während die eigentliche Intention die Persuasion des Publikums/der Öffentlichkeit ist.
Der Essay differenziert die Sprache in der Politik in vier Handlungsfelder, denen sich spezifische Textsorten zuordnen lassen: Öffentlich-politische Meinungsbildung, Innerparteiliche Willensbildung, Politische Werbung und Gesetzgebungsverfahren. Es wird betont, dass die Handlungsfelder nicht isoliert zu betrachten sind, da sie sich gegenseitig durchdringen.
Der Essay stellt fest, dass Sprache in der Politik dieselbe ist wie im Alltag, nur überwiegt die appellative Funktion, da Politik auf das Durchsetzen von Interessen und Herrschaftsansprüchen ausgerichtet ist. Es werden verschiedene Sprachfunktionen in der Politik vorgestellt: die regulative Sprachfunktion, die poskative Sprachfunktion, die informativ-persuasive Sprachfunktion und die integrative Sprachfunktion. Es wird betont, dass die Sprachfunktionen nicht isoliert nebeneinander auftreten, sondern sich gegenseitig durchdringen.
Der Essay befasst sich anschließend mit dem Lexikon der Politik und stellt fest, dass eine Gliederung des Lexikons schwierig ist, da Politik kein eigener Sachbereich mit einem klar abgrenzbaren Fachvokabular ist, sondern ein „Handlungs- und Funktionskomplex“. Es wird zwischen dem politischen Lexikon der deutschen Sprache und dem der Bundesrepublik Deutschland differenziert.
Der Essay erläutert Nominationsakte als stellungsbeziehende, wertende Formen der Referenz. Es werden Nominationsausdrücke vorgestellt und die Funktion der Nomination als Einstellungsbekundung und Stellungnahme erläutert. Der Essay stellt fest, dass eine Nomination zur Einstellungsmodifizierung, Einstellungspolarisierung oder zur Einstellungsaffirmation dienen kann.
Der Essay befasst sich abschließend mit dem Thema Persuasion und stellt fest, dass Persuasion der Rhetorik zugerechnet wird und mit überzeugen oder überreden übersetzt wird. Es wird das klassische rhetorische Ideal des Überzeugens erläutert, bei dem die Meinungsänderung eines Gegenübers durch Argumente angestrebt wird.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen die Sprache der Politik, die Sprachverwendung in der Politik, die Rolle der Ideologie, die pragmalinguistische Wende, die verschiedenen Sprachfunktionen in der Politik, das Lexikon der Politik, Nominationsakte und Persuasion. Der Text beleuchtet die enge Verbindung von Sprache und Politik, die Bedeutung der Öffentlichkeit und die verschiedenen Strategien der politischen Kommunikation.
- Arbeit zitieren
- Anonym (Autor:in), 2012, Sprache der Politik. Sprache in der Politik?, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/278972