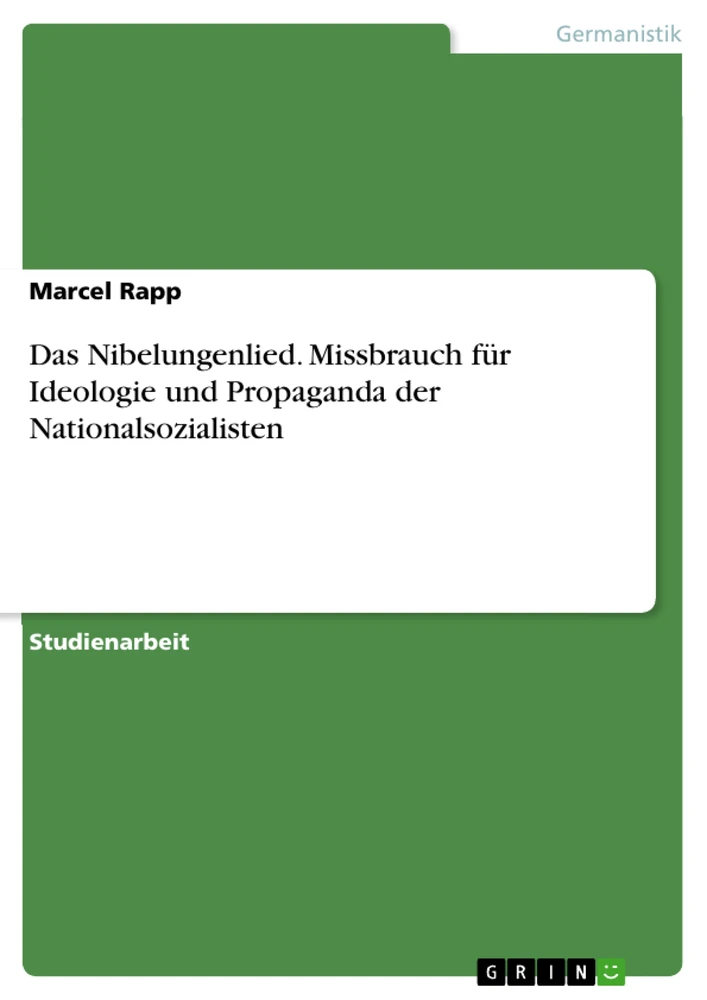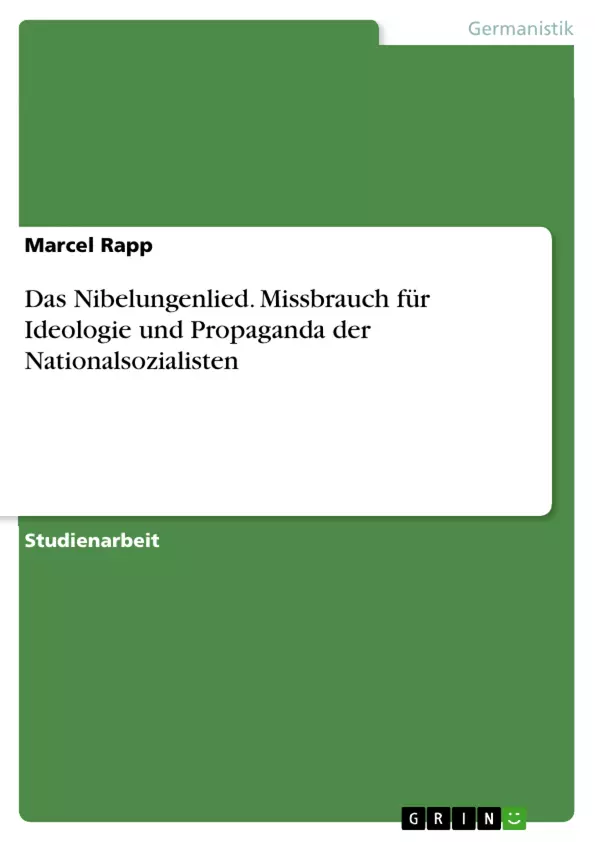„Uns ist in alten mæren wunders vil geseit
von helden lobebæren, von grôzer arebeit,
von freuden, hôchgezîten, von weinen und von klagen,
von küener recken strîten muget ir nû wunder hœren sagen.“
Diese Strophe leitet das bedeutendste Heldenepos und zeitgleich wohl namhafteste Werk der mittelalterlichen Geschichte ein, das Nibelungenlied. Das am Anfang des 13. Jahrhunderts von einem unbekannten Autor verfasste Werk schlug auch noch viele Jahrhunderte später große Wellen und gliedert sich inhaltlich in zwei Teile. Im ersten Teil wirbt Siegfried, Sohn König Siegmunds, zunächst erfolglos um Kriemhild, die Burgundenprinzessin. Es kommt zu einem Abkommen zwischen ihm und Gunther, Kriemhilds Bruder und dem ältesten der burgundischen Könige, das besagt, dass Siegfried mehrere Aufgaben zu bestehen hat, um Kriemhild zur Frau nehmen zu können. Nach erfolgreichem Bestehen vermählt er sich schließlich mit ihr und wird anschließend von Hagen von Tronje, ein Vasall Gunthers, hinterlistig getötet. Der zweite Teil behandelt die Tat Kriemhilds, ihren Mann zu rächen, indem sie sich zunächst mit dem Hunnenkönig Etzel vermählt und die Burgunder samt Hagen zu ihrer Hochzeit einlädt. In einem blutigen Kampf zwischen den Burgundern und Hunnen gelingt Kriemhild zwar erfolgreich die Rache, wird am Ende dieses Heldenepos jedoch selbst getötet, wodurch das Nibelungenlied schließlich mit dem Untergang der burgundischen Herrschaft endet. Im Fokus dieser deutschen Heldendichtung stehen unter anderem die Eigenschaften und Taten des Drachentöters Siegfried. Als „Muster des neuen adligen Menschenbildes“ wird er als Idealbild eines Helden dargestellt. Mit adligen Wurzeln wird er überdies als besonders tapfer und stark, anmutig und gebildet geschildert. Neben Treue und Furchtlosigkeit lassen sich im Nibelungenlied weitere Werte wie Militarismus, Tapferkeit und Nationalismus wieder finden. Seitdem die Handschriften des Nibelungenlieds im Jahre 1755 von Jacob Hermann Obereit wiederentdeckt wurden, blitzten die damit in Verbindung gebrachten Werte immer wieder in der deutschen Geschichte auf, sodass es zu Beginn des 20. Jahrhunderts als „Hauptwerk der deutschen Nationalliteratur“ zu verstehen war.
Inhaltsverzeichnis
- I Einleitung
- II Hauptteil
- 1 Die Vorgeschichte des Nibelungenliedes von 1755 bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts
- 2 Die Bedeutung des Nibelungenlieds im Ersten Weltkrieg
- a) Der Begriff der „triuwe“
- b) Der Begriff der „Nibelungentreue“ und weitere ideologische Berufungen im Ersten Weltkrieg
- 3 Die Berufung auf das Nibelungenlied in der Zeit des Nationalsozialismus
- a) Die politische Berufung
- b) Die Berufung in Lyrik und Literatur
- c) Die Berufung im Schulwesen
- 4 Die Verwendung des Nibelungenlieds nach dem Ende des Dritten Reiches
- III Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Rezeption des Nibelungenlieds im Kontext der deutschen Geschichte, insbesondere mit dessen Indienstnahme durch den Nationalsozialismus. Ziel ist es, aufzuzeigen, wie das Nibelungenlied für die Propaganda des Dritten Reiches instrumentalisiert wurde und welche Bedeutung ihm in diesem Zusammenhang zukam.
- Die Wiederentdeckung des Nibelungenlieds im 18. Jahrhundert und seine wachsende Bedeutung im 19. Jahrhundert.
- Die Verwendung des Begriffs der „triuwe“ im Kontext des Nibelungenlieds und seine Bedeutung im Ersten Weltkrieg.
- Die Instrumentalisierung des Nibelungenlieds durch die nationalsozialistische Ideologie und Propaganda.
- Die Bedeutung des Nibelungenlieds nach dem Ende des Dritten Reiches.
- Die Rolle des Nibelungenlieds als Spiegelbild der deutschen Geschichte und seiner ambivalenten Bedeutung.
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik ein und stellt das Nibelungenlied als ein bedeutendes Heldenepos der mittelalterlichen Geschichte vor. Sie erläutert die wichtigsten Handlungselemente des Werks und beleuchtet die Bedeutung des Drachentöters Siegfried als Idealbild eines Helden. Anschließend werden die verschiedenen Werte, die im Nibelungenlied ihren Niederschlag finden, wie z.B. Treue, Furchtlosigkeit, Militarismus und Nationalismus, vorgestellt. In diesem Zusammenhang wird auch die Wiederentdeckung des Nibelungenlieds im Jahre 1755 durch Jacob Hermann Obereit erwähnt und dessen Bedeutung für die deutsche Geschichte hervorgehoben.
Der Hauptteil behandelt die Rezeption des Nibelungenlieds im Kontext der deutschen Geschichte. Kapitel 1 widmet sich der Vorgeschichte des Nibelungenlieds von 1755 bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts. Es wird die Bedeutung des Werkes für die deutsche Nationalliteratur und seine Indienstnahme im Deutschunterricht des 19. Jahrhunderts beleuchtet. Kapitel 2 untersucht die Rolle des Nibelungenlieds im Ersten Weltkrieg, wobei der Begriff der „triuwe“ im Kontext des Lehnswesens näher beleuchtet wird. Kapitel 3 fokussiert auf die Verwendung des Nibelungenlieds durch die nationalsozialistische Ideologie und Propaganda. Dabei werden die Bereiche Politik, Lyrik, Literatur und Erziehungswissenschaft in den Blick genommen. Kapitel 4 thematisiert die Bedeutung des Nibelungenlieds nach dem Ende des Dritten Reiches.
Schlüsselwörter
Die zentralen Schlüsselwörter dieser Arbeit sind: Nibelungenlied, deutsche Geschichte, Nationalsozialismus, Propaganda, Ideologie, „triuwe“, Heldenepos, Siegfried, Drachentöter, Rezeption, Bedeutung, Wiederentdeckung, Deutscher Nationalismus, Militarismus, Erziehungswissenschaft, Literatur.
- Quote paper
- Marcel Rapp (Author), 2013, Das Nibelungenlied. Missbrauch für Ideologie und Propaganda der Nationalsozialisten, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/279405