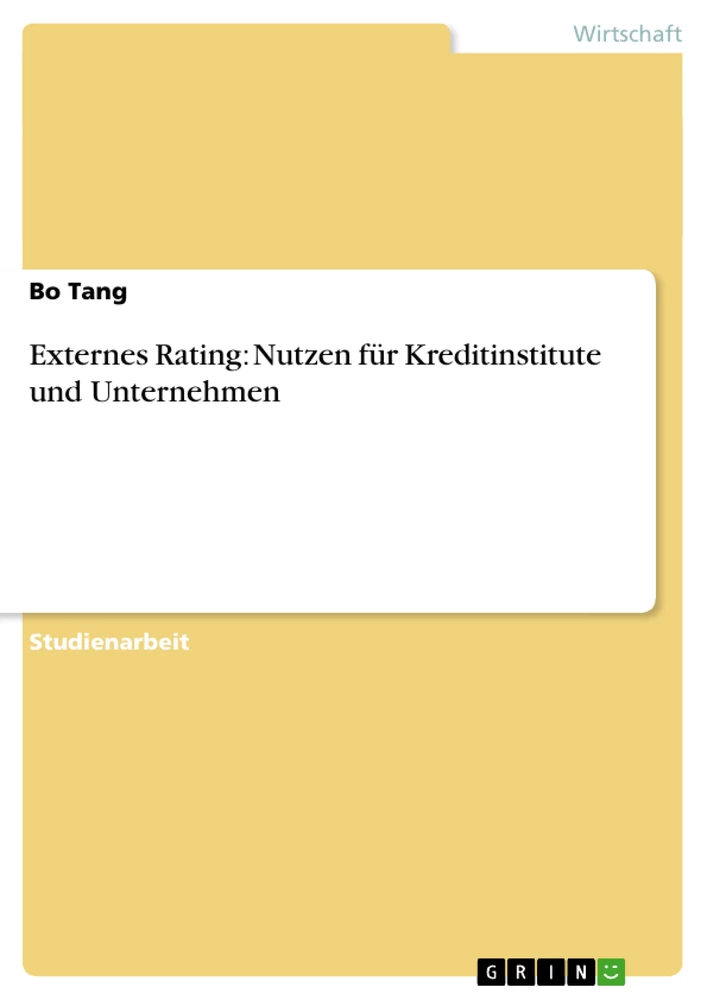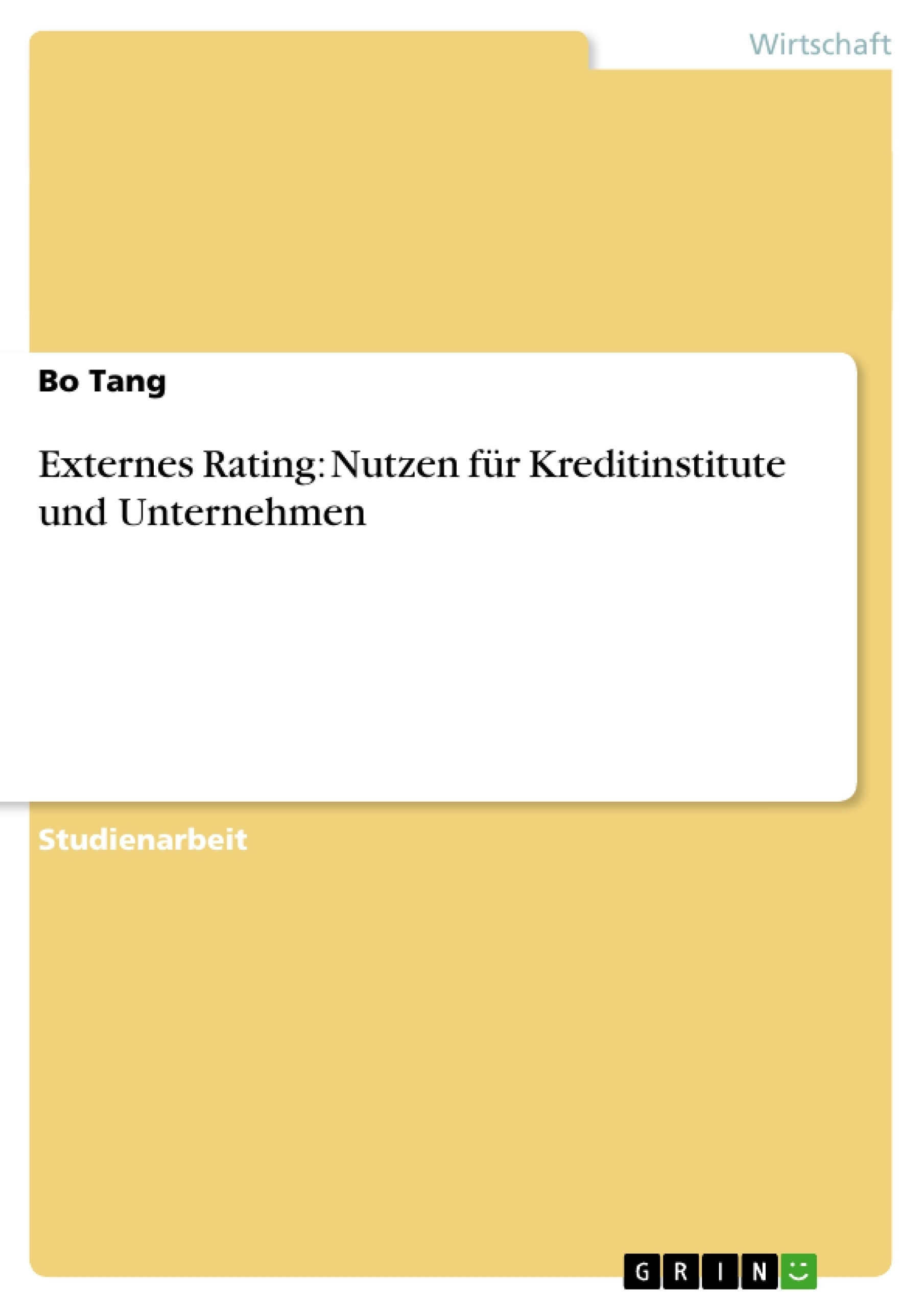Problemstellung und Gang der Untersuchung
Die zunehmende Internationalisierung der Finanzmärkte und die Globalisierung der Geschäftstätigkeit der Unternehmen führen zu einem engeren Zusammenwirken der weltweiten Geld-, Kredit- und Kapitalmärkte. Um sich der zunehmenden Komplexität der Finanzmärkte anzupassen, sind Investoren, Emittenten und andere Marktteilnehmer auf Informationsinstrumente angewiesen, die die Transparenz des Marktes erhöhen und international anerkannt sind. Rating ist ein solches Instrument, das die umfangreichen Finanzdaten und -fakten zu einem knappen Urteil komprimiert und in eine internationale Finanzsprache übersetzt.1 Während die herrschende Literaturauffassung für externes Rating spricht, hört man heute in der Diskussion häufiger die Meinung, dass externes Rating nur für große Unternehmen geeignet und für mittelständische Unternehmen zusätzlich zum bankinternen Rating überflüssig ist. Ziel der vorliegenden Arbeit ist es, vorzustellen, wie die Ratingagenturen zur Erlangung eines Ratingurteils die Bewertungskriterien auswählen und bewerten. Ausgehend von den Ratingkriterien soll aufgezeigt werden, welche Vorteile externes Rating sowohl großen und mittelständischen Unternehmen als auch Kreditinstituten bringt.
Die Arbeit beginnt mit einer kurzen Einleitung in die aktuelle Diskussion über „externes Rating“. Danach werden die begrifflichen Grundlagen zum Thema angesprochen. Anschließend wird ein kurzer Überblick über die gesetzlichen Rahmenbedingungen gegeben. Hierbei richtet sich der Schwerpunkt auf die Zielsetzung und Folgen von Basel II. Mit dem nächsten Schritt soll verdeutlicht werden, welche Ziele Unternehmen mit einem externen Rating erreichen wollen. Im weiteren Verlauf wird beleuchtet, inwiefern Unternehmen und Kreditinstitute externes Rating entsprechend der Zielsetzungen für sich nutzen können und es wird kritisch hinterfragt, wo die möglichen Schwachstellen des externen Ratings in Bezug auf Nutzen liegen. Abschließend werden die Ergebnisse der Untersuchung zusammengefasst und auf die unterschiedlichen Vorschläge eingegangen, mit welchen Maßnahmen die genannten Schwachstellen in Zukunft beseitigt werden können.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Problemstellung und Gang der Untersuchung
- 2. Externes Rating und Auswahl der Ratingkriterien
- 2.1 Begriffliche Grundlagen
- 2.2 Basel II und Rating
- 2.3 Ratingklassifikation
- 3. Nutzen des externen Ratings
- 3.1 Initiative zur Erstellung eines externen Ratings
- 3.2 Nutzen für große Unternehmen
- 3.3 Nutzen für mittelständische Unternehmen
- 3.3.1 Erhöhung der Transparenz der Unternehmensinformationen
- 3.3.2 Reduzierung der Fremdfinanzierungskosten
- 3.3.3 Erschließung der alternativen Finanzierungsquellen
- 3.3.4 Steigerung der innerbetrieblichen Effizienz
- 3.3.5 Frühwarnung vor der Unternehmenskrise
- 3.3.6 Erhöhung der Unabhängigkeit in der Hausbankbeziehung
- 3.4 Nutzen für Kreditinstitute
- 3.4.1 Reduzierung der Informationsasymmetrie
- 3.4.2 Benchmarking für das Firmenkundengeschäft
- 4. Kritische Würdigung
- 4.1 Zusammenfassung
- 4.2 Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht den Nutzen externen Ratings für Kreditinstitute und Unternehmen. Ziel ist es, die Vorteile und Herausforderungen dieser Methode der Kreditwürdigkeitsprüfung zu beleuchten. Die Arbeit analysiert die Anwendung im Kontext von Basel II und betrachtet die spezifischen Vorteile für große und mittelständische Unternehmen sowie die Auswirkungen auf die Kreditinstitute selbst.
- Begriffliche Grundlagen des externen Ratings und der Ratingklassifikation
- Der Einfluss von Basel II auf die Bedeutung des externen Ratings
- Nutzen des externen Ratings für Unternehmen (große und mittelständische)
- Nutzen des externen Ratings für Kreditinstitute
- Kritische Betrachtung der Methode und Ausblick auf zukünftige Entwicklungen
Zusammenfassung der Kapitel
1. Problemstellung und Gang der Untersuchung: Diese Einleitung beschreibt den Untersuchungsgegenstand – den Nutzen von externen Ratings für Unternehmen und Banken – und skizziert den Aufbau der Arbeit. Es wird die Relevanz des Themas im Kontext der modernen Finanzwelt herausgestellt und die Forschungsfrage präzise formuliert. Der methodische Ansatz wird kurz umrissen, um dem Leser einen Überblick über die Vorgehensweise zu geben. Die Einleitung dient als Orientierungshilfe und liefert einen roten Faden für die nachfolgenden Kapitel.
2. Externes Rating und Auswahl der Ratingkriterien: Dieses Kapitel legt die konzeptionellen Grundlagen für die weitere Analyse. Es definiert den Begriff des externen Ratings und erörtert die entscheidenden Kriterien, die bei der Bewertung der Kreditwürdigkeit berücksichtigt werden. Die Darstellung der verschiedenen Ratingklassen und ihrer Bedeutung wird hier detailliert ausgeführt. Das Kapitel liefert das notwendige Fundament für das Verständnis des späteren Nutzens externen Ratings. Der Bezug zu relevanten gesetzlichen und regulatorischen Rahmenbedingungen, insbesondere Basel II, wird hergestellt.
3. Nutzen des externen Ratings: Dieses zentrale Kapitel analysiert den Nutzen externen Ratings für verschiedene Akteursgruppen. Es werden die Vorteile für große Unternehmen, wie der verbesserte Zugang zu Kapitalmärkten und die Senkung der Finanzierungskosten, im Detail beschrieben. Die spezifischen Herausforderungen und Chancen für mittelständische Unternehmen, einschließlich der Verbesserung der Transparenz und der Erschließung neuer Finanzierungsquellen, werden ebenfalls beleuchtet. Zusätzlich wird der Nutzen für Kreditinstitute untersucht, insbesondere die Reduktion von Informationsasymmetrien und die Möglichkeiten des Benchmarkings. Das Kapitel bietet eine umfassende Darstellung der verschiedenen positiven Auswirkungen externen Ratings.
4. Kritische Würdigung: Dieses Kapitel fasst die Ergebnisse der vorherigen Kapitel zusammen und bewertet kritisch die Vor- und Nachteile des externen Ratings. Mögliche Limitationen der Methode, wie z.B. die Abhängigkeit von den zugrundeliegenden Ratingmodellen oder der Einfluss von Interessenskonflikten, werden hier diskutiert. Der Ausblick gibt einen Ausblick auf zukünftige Entwicklungen im Bereich des externen Ratings und mögliche Anpassungen an sich ändernde Rahmenbedingungen. Dieses Kapitel rundet die Arbeit ab und regt zur weiteren Diskussion des Themas an.
Schlüsselwörter
Externes Rating, Kreditwürdigkeit, Basel II, Informationsasymmetrie, Finanzierungsquellen, Mittelständische Unternehmen, Große Unternehmen, Kreditinstitute, Ratingagenturen, Kreditrisiko, Transparenz, Benchmarking.
Häufig gestellte Fragen zum Thema "Externes Rating"
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Die Arbeit untersucht den Nutzen externen Ratings für Kreditinstitute und Unternehmen. Sie beleuchtet die Vorteile und Herausforderungen dieser Methode der Kreditwürdigkeitsprüfung im Kontext von Basel II und betrachtet die spezifischen Vorteile für große und mittelständische Unternehmen sowie die Auswirkungen auf die Kreditinstitute.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit umfasst folgende Themenschwerpunkte: Begriffliche Grundlagen des externen Ratings und der Ratingklassifikation; den Einfluss von Basel II auf die Bedeutung des externen Ratings; den Nutzen des externen Ratings für große und mittelständische Unternehmen; den Nutzen des externen Ratings für Kreditinstitute; sowie eine kritische Betrachtung der Methode und einen Ausblick auf zukünftige Entwicklungen.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in vier Kapitel: Kapitel 1 beschreibt die Problemstellung und den Aufbau der Arbeit. Kapitel 2 behandelt das externe Rating und die Auswahl der Ratingkriterien, inklusive der Begrifflichen Grundlagen und des Bezugs zu Basel II. Kapitel 3 analysiert den Nutzen des externen Ratings für verschiedene Akteursgruppen (große und mittelständische Unternehmen sowie Kreditinstitute). Kapitel 4 bietet eine kritische Würdigung der Ergebnisse und einen Ausblick.
Welche Vorteile bietet externes Rating für Unternehmen?
Für große Unternehmen bietet externes Rating verbesserten Zugang zu Kapitalmärkten und niedrigere Finanzierungskosten. Mittelständische Unternehmen profitieren von erhöhter Transparenz, reduzierten Fremdfinanzierungskosten, Erschließung alternativer Finanzierungsquellen, gesteigerter innerbetrieblicher Effizienz, Frühwarnung vor Unternehmenskrisen und erhöhter Unabhängigkeit in der Hausbankbeziehung.
Welche Vorteile bietet externes Rating für Kreditinstitute?
Für Kreditinstitute reduziert externes Rating die Informationsasymmetrie und ermöglicht Benchmarking für das Firmenkundengeschäft.
Welche kritischen Aspekte werden in der Arbeit berücksichtigt?
Die Arbeit diskutiert kritisch mögliche Limitationen des externen Ratings, wie die Abhängigkeit von den zugrundeliegenden Ratingmodellen oder den Einfluss von Interessenskonflikten. Der Ausblick beleuchtet zukünftige Entwicklungen und mögliche Anpassungen an sich ändernde Rahmenbedingungen.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Die wichtigsten Schlüsselwörter sind: Externes Rating, Kreditwürdigkeit, Basel II, Informationsasymmetrie, Finanzierungsquellen, Mittelständische Unternehmen, Große Unternehmen, Kreditinstitute, Ratingagenturen, Kreditrisiko, Transparenz, Benchmarking.
Wo finde ich detaillierte Informationen zu den einzelnen Kapiteln?
Die Zusammenfassung der Kapitel bietet eine detaillierte Übersicht über den Inhalt jedes einzelnen Kapitels, einschließlich der behandelten Themen und der zentralen Aussagen.
- Quote paper
- Bo Tang (Author), 2004, Externes Rating: Nutzen für Kreditinstitute und Unternehmen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/27955