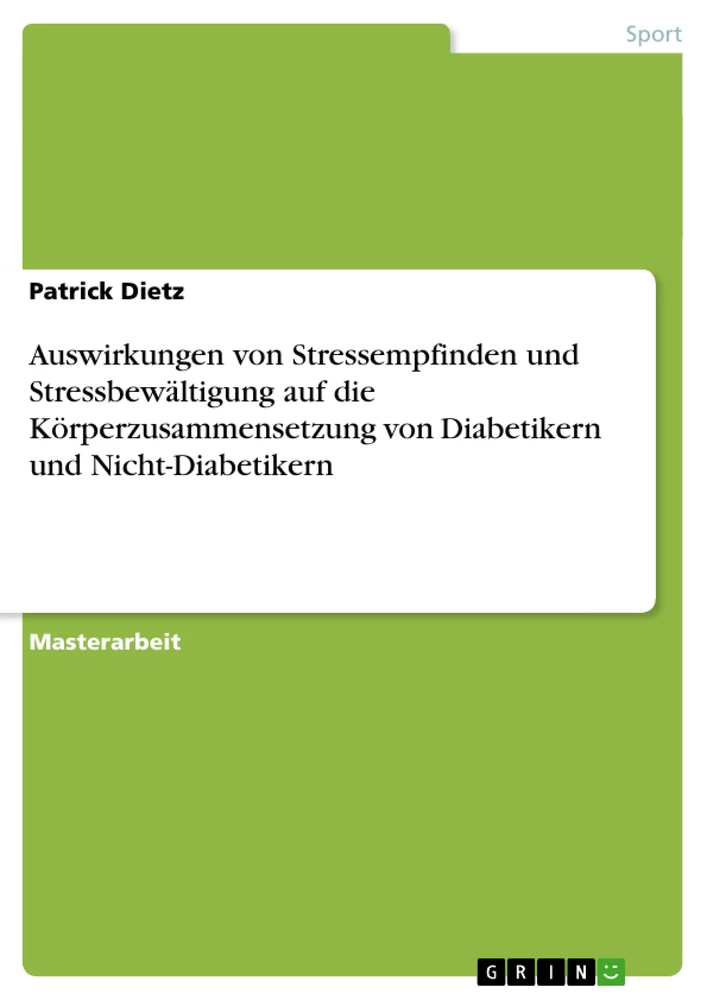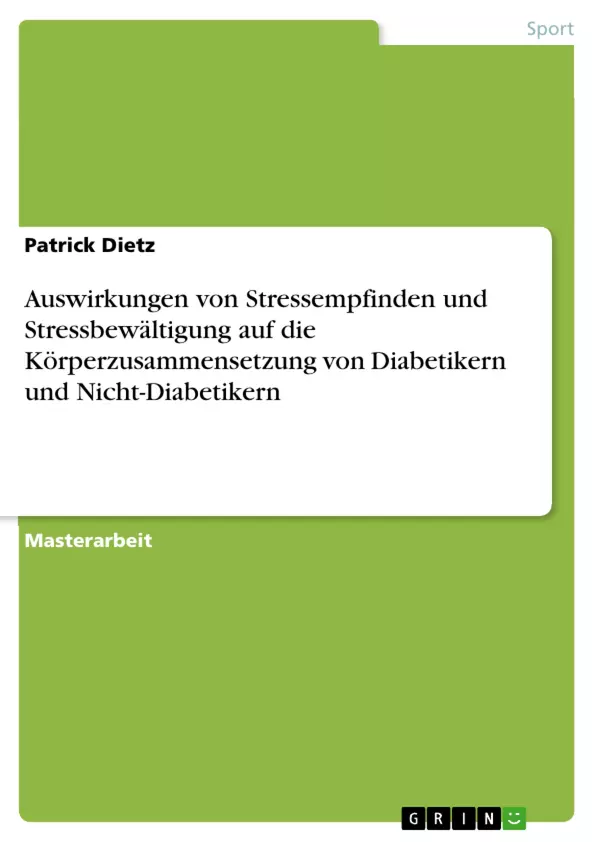Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit den Auswirkungen von Stressempfinden und Stressbewältigung auf die Körperzusammensetzung von Diabetikern und Nicht-Diabetikern. Hierzu bedarf es in einem ersten Kapitel einer Erläuterung der Diabeteserkrankung, sowie ihrer Erscheinungsformen und verschiedener Faktoren, die bei der Untersuchung bezüglich der Körperbauwerte von Bedeutung sind. Das zweite Kapitel setzt sich mit dem Phänomen Stress auseinander und erläutert anhand verschiedener Modelle wesentliche wissenschaftliche Grundlagen innerhalb der Stressforschung. Anschließend werden diese beiden Faktoren in ein Abhängigkeitsverhältnis übertragen und ein thematischer Zusammenhang hergestellt. Das darauf folgende Kapitel zeigt Formen der Stressbewältigung auf und verdeutlicht anhand unterschiedlicher Copingmodelle Möglichkeiten der Bewältigung negativer Stresssituationen. Gegenstand des nächsten Abschnittes wird die Erläuterung eines Körperzusammensetzungsmodells mit anschließender Hypothesenformulierung der zu erarbeitenden Studie. Im siebten Kapitel werden Messinstrumente vorgestellt, die zur Auswertung der Hypothesen im Folgekapitel verwendet werden. Dementsprechend erfolgt im achten Kapitel die Darlegung und Interpretation der ermittelten Untersuchungswerte, wobei abschließend die Ergebnisse zu den Auswirkungen von Stressempfinden und Stressbewältigung auf die Körperzusammensetzung von Diabetikern und Nicht-Diabetikern dargestellt werden. Dabei ist die Zusammenstellung der Haupthypothesen mit dem Bau einer Brücke zu vergleichen. Zunächst erfolgt die Errichtung der verschiedenen Pfeiler, die das Gesamtkonstrukt stützen soll. Durch die subjektiven Angaben der Probanden werden zunächst verschiedene Faktoren miteinander verknüpft, um diese abschließend mit objektiv ermittelten Ergebnissen zu verknüpfen und bewerten zu können.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Diabetes mellitus
- 2.1 Etymologi von Diabetes mellitus
- 2.2 Pathophysiologie von Diabetes
- 2.3 Erscheinungsformen von Diabetes mellitus
- 2.3.1 Typ-1-Diabetes
- 2.3.2 Typ-2-Diabetes
- 2.4 Psychologische Faktoren bei Diabetes
- 2.5 Diabetes und Ernährung
- 2.6 Diabetes und Sport
- 2.7 Diabetes mellitus als Zivilisationskrankheit
- 3 Stress
- 3.1 Entstehungsformen von Stress
- 3.2 Mögliche Ursachen und Stressoren
- 3.3 Stresssignale und -folgen
- 3.4 Stresstheoretische Modelle
- 3.4.1 Reaktionsorientierte Stressmodelle
- 3.4.2 Reizorientiertes Stressmodell
- 3.4.3 Die klassische kognitiv-transaktionale Stresstheorie
- 4 Auswirkungen von Stress auf die Zivilisationskrankheit Diabetes
- 5 Stressprävention und Coping
- 5.1 Stressprävention
- 5.2 Bewältigungsstrategien und Copingmodelle
- 5.2.1 Problemorientierte Stressbewältigung
- 5.2.2 Emotionsorientierte Stressbewältigung
- 5.3 Stressbewältigung durch Sport
- 5.4 Ressourcenmanagement
- 5.5 Progressive Muskelentspannung
- 6 Hypothesen zur Auswirkung von Stressempfinden und Stressbewältigung auf die Körperzusammensetzung von Diabetikern und Nicht-Diabetikern
- 6.1 Die Körperzusammensetzung des Menschen
- 6.2 Hypothesenformulierung
- 6.2.1 Sportverhalten bezüglich der Gesundheit im Allgemeinen
- 6.2.2 Sportverhalten bezüglich des Stressempfindens und der Stressbewältigung
- 6.2.3 Hypothesen bezüglich der Auswirkungen von Stressempfinden und Stressbewältigung auf die Körperzusammensetzung
- 7 Messinstrumente zur Erfassung der Körperzusammensetzung und des Stressempfindens
- 7.1 Bioelektrische Impedanzmessung
- 7.2 Fragebogen
- 8 Auswertung der Ergebnisse der bioelektrischen Impedanzmessungen und der Fragebögen im Hinblick auf die formulierten Hypothesen
- 8.1 Auswertung der Hypothesen zum Sportverhalten bezüglich der Gesundheit im Allgemeinen
- 8.2 Auswertung der Hypothesen zum Sportverhalten bezüglich des Stressempfindens und der Stressbewältigung
- 8.3 Auswertung der Hypothesen bezüglich der Auswirkungen von Stressempfinden und Stressbewältigung auf die Körperzusammensetzung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Master-Thesis untersucht den Einfluss von Stress und Stressbewältigung auf die Körperzusammensetzung von Diabetikern und Nicht-Diabetikern. Ziel ist es, den Zusammenhang zwischen Stresslevel, Bewältigungsstrategien und körperlichen Merkmalen zu analysieren.
- Der Einfluss von Stress auf Diabetiker
- Die Rolle von Sport und Bewegung bei der Stressbewältigung
- Zusammenhang zwischen Körperzusammensetzung und Stress
- Unterschiede im Stresserleben und -management zwischen Diabetikern und Nicht-Diabetikern
- Analyse verschiedener Stressbewältigungsstrategien
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der Masterarbeit ein und beschreibt die Relevanz der Untersuchung des Zusammenhangs zwischen Stress, Stressbewältigung und Körperzusammensetzung bei Diabetikern und Nicht-Diabetikern. Sie skizziert die Forschungsfrage und die Methodik der Arbeit.
2 Diabetes mellitus: Dieses Kapitel bietet einen umfassenden Überblick über Diabetes mellitus, inklusive seiner Etymologie, Pathophysiologie und Erscheinungsformen (Typ 1 und Typ 2). Es beleuchtet die psychologischen Faktoren, die Rolle von Ernährung und Sport sowie den Aspekt von Diabetes als Zivilisationskrankheit. Die detaillierte Darstellung der verschiedenen Diabetes-Formen und ihrer Auswirkungen bildet die Grundlage für das Verständnis des Einflusses von Stress auf diese Erkrankung.
3 Stress: Dieses Kapitel definiert Stress und seine Entstehung, mögliche Ursachen und Stressoren. Es werden Stresssignale und -folgen erläutert, sowie verschiedene stresstheoretische Modelle (reaktionsorientiert, reizorientiert und die kognitiv-transaktionale Stresstheorie) vorgestellt und verglichen. Die verschiedenen Modelle dienen als Rahmen für die spätere Analyse des Stressempfindens und der Bewältigungsmechanismen der Probanden.
4 Auswirkungen von Stress auf die Zivilisationskrankheit Diabetes: Dieses Kapitel untersucht den direkten Zusammenhang zwischen Stress und der Erkrankung Diabetes. Es beleuchtet, wie Stress die Krankheitsentwicklung und -verlauf beeinflussen kann und welche Mechanismen dahinterstecken.
5 Stressprävention und Coping: Dieses Kapitel befasst sich mit verschiedenen Strategien zur Stressprävention und -bewältigung. Es werden sowohl problem- als auch emotionsorientierte Bewältigungsmechanismen diskutiert, wobei der Fokus auf der Rolle von Sport und Bewegung, Ressourcenmanagement und progressiver Muskelentspannung liegt. Die verschiedenen Coping-Strategien bilden einen wichtigen Kontext für die spätere Analyse der von den Probanden angewandten Bewältigungsmechanismen.
6 Hypothesen zur Auswirkung von Stressempfinden und Stressbewältigung auf die Körperzusammensetzung von Diabetikern und Nicht-Diabetikern: Dieses Kapitel formuliert die Hypothesen der Studie, die den Zusammenhang zwischen Stressempfinden, Stressbewältigung und der Körperzusammensetzung bei Diabetikern und Nicht-Diabetikern untersuchen. Es definiert die relevanten Variablen und legt die Grundlage für die spätere statistische Auswertung.
7 Messinstrumente zur Erfassung der Körperzusammensetzung und des Stressempfindens: Dieses Kapitel beschreibt die eingesetzten Messinstrumente, nämlich die bioelektrische Impedanzmessung zur Erfassung der Körperzusammensetzung und den Fragebogen zur Erhebung des Stressempfindens und der Stressbewältigungsstrategien. Die detaillierte Beschreibung der Messmethoden gewährleistet die Transparenz und Reproduzierbarkeit der Studie.
Schlüsselwörter
Diabetes mellitus, Typ-1-Diabetes, Typ-2-Diabetes, Stress, Stressbewältigung, Körperzusammensetzung, Sport, Ernährung, Zivilisationskrankheit, Bioelektrische Impedanzmessung, Fragebogen, Hypothesentestung.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Masterarbeit: Auswirkungen von Stress und Stressbewältigung auf die Körperzusammensetzung von Diabetikern und Nicht-Diabetikern
Was ist der Gegenstand dieser Masterarbeit?
Diese Masterarbeit untersucht den Einfluss von Stress und Stressbewältigung auf die Körperzusammensetzung von Diabetikern und Nicht-Diabetikern. Das zentrale Ziel ist die Analyse des Zusammenhangs zwischen Stresslevel, Bewältigungsstrategien und körperlichen Merkmalen beider Gruppen.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt umfassend Diabetes mellitus (inklusive Etymologie, Pathophysiologie, Typ-1 und Typ-2 Diabetes), Stress (Entstehung, Ursachen, Stressoren, Stressmodelle), die Auswirkungen von Stress auf Diabetes, verschiedene Stresspräventions- und Bewältigungsstrategien (Problem- und Emotionsorientiert, Sport, Ressourcenmanagement, progressive Muskelentspannung), die Körperzusammensetzung des Menschen, und die Hypothesenbildung und -prüfung mithilfe von bioelektrischen Impedanzmessungen und Fragebögen.
Welche Forschungsfragen werden in der Arbeit untersucht?
Die Arbeit untersucht den Einfluss von Stress auf Diabetiker, die Rolle von Sport bei der Stressbewältigung, den Zusammenhang zwischen Körperzusammensetzung und Stress, Unterschiede im Stresserleben und -management zwischen Diabetikern und Nicht-Diabetikern und analysiert verschiedene Stressbewältigungsstrategien. Konkret werden Hypothesen zum Zusammenhang zwischen Stressempfinden, Stressbewältigung und Körperzusammensetzung aufgestellt und geprüft.
Welche Methoden werden in der Studie eingesetzt?
Zur Erfassung der Körperzusammensetzung wird die bioelektrische Impedanzmessung verwendet. Das Stressempfinden und die Stressbewältigungsstrategien werden mittels Fragebögen erhoben. Die Auswertung der Daten erfolgt im Hinblick auf die zuvor formulierten Hypothesen.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in mehrere Kapitel: Einleitung, Diabetes mellitus (inkl. detaillierter Beschreibung der verschiedenen Diabetesformen), Stress (inkl. verschiedener Stressmodelle), Auswirkungen von Stress auf Diabetes, Stressprävention und Coping, Hypothesenformulierung, Beschreibung der Messinstrumente (bioelektrische Impedanzmessung und Fragebögen), und die Auswertung der Ergebnisse im Hinblick auf die formulierten Hypothesen.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit am besten?
Diabetes mellitus, Typ-1-Diabetes, Typ-2-Diabetes, Stress, Stressbewältigung, Körperzusammensetzung, Sport, Ernährung, Zivilisationskrankheit, Bioelektrische Impedanzmessung, Fragebogen, Hypothesentestung.
Welche Hypothesen werden in der Arbeit untersucht?
Die Arbeit formuliert Hypothesen zum Sportverhalten bezüglich der Gesundheit im Allgemeinen, zum Sportverhalten bezüglich des Stressempfindens und der Stressbewältigung, und zu den Auswirkungen von Stressempfinden und Stressbewältigung auf die Körperzusammensetzung bei Diabetikern und Nicht-Diabetikern. Diese Hypothesen werden im Rahmen der Studie geprüft.
Welche konkreten Stressmodelle werden betrachtet?
Die Arbeit betrachtet reaktionsorientierte Stressmodelle, reizorientierte Stressmodelle und die klassische kognitiv-transaktionale Stresstheorie.
Welche Stressbewältigungsstrategien werden untersucht?
Die Arbeit untersucht problemorientierte und emotionsorientierte Stressbewältigung, sowie die Rolle von Sport, Ressourcenmanagement und progressiver Muskelentspannung.
Für wen ist diese Arbeit relevant?
Diese Arbeit ist relevant für Wissenschaftler, die sich mit Diabetes, Stress, Stressbewältigung und Körperzusammensetzung befassen, sowie für Praktiker im Gesundheitswesen, die an der Entwicklung von Interventionsstrategien interessiert sind. Sie bietet Einblicke in den Zusammenhang zwischen psychischen und physischen Faktoren bei Diabetikern.
- Quote paper
- Patrick Dietz (Author), 2012, Auswirkungen von Stressempfinden und Stressbewältigung auf die Körperzusammensetzung von Diabetikern und Nicht-Diabetikern, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/279730