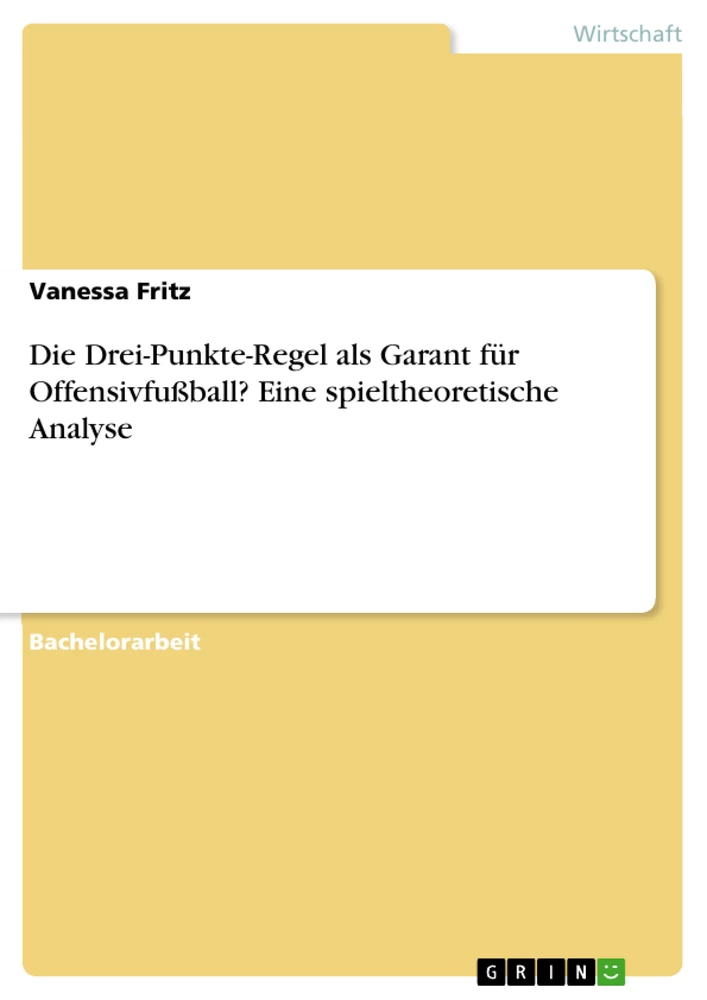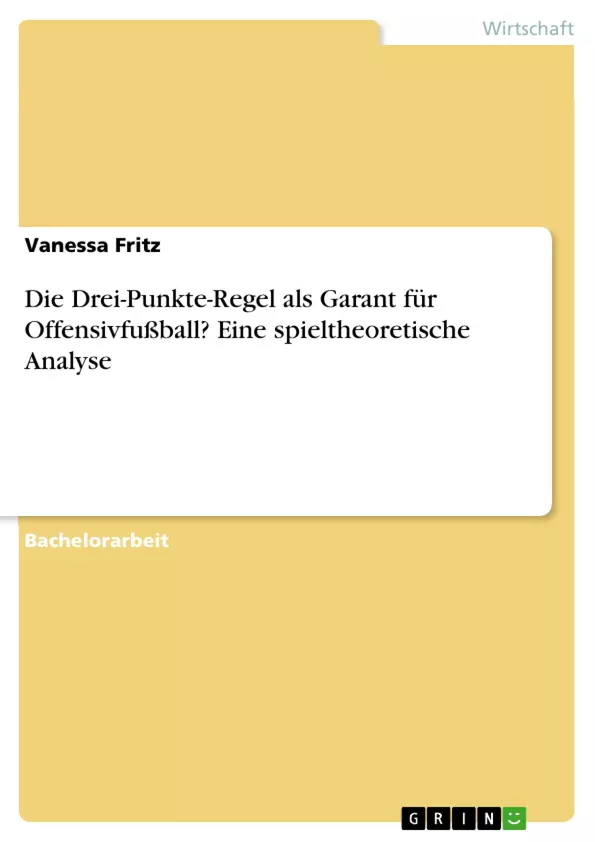Fußball bedeutet Gefühle zusammen zu erleben, Identifikation, Konkurrenz, Motivation, Integration, die Unberechenbarkeit des Augenblicks und Spannung bis zur letzten Minute. Er ist eine Macht, die ein ganzes Leben bestimmen kann, die keinen Halt macht vor Menschen mit unterschiedlicher Hautfarbe, Konfession oder verschiedener Generationen. Doch was genau zeichnet diese einzigartige „Faszination Fußball“ aus? Woher kommt die universelle Anziehungskraft dieser Sportart, die man auf der ganzen Welt spüren kann und es egal ist, ob man Profispieler, Freizeitkicker oder einfach nur Zuschauer ist? Sind es nur, die zu Beginn aufgezählten Eigenschaften dieses Spiels? Wohl kaum, denn in erster Linie ist es viel mehr die Einfachheit des Spiels, die den Fußball so besonders macht. Um Fußball zu spielen braucht man nicht viel: einen Ball, zwei Tore, die auch schon mal aus Bäumen bestehen können, und ein paar Mitspieler. Auch die eigentlichen Regeln sind nicht sehr komplex, es gibt zehn Feldspieler und einen Torwart, der den Ball als einziger in die Hand nehmen darf, das Spiel dauert 90 Minuten und gewonnen hat die Mannschaft, welche die meisten Tore erzielt. Das ist Fußball und doch immer mehr als ein Spiel! Anfang der achtziger Jahre jedoch stellte sich die Frage nach einer möglichen Bedrohung für genau diese Faszination. Es gab zunehmend Kritik an der Art und Weise, wie die einzelnen Mannschaften ein Spiel bestritten. Die Kritiker bemängelten eine zu defensive Spielweise, die mit zu wenigen Toren und zu vielen Unentschieden verbunden war. Durch zu seltenen Offensivfußball und dem damit verbundenen Spannungsverlust, sah man die Attraktivität des Fußballs gefährdet. So kam es schließlich dazu, dass in der Saison 1995/1996 die Drei-Punkte-Regel weltweit eingeführt wurde.
Inhaltsverzeichnis
- Vorwort
- Inhaltsverzeichnis
- Abbildungsverzeichnis
- Tabellenverzeichnis
- Abkürzungsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Der Weg von der Zwei-Punkte-Regel hin zur Drei-Punkte-Regel
- 2.1 Die Geschichte des Fußballs
- 2.2 21. Jahrhundert: Fußball wird zu einem „Produkt“
- 2.3 Die Einführung der Drei-Punkte-Regel
- 3 Eine Verbindung zwischen Fußball und Spieltheorie
- 3.1 Fußball-eine kontinuierliche Strategie
- 3.2 Das Spiel-eine Aneinanderreihung mehrerer Spiele
- 3.3 Vom Nullsummenspiel zum Nicht-Nullsummenspiel
- 4 Spieltheoretische Analyse der Einführung der Drei-Punkt-Regel
- 4.1 Einführung: Modell-,,Bundesliga"
- 4.2 Die Einflussfaktoren: „Skill, Strategy and Passion“
- 4.2.1 Strategiewahl unter der Zwei-Punkte-Regel
- 4.2.2 Erweiterung der Analyse um die Drei-Punkte-Regel
- 4.3 Spieltheoretische und empirische Ergebnisse
- 5 Kritische Auseinandersetzung
- 5.1 Die Drei-Punkte-Regel: Eine Regeländerung mit verfehlter Wirkung
- 5.2 Ausblick: Wie kann offensiver Fußball gefördert werden?
- 6 Fazit: Fußballerische Notwendigkeit oder reine Marketingstrategie?
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Bachelorarbeit analysiert die Einführung der Drei-Punkte-Regel im Fußball mithilfe spieltheoretischer Modelle. Ziel ist es, die Auswirkungen dieser Regeländerung auf die Spielweise und die Attraktivität des Fußballs zu untersuchen.
- Die Geschichte des Fußballs und die Entwicklung der Spielweise
- Die spieltheoretischen Grundlagen des Fußballs
- Die Auswirkungen der Drei-Punkte-Regel auf die Spielstrategie
- Die empirische Analyse der Spielweise vor und nach der Einführung der Drei-Punkte-Regel
- Die kritische Bewertung der Drei-Punkte-Regel und mögliche Alternativen zur Förderung offensiven Fußballs
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel führt in die Thematik der Drei-Punkte-Regel ein und beleuchtet die historische Entwicklung des Fußballs sowie die Kritik an der defensiven Spielweise in den 1980er Jahren. Kapitel zwei analysiert die Einführung der Drei-Punkte-Regel im Kontext der Kommerzialisierung des Fußballs. Kapitel drei stellt die Verbindung zwischen Fußball und Spieltheorie her und erläutert die spieltheoretischen Grundlagen des Fußballs. Kapitel vier untersucht die Auswirkungen der Drei-Punkte-Regel auf die Spielstrategie mithilfe eines spieltheoretischen Modells. Kapitel fünf analysiert die empirischen Ergebnisse und diskutiert die kritischen Aspekte der Drei-Punkte-Regel. Das Fazit fasst die Ergebnisse der Arbeit zusammen und diskutiert die Notwendigkeit der Drei-Punkte-Regel im Kontext der Attraktivität des Fußballs.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen die Drei-Punkte-Regel, Offensivfußball, Spieltheorie, Nullsummenspiel, Nicht-Nullsummenspiel, Fußballstrategie, Kommerzialisierung des Fußballs, Attraktivität des Fußballs, empirische Analyse, Regeländerung, Marketingstrategie.
Häufig gestellte Fragen
Warum wurde die Drei-Punkte-Regel im Fußball eingeführt?
Sie wurde 1995/96 weltweit eingeführt, um den Anreiz für Siege zu erhöhen und defensives Spiel (das auf ein Unentschieden abzielt) unattraktiver zu machen.
Wie hilft die Spieltheorie bei der Analyse dieser Regel?
Die Spieltheorie untersucht die strategische Wahl der Mannschaften (Offensive vs. Defensive) basierend auf der Auszahlung (Punkte), um das optimale Verhalten vorherzusagen.
Hat die Regel den Fußball wirklich offensiver gemacht?
Die empirischen Ergebnisse sind gemischt; zwar wird mehr auf Sieg gespielt, aber die Angst vor einer Niederlage führt in manchen Spielphasen dennoch zu taktischer Vorsicht.
Was ist ein Nullsummenspiel im Fußball?
Ein Spiel, bei dem der Gewinn der einen Mannschaft genau dem Verlust der anderen entspricht. Bei Unentschieden wird dieses Gleichgewicht oft durchbrochen.
Welche Faktoren beeinflussen die Strategiewahl einer Mannschaft?
Neben der Punkteregel spielen die Spielstärke (Skill), die Leidenschaft (Passion) und der aktuelle Tabellenstand eine entscheidende Rolle.
- Arbeit zitieren
- Vanessa Fritz (Autor:in), 2014, Die Drei-Punkte-Regel als Garant für Offensivfußball? Eine spieltheoretische Analyse, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/279982