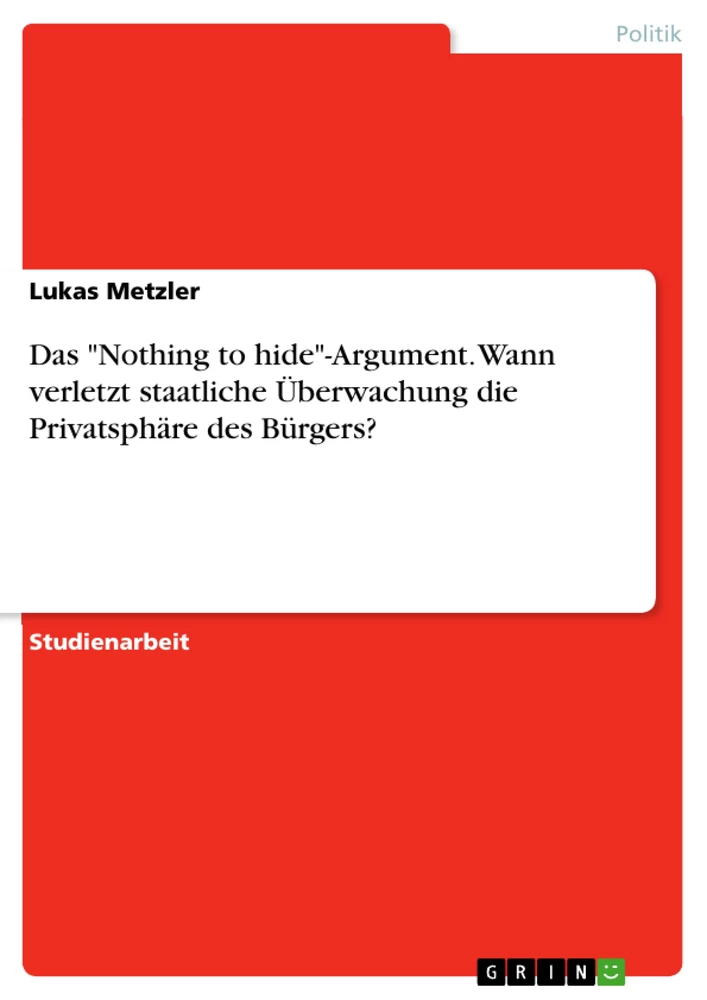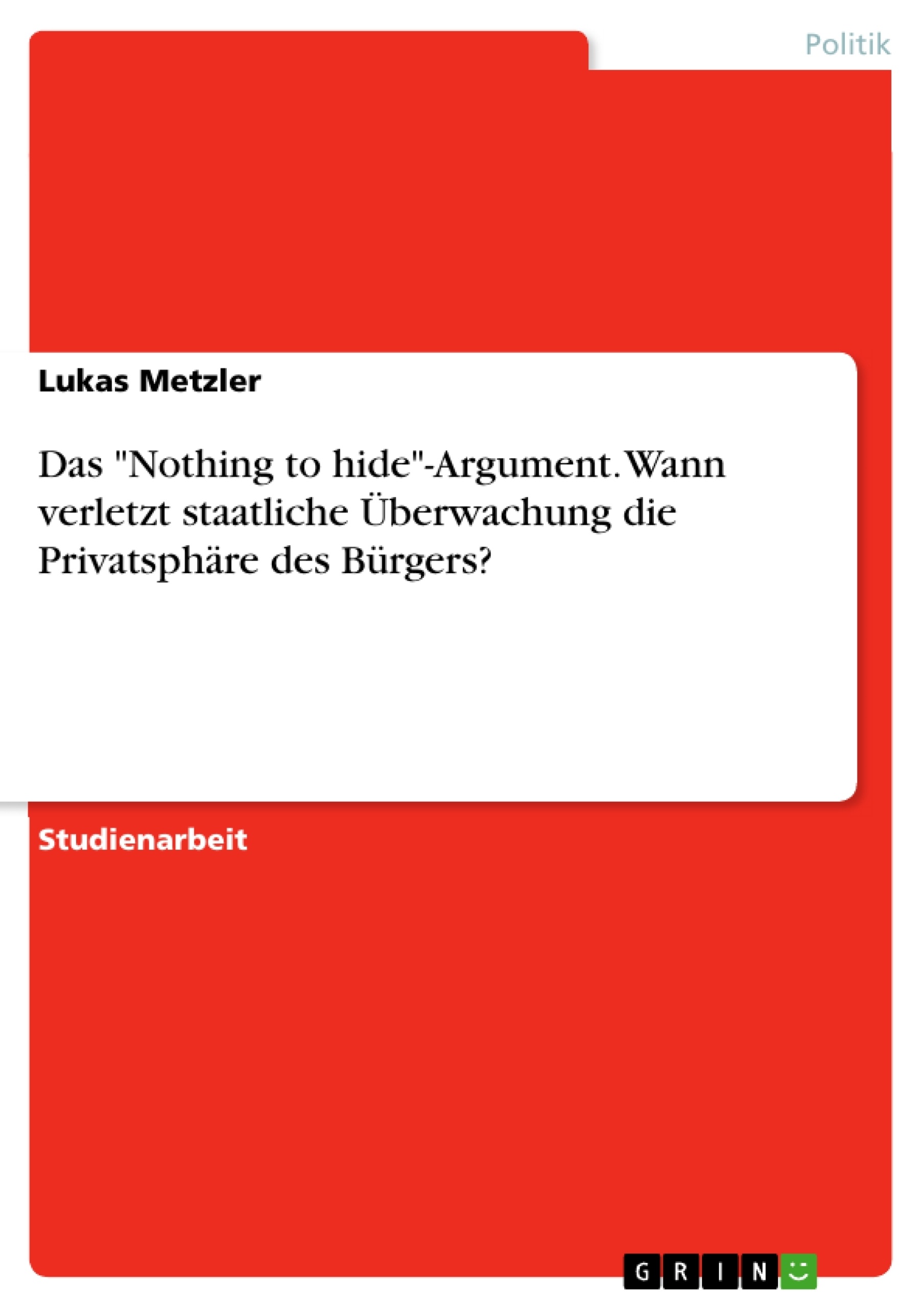Nach dem Anschlag auf das World Trade Center am 11. September 2001 wurden heftige Diskussionen über die Sicherheitspolitik in den Vereinigten Staaten losgetreten. Die amerikanische Regierung investiert seit dem in umfangreiche Überwachungsmethoden und elektronische Datensammlung, mit dem Ziel terroristische Aktionen frühzeitig zu überführen und somit abwehren zu können. Diese Überwachungsmaßnahmen können andererseits aber auch Verletzungen der Privatsphäre mit sich führen. Aufkommende Proteste von Datenschützern über die konstante Überwachung aller Bürger beantwortet die Regierung mit dem „nothing to hide“ Argument. - Wer nichts zu verstecken hat, hat auch nichts zu befürchten. In diesem Argument schwingt jedoch die Erklärung mit, dass es bei Privatsphäre darum geht, illegale Aktivitäten zu verstecken. Dass jedoch auch die Privatsphäre derer, die keine illegalen Aktivitäten zu verbergen haben, verletzt werden kann, möchte ich in dieser Arbeit aufzeigen. Zur Entkräftung des nothing to hide Arguments widme ich mich daher der Frage, ob und in welcher Hinsicht staatliche Überwachung die Privatsphäre der Bürger verletzt, selbst wenn diese keine illegalen Aktivitäten zu verbergen versuchen und welche Folgen diese Verletzungen mit sich führen können. Dazu werde ich im ersten Teil zuerst einmal die Kernargumente des nothing to hide Arguments aus Sicht der Regierung skizzieren. Um Verletzungen der Privatsphäre definieren zu können, wird im Anschluss daran Daniel Solove’s pluralistisches Konzept von Privatsphäre angeführt. Im späteren Verlauf sollen dann, mit Hilfe dieses Konzepts, die Angriffspunkte der staatlichen Überwachung auf die Privatsphäre der Bürger bestimmt werden. Anhand verschiedener Datenschutzverstöße, die durch das Argument gerechtfertigt werden, soll dann zum Schluss aufgezeigt werden, dass auch die Privatsphäre derer verletzt wird, die nicht versuchen, illegale Aktivitäten zu verbergen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung und Herausarbeitung der Fragestellung
- Erläuterung des „Nothing to hide“ Arguments
- Dimensionen von Privatsphäre
- Das Pluralistische Konzept von Daniel Solove
- Probleme der Überwachung für die Privatsphäre von gesetzestreuen Bürgern
- Informationssammlung
- Informationsverarbeitung
- Informationsverbreitung
- Fazit
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit dem „Nothing to hide“ Argument, das von der Regierung zur Rechtfertigung von Überwachungsmaßnahmen verwendet wird. Ziel ist es, die Argumentation zu entkräften und aufzuzeigen, dass staatliche Überwachung die Privatsphäre von Bürgern verletzt, selbst wenn diese keine illegalen Aktivitäten verbergen.
- Das „Nothing to hide“ Argument und seine Logik
- Das pluralistische Konzept von Privatsphäre nach Daniel Solove
- Die Auswirkungen von Überwachung auf die Privatsphäre
- Die Verletzung der Privatsphäre von gesetzestreuen Bürgern
- Die Folgen von Überwachung für die Gesellschaft
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Fragestellung der Arbeit vor und erläutert den Kontext des „Nothing to hide“ Arguments im Zusammenhang mit staatlicher Überwachung nach dem 11. September 2001. Das zweite Kapitel analysiert das „Nothing to hide“ Argument und seine Kernargumente aus Sicht der Regierung. Es werden die Argumente der Regierung hinsichtlich der Priorität der nationalen Sicherheit und der minimalen Verletzung der Privatsphäre von Bürgern dargestellt. Das dritte Kapitel beschäftigt sich mit dem Begriff der Privatsphäre und stellt verschiedene Konzepte und Definitionen vor. Es wird auf die Schwierigkeit hingewiesen, einen gemeinsamen Nenner für alle Aspekte der Privatsphäre zu finden. Das vierte Kapitel führt das pluralistische Konzept von Daniel Solove ein, das die Privatsphäre als ein komplexes und vielschichtiges Konzept betrachtet. Es werden verschiedene Dimensionen der Privatsphäre, wie z.B. Informationelle Selbstbestimmung, körperliche Unversehrtheit und soziale Beziehungen, erläutert. Das fünfte Kapitel untersucht die Probleme der Überwachung für die Privatsphäre von gesetzestreuen Bürgern. Es werden die verschiedenen Phasen der Überwachung, von der Informationssammlung bis zur Informationsverbreitung, analysiert und die Auswirkungen auf die Privatsphäre beleuchtet.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen das „Nothing to hide“ Argument, die Privatsphäre, staatliche Überwachung, Datenschutz, Informationelle Selbstbestimmung, das pluralistische Konzept von Daniel Solove, die Folgen von Überwachung für die Gesellschaft und die Verletzung der Privatsphäre von gesetzestreuen Bürgern.
Häufig gestellte Fragen
Was besagt das „Nothing to hide“-Argument?
Es behauptet, dass Bürger, die keine illegalen Aktivitäten planen oder durchführen, keine staatliche Überwachung zu befürchten haben („Wer nichts zu verstecken hat, hat nichts zu befürchten“).
Warum ist dieses Argument laut Daniel Solove problematisch?
Solove argumentiert, dass Privatsphäre weit mehr ist als das Verstecken von Illegalität. Überwachung schadet auch gesetzestreuen Bürgern durch Informationssammlung, -verarbeitung und -verbreitung.
Was ist das pluralistische Konzept von Privatsphäre?
Es betrachtet Privatsphäre als vielschichtiges Konzept, das informationelle Selbstbestimmung, körperliche Unversehrtheit und soziale Beziehungen umfasst, anstatt sie nur auf „Geheimhaltung“ zu reduzieren.
Welche Folgen hat staatliche Überwachung für die Gesellschaft?
Überwachung kann zu Selbstzensur führen, das Vertrauen in staatliche Institutionen untergraben und die individuelle Freiheit einschränken, selbst wenn man unschuldig ist.
Wie verletzen Informationsverarbeitungs-Prozesse die Privatsphäre?
Durch Datenverknüpfung und Profiling können falsche Zusammenhänge hergestellt werden, ohne dass der Bürger Kontrolle über die Verwendung seiner Daten hat.
- Quote paper
- Lukas Metzler (Author), 2014, Das "Nothing to hide"-Argument. Wann verletzt staatliche Überwachung die Privatsphäre des Bürgers?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/281142