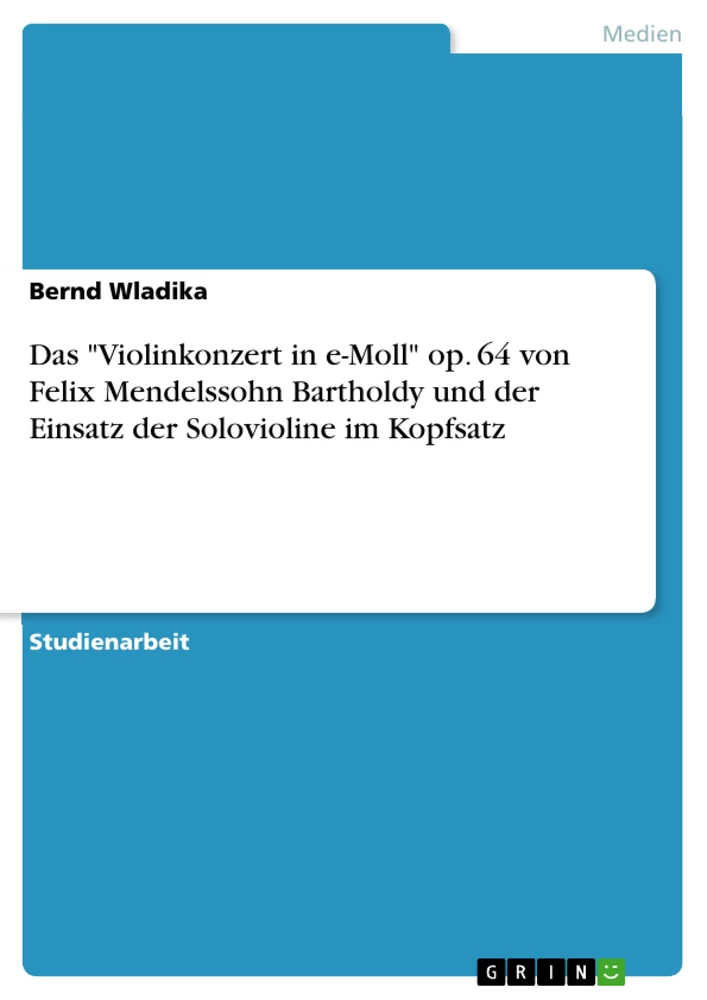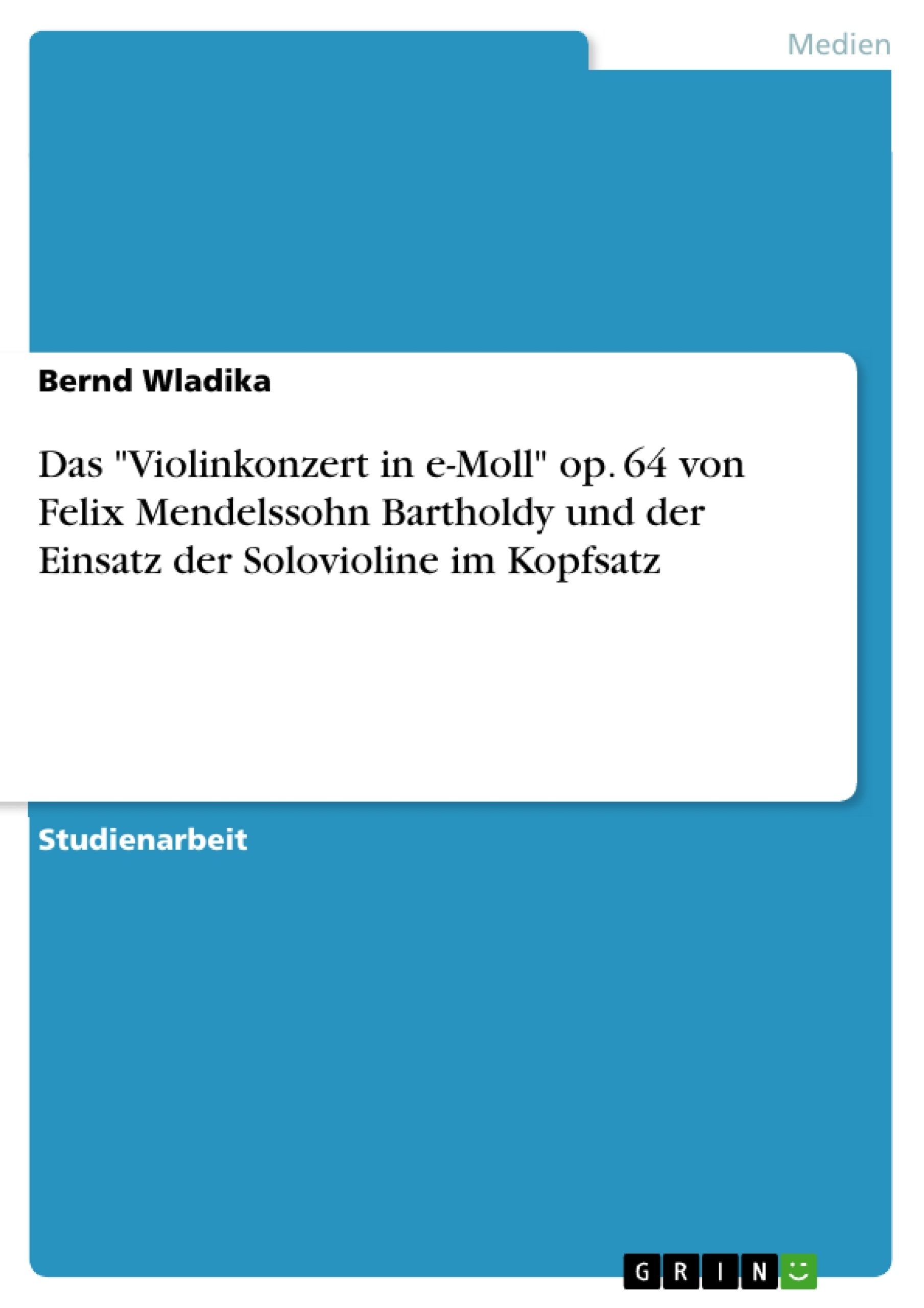Die vorliegende Hausarbeit beschäftigt sich schwerpunktmäßig mit dem Violinkonzert in e-Moll op. 64 von Felix Mendelssohn Bartholdy. Dabei erfolgt zunächst eine Einordnung in den Entstehungskontext des Werkes, sowie eine kurze vergleichende Betrachtung eines früheren Violinkonzerts des Komponisten aus dessen Jugendwerken.
Der Fokus der analytischen Betrachtung des op. 64 liegt auf dem Kopfsatz des Konzerts, wobei der Einsatz der Solovioline und Besonderheiten der formellen Dispositionen besondere Berücksichtigung finden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Hintergründe und Entstehungsgeschichte
- Betrachtung inhaltlicher Aspekte im Violinkonzert in e-Moll op. 64
- Formale Gestalt
- Die Architektur des Kopfsatzes unter besonderer Berücksichtigung des Einsatzes der Solovioline
- Schlussbetrachtung
- Literaturverzeichnis
- Musikalien
- Schrifttum
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Hausarbeit analysiert das Violinkonzert in e-Moll op. 64 von Felix Mendelssohn Bartholdy, wobei der Fokus auf dem Kopfsatz und dem Einsatz der Solovioline liegt. Die Arbeit beleuchtet die Entstehungsgeschichte des Werkes, untersucht die formale Gestalt des Konzerts und analysiert die Rolle der Solovioline im Kopfsatz. Darüber hinaus werden Bezüge zum frühen Violinkonzert in d-Moll aus Mendelssohns Jugendwerken hergestellt.
- Entstehungsgeschichte des Violinkonzerts in e-Moll op. 64
- Formale Gestalt des Konzerts
- Rolle der Solovioline im Kopfsatz
- Vergleich mit dem frühen Violinkonzert in d-Moll
- Entwicklungen in Mendelssohns Kompositionsstil
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt das Violinkonzert in e-Moll op. 64 von Felix Mendelssohn Bartholdy vor und erläutert die Zielsetzung der Hausarbeit. Der Fokus liegt auf dem Kopfsatz des Konzerts und dem Einsatz der Solovioline.
Das Kapitel „Hintergründe und Entstehungsgeschichte“ beleuchtet die Entstehung des Violinkonzerts in e-Moll op. 64. Es wird auf die Entstehung des Werkes im Kontext von Mendelssohns Schaffensprozess eingegangen und die Bedeutung des frühen Violinkonzerts in d-Moll für die Entwicklung des späteren Werkes hervorgehoben.
Das Kapitel „Betrachtung inhaltlicher Aspekte im Violinkonzert in e-Moll op. 64“ befasst sich mit der formalen Gestalt des Konzerts und analysiert die Architektur des Kopfsatzes unter besonderer Berücksichtigung des Einsatzes der Solovioline.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen das Violinkonzert in e-Moll op. 64 von Felix Mendelssohn Bartholdy, den Einsatz der Solovioline im Kopfsatz, die Entstehungsgeschichte des Werkes, die formale Gestalt des Konzerts, die Architektur des Kopfsatzes, die Rolle der Solovioline, die Entwicklungen in Mendelssohns Kompositionsstil und den Vergleich mit dem frühen Violinkonzert in d-Moll.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Besondere an Mendelssohns Violinkonzert in e-Moll op. 64?
Das op. 64 gilt als eines der bedeutendsten Violinkonzerte der Romantik. Es zeichnet sich durch seine formale Innovation und die enge Verzahnung zwischen Solist und Orchester aus.
Welche Rolle spielt die Solovioline im Kopfsatz?
Die Arbeit analysiert die Architektur des Kopfsatzes und zeigt auf, wie Mendelssohn die Solovioline bereits zu Beginn prominent einsetzt und sie durch das gesamte formale Gefüge führt.
Gibt es frühere Violinkonzerte von Mendelssohn?
Ja, Mendelssohn komponierte in seiner Jugend ein Violinkonzert in d-Moll. Die Hausarbeit vergleicht dieses Frühwerk mit dem reifen Meisterwerk op. 64.
Wie entwickelte sich Mendelssohns Kompositionsstil?
Durch den Vergleich zwischen dem frühen d-Moll Konzert und dem e-Moll Konzert op. 64 werden die Entwicklungen und die Verfeinerung seines Stils in Bezug auf Form und Instrumentierung deutlich.
Was wird in der formalen Analyse des Kopfsatzes untersucht?
Die Analyse konzentriert sich auf die formale Gestalt und die innovative Architektur des ersten Satzes, wobei insbesondere der Einsatz der Solovioline im Fokus steht.
- Citation du texte
- Bernd Wladika (Auteur), 2013, Das "Violinkonzert in e-Moll" op. 64 von Felix Mendelssohn Bartholdy und der Einsatz der Solovioline im Kopfsatz, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/282594