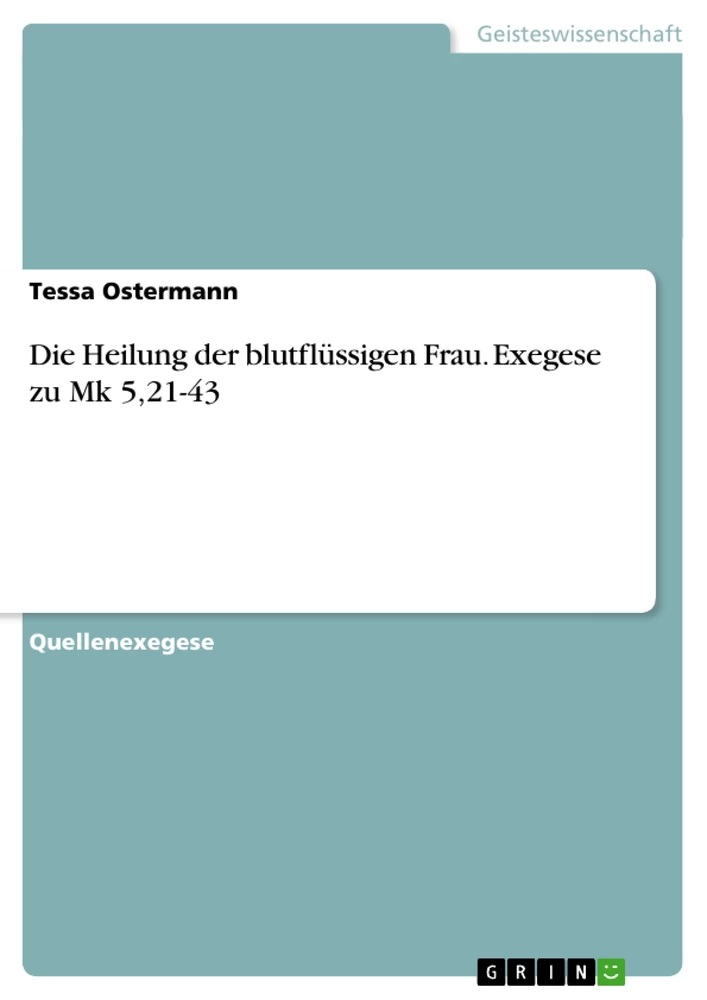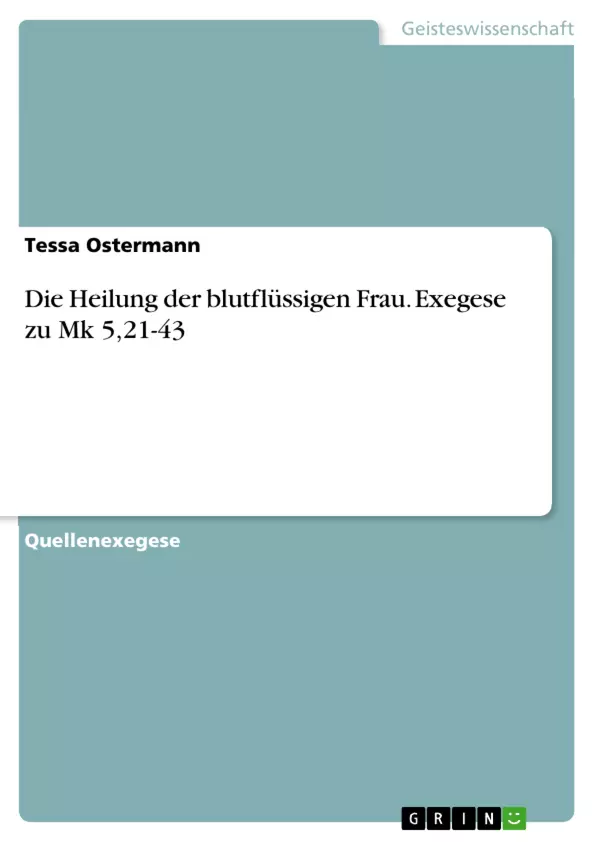Um die Doppelperikope zu verstehen und den Inhalt zu filtern, wurde in dieser Ausarbeitung mit einer Übersetzung begonnen. Hierfür wurden drei Bibelübersetzungen zu Rate gezogen. Darauf folgt eine Textanalyse aller wichtigen Inhalte des Textes. Hierbei wurde zuerst der Kontext der Geschichte betrachtet, nachfolgend der Text abgegrenzt und sprachlich-syntaktisch analysiert. Darauf folgen eine semantische Analyse der Sinnlinien sowie eine narrative und pragmatische Auseinandersetzung mit dem Text. Ein Zwischenfazit zeigt daraufhin die Kohärenz des Textes an. Anschließend daran folgen für die Exegese wichtige Inhalte wie die Literarkritik, Formkritik, Redaktionskritik und die damit einhergehende Überlieferungsgeschichte. Abschließend folgen die Traditionsgeschichte, die Wirkungsgeschichte und eine hermeneutische Reflexion welche zusätzlich als Schlussbemerkung agiert.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Übersetzungsvergleich
- Textanalyse
- Kontextanalyse
- Textabgrenzung
- Sprachlich-syntaktische Analyse
- Semantische Analyse
- Narrative Analyse
- Pragmatische Analyse
- Feststellung der Kohärenz
- Literarkritik
- Formkritik
- Redaktionskritik und Überlieferungsgeschichte
- Traditionsgeschichte
- Wirkungsgeschichte
- Hermeneutische Reflexion
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Exegese befasst sich mit dem Markusevangelium, Kapitel 5, Vers 21-43, und untersucht die verschiedenen Ebenen der Textanalyse, um die Bedeutung dieser Doppelperikope zu erschließen. Die Arbeit zielt darauf ab, den Text in seinen Einzelteilen zu betrachten, die sprachlichen und narrativen Strukturen zu analysieren und schließlich die theologischen Aussagen der Erzählungen zu verstehen.
- Die Rolle von Jesus als Heiler und seine Vollmacht über den Tod
- Die Bedeutung des Glaubens für die Heilung und Rettung
- Die soziale und rituelle Ausgrenzung der blutflüssigen Frau und die Überwindung dieser Grenzen durch Jesus
- Die Beziehung zwischen Jesus und seinen Jüngern im Kontext der Wundergeschichten
- Die Rezeption des Markusevangeliums und die Entwicklung der christlichen Lehre
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Arbeit ein und erläutert die Methodik und die Relevanz des ausgewählten Textes. Der Übersetzungsvergleich analysiert drei deutsche Bibelübersetzungen, um den Text zu verstehen und eine eigene Übersetzung zu erstellen.
Die Textanalyse beschäftigt sich mit den verschiedenen Aspekten des Textes, einschließlich der Kontextanalyse, der Textabgrenzung, der sprachlich-syntaktischen Analyse, der semantischen Analyse, der narrativen Analyse, der pragmatischen Analyse und der Kohärenz des Textes.
Die Literarkritik untersucht die synoptische Frage und die Abhängigkeiten zwischen den drei Evangelien. Die Formkritik identifiziert die Gattung der Erzählung als Wundergeschichte. Die Redaktionskritik analysiert die Bearbeitung des Textes durch Markus und die Überlieferungsgeschichte untersucht die möglichen mündlichen Vorstufen des Textes.
Die Traditionsgeschichte analysiert die Verwendung wichtiger Begriffe wie „zwölf“ und „Blutfluss“ im Kontext des gesamten Markusevangeliums. Die Wirkungsgeschichte betrachtet die Intention und den Zweck des Markusevangeliums und die Rezeption des Textes in der Geschichte der Kirche.
Die hermeneutische Reflexion fasst die Ergebnisse der Arbeit zusammen und reflektiert die Relevanz des Textes für die heutige Zeit.
Schlüsselwörter
Markusevangelium, Doppelperikope, Heilung, Auferweckung, Glaube, Blutfluss, Synagogenvorsteher, Jesus, Jünger, Tora, Kerygma, Synoptische Frage, Zweiquellentheorie, Formkritik, Redaktionskritik, Überlieferungsgeschichte, Traditionsgeschichte, Wirkungsgeschichte, Hermeneutik.
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in der Exegese zu Mk 5,21-43?
Die Arbeit analysiert die Doppelperikope der Heilung der blutflüssigen Frau und der Auferweckung der Tochter des Jairus im Markusevangelium.
Was bedeutet „Doppelperikope“ in diesem Kontext?
Es beschreibt die literarische „Sandwich-Technik“ des Markus, bei der eine Geschichte (Heilung der Frau) in eine andere (Tochter des Jairus) eingeschoben wird.
Welche Rolle spielt der Glaube in diesen Wundergeschichten?
Der Glaube wird als entscheidende Voraussetzung für die Heilung und Rettung dargestellt („Dein Glaube hat dich geheilt“).
Was sagt die Formkritik über diesen Text aus?
Die Formkritik ordnet die Erzählungen der Gattung der Wundergeschichten zu, die die Vollmacht Jesu über Krankheit und Tod demonstrieren sollen.
Warum war die blutflüssige Frau sozial ausgegrenzt?
Nach der Tora galt ein dauerhafter Blutfluss als rituell unrein, was die Frau von der Gemeinschaft und dem Tempelkult ausschloss.
- Quote paper
- B. A. Tessa Ostermann (Author), 2014, Die Heilung der blutflüssigen Frau. Exegese zu Mk 5,21-43, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/283971