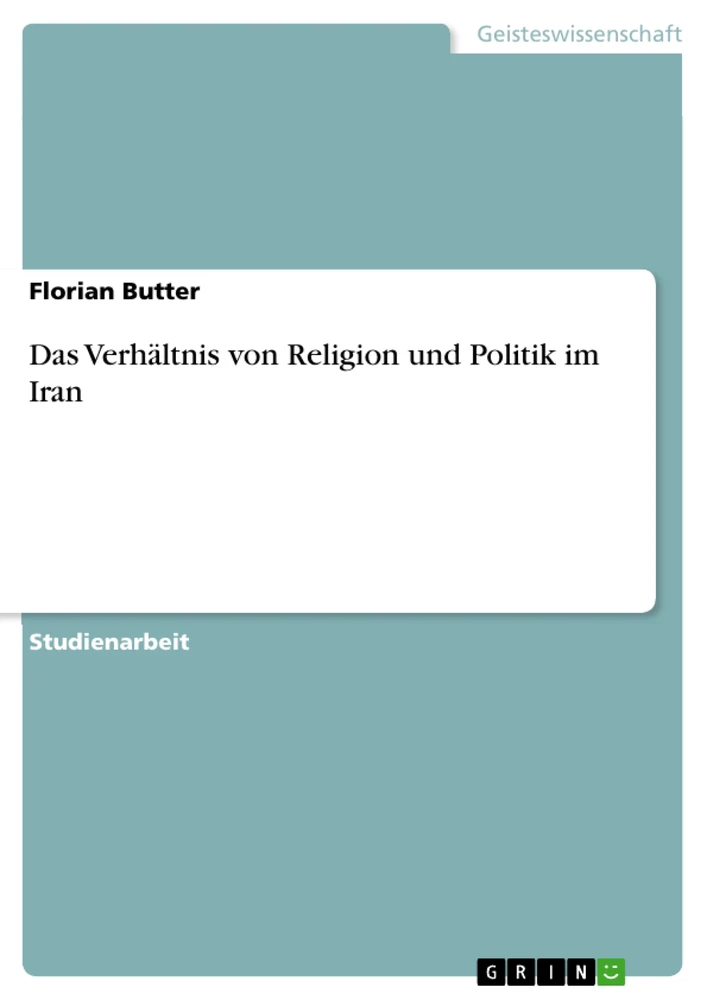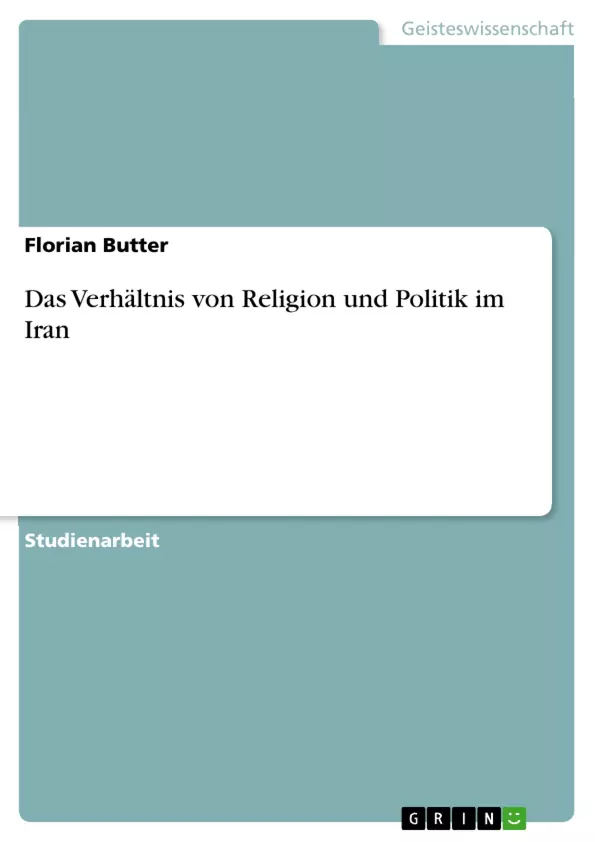Im Rahmen des Seminars ‚Religion und Politik‘ soll sich in dieser Arbeit mit dem Verhältnis dieser zwei Komponenten in Iran befasst werden. Iran ist in den letzten Jahren vor allem durch sein Atomprogramm und seiner aggressiven Haltung gegenüber Israel in den Medien gewesen. Nicht zuletzt das Auftreten Mahmud Ahmadinedschads, den ehemaligen Staatspräsidenten, wurden Sanktionen durch EU und USA gegen Iran beschlossen.
Seit dem 11. September 2001 ist die westliche Welt besonders vorsichtig gegenüber muslimischen Ländern, da aus ihnen die Herkunft des Terrorismus erwartet wird. In der westlichen Vorstellung wird Religion und Politik von muslimischen Ländern gleichgesetzt und unterscheiden dabei selten zwischen Muslimen, Islamisten und Terroristen. Deshalb soll dieser Aufsatz am Beispiel der Islamischen Republik Iran untersuchen, wie das Verhältnis von Religion und Politik beschrieben werden kann.
Dazu soll sich zuerst damit auseinandergesetzt werden, wie das Verhältnis von Religion und Politik am besten zu untersuchen ist. Anschließend soll sich, von diesem Leitfaden ausgehend, sich mit der Geschichte, der Religion und dem politischen Systems Iran beschäftigt werden. Im nächsten Schritt sollen diese Ergebnisse zusammengeführt werden, um das Verhältnis der beiden Komponenten zu beschreiben. Im Fazit soll schließlich das Ergebnis noch einmal zusammengefasst und ein Ausblick auf aktuelle Tendenzen zu dieser Thematik Iran gegeben werden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Religion und Politik – Eine allgemeine Einführung in die Thematik
- Iran
- Geschichte
- Religion
- Politik
- Das Verhältnis von Religion und Politik
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht das Verhältnis von Religion und Politik im Iran. Sie analysiert, wie sich die religiösen und politischen Systeme ineinander greifen und welche Faktoren dieses Verhältnis prägen. Die Arbeit geht dabei über eine oberflächliche Betrachtung des iranischen Atomprogramms hinaus und beleuchtet die komplexen Wechselwirkungen zwischen Religion und Politik im Kontext der iranischen Geschichte und Kultur.
- Die verschiedenen Modelle des Verhältnisses von Religion und Politik (theokratisch, cäsaropapistisch, laizistisch)
- Die Rolle der Religion in der iranischen Geschichte und Gesellschaft
- Das politische System des Iran und seine religiösen Grundlagen
- Die Anwendbarkeit der Säkularisierungsthese auf den Iran
- Die Überschneidungen und Unterschiede zwischen den Funktionen von Religion und Politik
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Arbeit befasst sich mit dem Verhältnis von Religion und Politik im Iran, insbesondere im Kontext der Wahrnehmung des Landes im Westen nach 9/11 und im Lichte des iranischen Atomprogramms. Sie skizziert den methodischen Ansatz, der die Untersuchung der Geschichte, Religion und des politischen Systems des Iran umfasst, um das komplexe Verhältnis beider Bereiche zu analysieren. Die Arbeit betont die Notwendigkeit, das iranische Verhältnis von Religion und Politik im Kontext seiner eigenen Geschichte und Kultur zu verstehen, anstatt westliche Modelle unkritisch anzuwenden.
Religion und Politik – Eine allgemeine Einführung in die Thematik: Dieses Kapitel präsentiert verschiedene Modelle zur Analyse des Verhältnisses von Religion und Politik, ausgehend von Konrad Raisers Unterscheidung zwischen theokratischer, cäsaropapistischer und laizistischer Tendenz. Es wird hervorgehoben, dass dieses Verhältnis nicht verallgemeinerbar ist und von historischen, kulturellen und religiösen Faktoren beeinflusst wird. Die Arbeit kritisiert die Anwendung der europäischen Säkularisierungsthese auf nicht-europäische Gesellschaften und betont die Notwendigkeit, die spezifischen Gegebenheiten jedes Landes zu berücksichtigen. Besonders wird auf die unterschiedlichen Machtstrukturen von Religion (symbolisch, kommunikativ) und Politik (strategisch, instrumental) eingegangen.
Schlüsselwörter
Iran, Religion, Politik, Theokratie, Cäsaropapismus, Laizismus, Säkularisierung, Islamische Republik Iran, Macht, Geschichte, Kultur.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Verhältnis von Religion und Politik im Iran
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert das komplexe Verhältnis von Religion und Politik im Iran. Sie geht über oberflächliche Betrachtungsweisen, wie z.B. den Fokus auf das iranische Atomprogramm hinaus, und beleuchtet die tiefgreifenden Wechselwirkungen zwischen religiösen und politischen Systemen im Kontext der iranischen Geschichte und Kultur.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit untersucht verschiedene Modelle des Verhältnisses von Religion und Politik (theokratisch, zesaropastisch, laizistisch), die Rolle der Religion in der iranischen Geschichte und Gesellschaft, das politische System des Iran und seine religiösen Grundlagen, die Anwendbarkeit der Säkularisierungsthese auf den Iran und die Überschneidungen und Unterschiede zwischen den Funktionen von Religion und Politik.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit beinhaltet eine Einleitung, ein Kapitel zu Religion und Politik im Allgemeinen, ein Kapitel über den Iran (mit Unterkapiteln zu Geschichte, Religion, Politik und dem Verhältnis von Religion und Politik) und ein Fazit.
Wie wird der Iran in dieser Arbeit betrachtet?
Der Iran wird nicht nur im Kontext der westlichen Wahrnehmung nach 9/11 und des Atomprogramms betrachtet, sondern vor allem im Lichte seiner eigenen Geschichte und Kultur. Die Arbeit betont die Notwendigkeit, westliche Modelle nicht unkritisch auf den Iran anzuwenden.
Welche methodischen Ansätze werden verwendet?
Die Arbeit untersucht die Geschichte, Religion und das politische System des Iran, um das komplexe Verhältnis von Religion und Politik zu analysieren. Sie kritisiert die unreflektierte Anwendung der europäischen Säkularisierungsthese auf nicht-europäische Gesellschaften.
Welche Schlüsselbegriffe sind relevant?
Schlüsselbegriffe sind: Iran, Religion, Politik, Theokratie, Zesaropasmus, Laizismus, Säkularisierung, Islamische Republik Iran, Macht, Geschichte, Kultur.
Welche Modelle des Verhältnisses von Religion und Politik werden vorgestellt?
Die Arbeit präsentiert verschiedene Modelle zur Analyse des Verhältnisses von Religion und Politik, ausgehend von Konrad Raisers Unterscheidung zwischen theokratischer, zesaropatistischer und laizistischer Tendenz. Es wird betont, dass dieses Verhältnis historisch, kulturell und religiös beeinflusst ist.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, ein umfassendes Verständnis des Verhältnisses von Religion und Politik im Iran zu liefern, indem sie die komplexen Wechselwirkungen zwischen beiden Bereichen analysiert und dabei den historischen und kulturellen Kontext berücksichtigt.
- Quote paper
- B.A./ MaL Florian Butter (Author), 2014, Das Verhältnis von Religion und Politik im Iran, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/284073