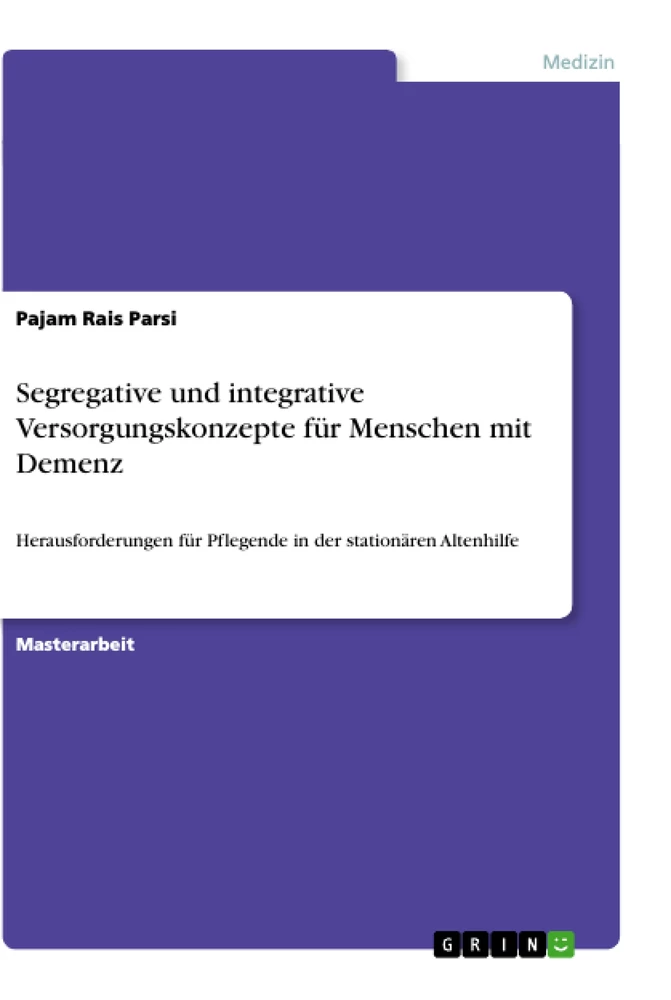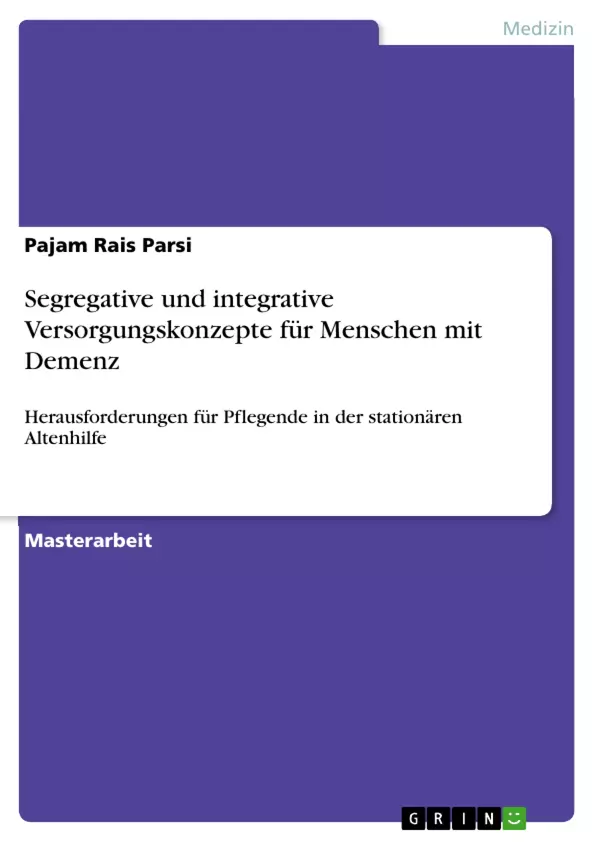Pflegende in der stationären Altenhilfe sind mit einer Vielzahl von Herausforderungen konfrontiert, welche häufig auch physisch und psychisch belastend wirken. Dies spiegelt sich unter anderen in einem überdurchschnittlich hohen Krankenstand sowie einer stark verkürzten Verweildauer im Pflegeberuf wieder. Bedingt durch den demografischen Wandel ist in Zukunft nicht mit einer Verbesserung dieser Situation zu rechnen. Aufgrund der fortschreitenden Überalterung der Gesellschaft ist zudem von einer Veränderung des Krankheitspanoramas auszugehen. Die Zunahme von demenziellen Erkrankungen stellt hierbei eine der zentralen Herausforderungen dar, insbesondere wenn diese mit herausfordernden Verhaltensweisen einhergehen. Bei der Konzeption von Altenhilfeeinrichtungen wurde dieser Umstand in den vergangenen Jahren bereits berücksichtigt. Dies zeigt sich unter anderem in der Implementierung verschiedener, insbesondere segregativer und integrativer, Versorgungskonzepte für demenziell erkrankte Menschen. Die Wirkung dieser Versorgungskonzepte auf die Verhaltensauffälligkeiten der BewohnerInnen bleibt jedoch umstritten.
Da die Arbeitszufriedenheit der Pflegenden die Versorgungsqualität der BewohnerInnen maßgeblich beeinflussen kann, soll im Rahmen dieser Ausarbeitung die Situation der Pflegenden in den Vordergrund gestellt werden. Das Ziel ist es, die Herausforderungen der Pflegenden in Abhängigkeit vom jeweiligen Versorgungskonzept zu untersuchen und darüber hinaus die positiven Aspekte, die die Pflegenden im Rahmen ihrer Arbeit erfahren, zu erheben. Hierfür wurden jeweils fünf Experteninterviews mit Pflegenden aus dem segregativen bzw. integrativen Setting durchgeführt (siehe hierzu auch Kapitel 5). Die hierdurch gewonnenen Erkenntnisse werden in Kapitel 6 vorgestellt und interpretiert und in Kapitel 7 vor dem Hintergrund bereits bestehender Forschungsergebnisse diskutiert. Letztlich finden sich in Kapitel 8 unter anderem Implikationen für einen weiteren wissenschaftlichen Untersuchungsbedarf sowie Handlungsempfehlungen für die Praxis.
Inhaltsverzeichnis
- Abkürzungsverzeichnis
- Abbildungsverzeichnis
- Tabellenverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Demenzielle Erkrankungen in der stationären Altenhilfe
- 3 Forschungsbefunde zu den Herausforderungen und Ressourcen von Pflegenden in der stationären Altenhilfe
- 3.1 Effekte des Versorgungskonzeptes auf die BewohnerInnen
- 3.2 Herausforderungen für Pflegende in der stationären Altenhilfe
- 3.2.1 Herausforderungen bei der Pflege von Menschen mit Demenz
- 3.2.2 Weitere Herausforderungen aus der Arbeitsaufgabe
- 3.2.3 Physische Herausforderungen
- 3.2.4 Herausforderungen durch die zeitliche Gestaltung
- 3.2.5 Organisationsbedingte Herausforderungen
- 3.2.6 Weitere Herausforderungen
- 3.2.7 Vergleich der Herausforderungen im integrativen und segregativen Setting
- 3.3 Ressourcen der Pflegenden in der stationären Altenhilfe
- 3.3.1 Ressourcen allgemein
- 3.3.2 Vergleich der Ressourcen im segregativen und integrativen Setting
- 4 Theoretischer Begründungsrahmen
- 4.1 Das Anforderungs-Kontroll-Modell
- 4.2 Das transaktionale Stressmodell
- 4.3 Das Modell der beruflichen Gratifikationskrisen
- 5 Darstellung des methodischen Vorgehens
- 6 Ergebnisdarstellung: Herausforderungen durch BewohnerInnen und das erweiterte soziale System
- 6.1 Herausforderungen durch die BewohnerInnen
- 6.2 Herausforderungen aus dem erweiterten sozialen System
- 6.3 Herausforderungen durch den Personalmangel
- 6.4 Positive Aspekte
- 7 Diskussion der Erkenntnisse
- Fazit
- Literaturverzeichnis
- Anhang
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Masterarbeit befasst sich mit den Herausforderungen, denen Pflegende in der stationären Altenhilfe bei der Versorgung von Menschen mit Demenz begegnen. Sie analysiert die Unterschiede zwischen segregativen und integrativen Versorgungskonzepten und untersucht die Auswirkungen auf die Arbeitsbedingungen der Pflegenden. Die Arbeit zielt darauf ab, ein tieferes Verständnis für die Belastungen und Ressourcen von Pflegenden in beiden Versorgungskonzepten zu entwickeln.
- Herausforderungen für Pflegende in der stationären Altenhilfe
- Unterschiede zwischen segregativen und integrativen Versorgungskonzepten
- Belastungen und Ressourcen von Pflegenden in beiden Versorgungskonzepten
- Einfluss der Versorgungskonzepte auf die Arbeitsbedingungen der Pflegenden
- Entwicklung von Handlungsempfehlungen zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik der Demenz und die Herausforderungen in der stationären Altenhilfe ein. Sie erläutert die Relevanz des Themas und die Forschungsfrage der Arbeit. Kapitel 2 beleuchtet die Besonderheiten demenzieller Erkrankungen und ihre Auswirkungen auf die Versorgung in der stationären Altenhilfe. Kapitel 3 präsentiert Forschungsbefunde zu den Herausforderungen und Ressourcen von Pflegenden in der stationären Altenhilfe. Es werden die Effekte der Versorgungskonzepte auf die BewohnerInnen sowie die Herausforderungen für Pflegende in beiden Settings analysiert. Kapitel 4 stellt den theoretischen Begründungsrahmen der Arbeit vor, der auf dem Anforderungs-Kontroll-Modell, dem transaktionalen Stressmodell und dem Modell der beruflichen Gratifikationskrisen basiert. Kapitel 5 beschreibt das methodische Vorgehen der Arbeit, das auf einer qualitativen Forschungsmethode basiert. Kapitel 6 präsentiert die Ergebnisse der Untersuchung, die die Herausforderungen durch BewohnerInnen, das erweiterte soziale System und den Personalmangel beleuchtet. Kapitel 7 diskutiert die Erkenntnisse der Arbeit und leitet Handlungsempfehlungen für die Praxis ab. Das Fazit fasst die wichtigsten Ergebnisse zusammen und gibt einen Ausblick auf zukünftige Forschungsbedarfe.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen Demenz, stationäre Altenhilfe, segregative und integrative Versorgungskonzepte, Herausforderungen für Pflegende, Belastungen, Ressourcen, Arbeitsbedingungen, Anforderungs-Kontroll-Modell, transaktionales Stressmodell, Modell der beruflichen Gratifikationskrisen, qualitative Forschung, Handlungsempfehlungen.
- Quote paper
- M.Sc. in Public Health Pajam Rais Parsi (Author), 2013, Segregative und integrative Versorgungskonzepte für Menschen mit Demenz, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/286557