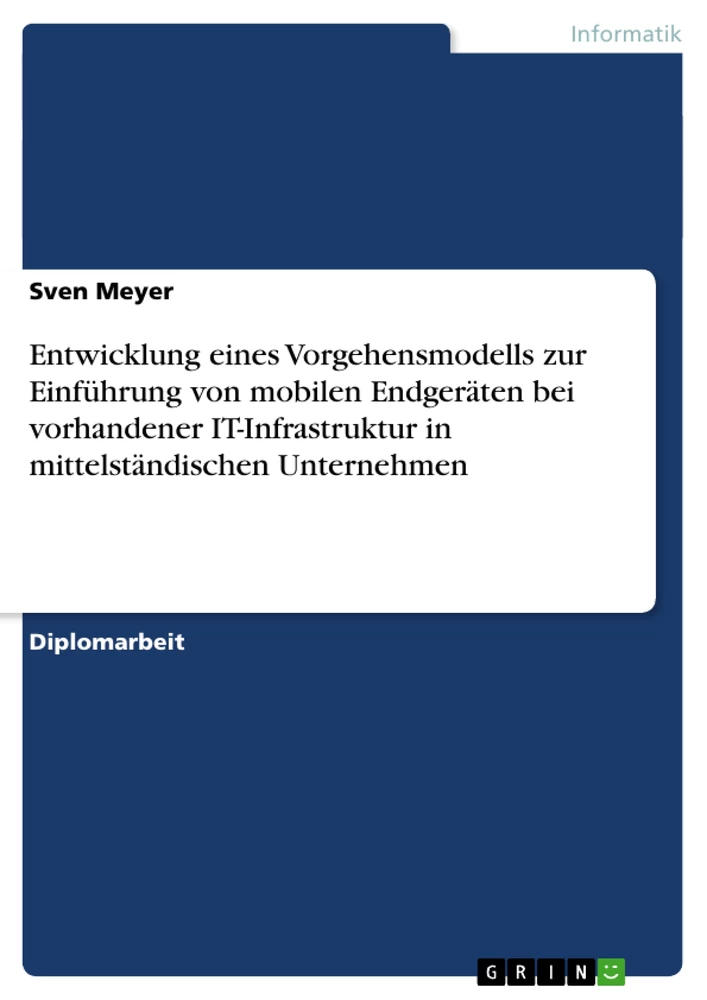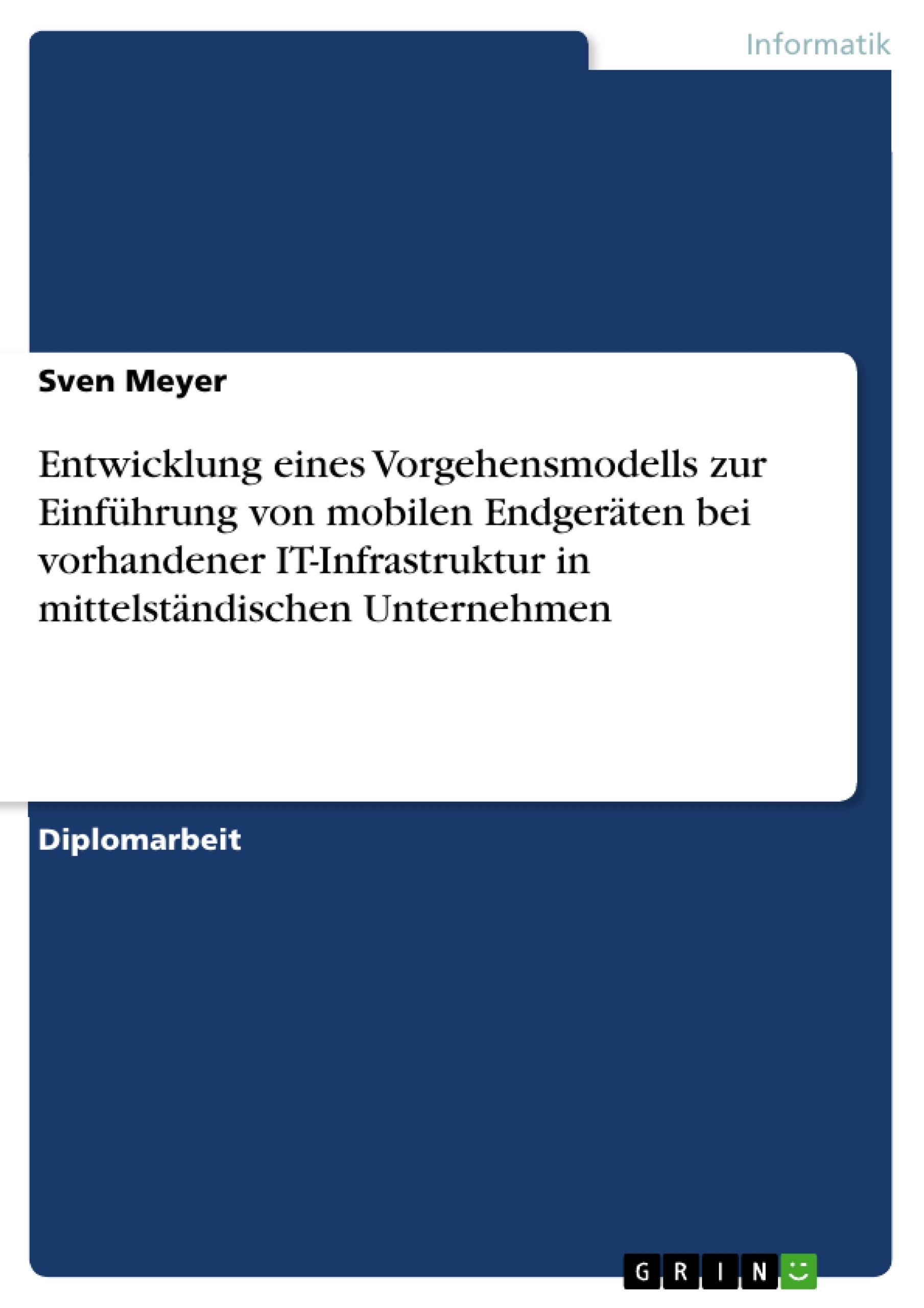Ziel dieser Abhandlung ist die Entwicklung eines Vorgehensmodells zur Einführung
mobiler Endgeräte in mittelständische Unternehmen, die bereits über eine
vorhandene IT-Infrastruktur verfügen und damit arbeiten. Das Vorgehensmodell
soll dabei einen Anspruch als Referenzmodell besitzen und soll somit nicht nur
auf ein einzelnes Unternehmen anwendbar sein. Das zu entwickelnde Vorgehensmodell
wird aus den Erkenntnissen heraus entstehen, die während dieser Arbeit
über Vorgehensmodelle und Eigenschaften von mittelständischen Unternehmen
gewonnen wurden. Das neu entstandene Vorgehensmodell wird im Anschluss auf
seine Praxistauglichkeit getestet und am Beispiel eines Unternehmens angewandt.
Im zweiten Kapitel werden allgemeine Grundlagen zu dieser Arbeit erklärt sowie
zentrale Begriffe zum Thema mobile Endgeräte definiert und ausführlich beschrieben.
Anschließend beginnt die Vorstellung der wichtigsten Vorgehensmodelle, die
diesbezüglich in klassische und agile Vorgehensmodelle unterteilt werden. Der
letzte Punkt dieses Kapitels umfasst das Thema mittelständische Unternehmen.
Es werden die Fragen geklärt, was mittelständische Unternehmen ausmachen und
welchen Stellenwert die vorhandene IT in den Unternehmen einnimmt.
Im dritten Kapitel geht es um die eigentliche Entwicklung eines Vorgehensmodells.
Hierzu werden die Vorgehensmodelle untereinander anhand festgelegter Vergleichskriterien
untersucht und bewertet. Aus den gewonnenen Erkenntnissen wird ein
eigenständiges Vorgehensmodell zur Einführung mobiler Endgeräte entworfen. Dieses
wird im Anschluss genau erläutert und grafisch dargestellt.
Das vierte Kapitel beschäftigt sich mit der Praxistauglichkeit des entwickelten Vorgehensmodells.
Dazu wird das neue Vorgehensmodell an einem realen Unternehmen
angewandt. Zum Schluss erfolgt eine kritische Betrachtung im Hinblick auf die
Tauglichkeit des Modells in der Praxis.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Relevanz der Arbeit
- Ziele und Aufbau
- Grundlagen
- Überblick
- Mobile Endgeräte
- Definition
- Klassifizierung
- Mobile Applikationen
- Endgerätestrategien
- Vorgehensmodelle zur Einführung von IT-Technologien
- Klassische Vorgehensmodelle
- Agile Vorgehensmodelle
- Mittelständische Unternehmen
- Mittelstandsdefinition und -klassifikation
- IT-Infrastruktur
- IT in mittelständischen Unternehmen
- Schlussfolgerung
- Entwicklung eines Vorgehensmodells
- Ziel
- Untersuchung der vorgestellten Vorgehensmodelle
- Bewertung der Vorgehensmodelle
- Ergebnis der Bewertung
- Auswahl und Anpassung eines Vorgehensmodells
- Anforderungen an das Vorgehensmodell
- Auswahl eines geeigneten Vorgehensmodells
- Festlegung der Projektphasen und Meilensteine
- Projektphasen
- Analyse
- Konzeption
- Realisierung
- Implementierung
- Vorgehensmodell für mobile Endgeräte
- Anwendung des Vorgehensmodells in der Praxis
- Ziel
- Vorstellung des Unternehmens
- Projekt mobile Endgeräte
- Projektinhalt
- Analyse
- Konzeption
- Realisierung
- Implementierung
- Kritische Betrachtung
- Zusammenfassung
- Literatur
- Abbildungsverzeichnis
- Tabellenverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Diplomarbeit befasst sich mit der Entwicklung eines Vorgehensmodells zur Einführung von mobilen Endgeräten in mittelständischen Unternehmen, die bereits über eine bestehende IT-Infrastruktur verfügen. Das Ziel der Arbeit ist es, ein praktikables und anwendbares Modell zu erstellen, das Unternehmen bei der Planung und Umsetzung einer solchen Einführung unterstützt.
- Analyse der relevanten IT-Technologien und -Trends im Bereich mobiler Endgeräte
- Bewertung verschiedener Vorgehensmodelle zur Einführung von IT-Systemen
- Entwicklung eines spezifischen Vorgehensmodells für die Einführung von mobilen Endgeräten in mittelständischen Unternehmen
- Anwendung des entwickelten Modells in einem Praxisbeispiel
- Bewertung der Ergebnisse und Ableitung von Empfehlungen für die Praxis
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Relevanz der Arbeit dar und erläutert die Ziele und den Aufbau der Diplomarbeit. Das Kapitel "Grundlagen" bietet einen Überblick über mobile Endgeräte, ihre Klassifizierung und die verschiedenen Endgerätestrategien. Es werden außerdem klassische und agile Vorgehensmodelle zur Einführung von IT-Technologien vorgestellt. Abschließend wird der Fokus auf mittelständische Unternehmen gelegt, wobei die Mittelstandsdefinition, die IT-Infrastruktur und die Rolle der IT in mittelständischen Unternehmen beleuchtet werden.
Im Kapitel "Entwicklung eines Vorgehensmodells" wird das Ziel des Modells definiert und eine Untersuchung der vorgestellten Vorgehensmodelle durchgeführt. Die Bewertung der Modelle führt zur Auswahl und Anpassung eines geeigneten Vorgehensmodells, das auf die spezifischen Anforderungen der Einführung von mobilen Endgeräten in mittelständischen Unternehmen zugeschnitten ist. Das Kapitel beschreibt die einzelnen Projektphasen und Meilensteine des Modells.
Das Kapitel "Anwendung des Vorgehensmodells in der Praxis" zeigt die Anwendung des entwickelten Modells in einem realen Unternehmen. Es werden die einzelnen Projektphasen und die Ergebnisse der Anwendung des Modells in der Praxis dargestellt. Abschließend wird eine kritische Betrachtung des Modells und seiner Anwendung in der Praxis durchgeführt.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen mobile Endgeräte, IT-Infrastruktur, mittelständische Unternehmen, Vorgehensmodell, Einführung, Projektmanagement, Analyse, Konzeption, Realisierung, Implementierung, Praxisbeispiel.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Ziel des entwickelten Vorgehensmodells?
Das Modell dient als Referenz für mittelständische Unternehmen, um mobile Endgeräte systematisch in eine bereits vorhandene IT-Infrastruktur einzuführen.
In welche Phasen unterteilt sich das Projekt zur Einführung mobiler Geräte?
Das Modell umfasst die vier zentralen Projektphasen: Analyse, Konzeption, Realisierung und Implementierung.
Was zeichnet mittelständische Unternehmen bei der IT-Einführung aus?
Die Arbeit beleuchtet die spezifischen Eigenschaften des Mittelstands, wie die vorhandene Infrastruktur und den Stellenwert der IT für den Unternehmenserfolg.
Werden klassische oder agile Vorgehensmodelle empfohlen?
Die Arbeit vergleicht beide Ansätze anhand festgelegter Kriterien und entwickelt daraus ein eigenständiges Modell, das die Vorteile beider Welten nutzt.
Wurde das Modell in der Praxis getestet?
Ja, die Praxistauglichkeit wurde durch die Anwendung des Modells in einem realen Unternehmen überprüft und kritisch bewertet.
- Quote paper
- Sven Meyer (Author), 2014, Entwicklung eines Vorgehensmodells zur Einführung von mobilen Endgeräten bei vorhandener IT-Infrastruktur in mittelständischen Unternehmen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/287280