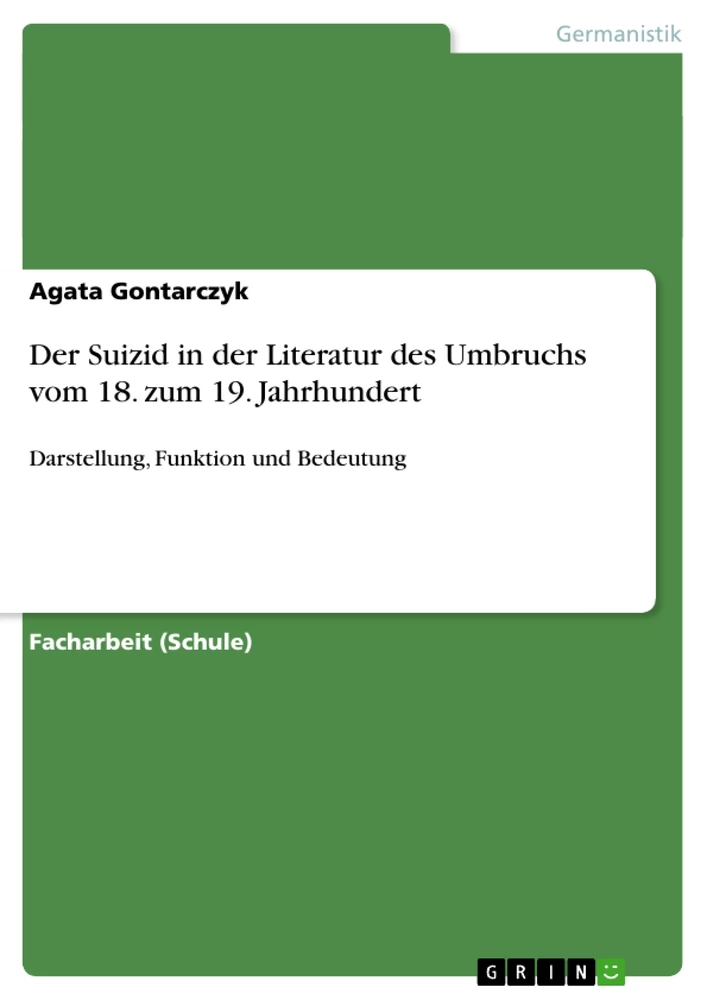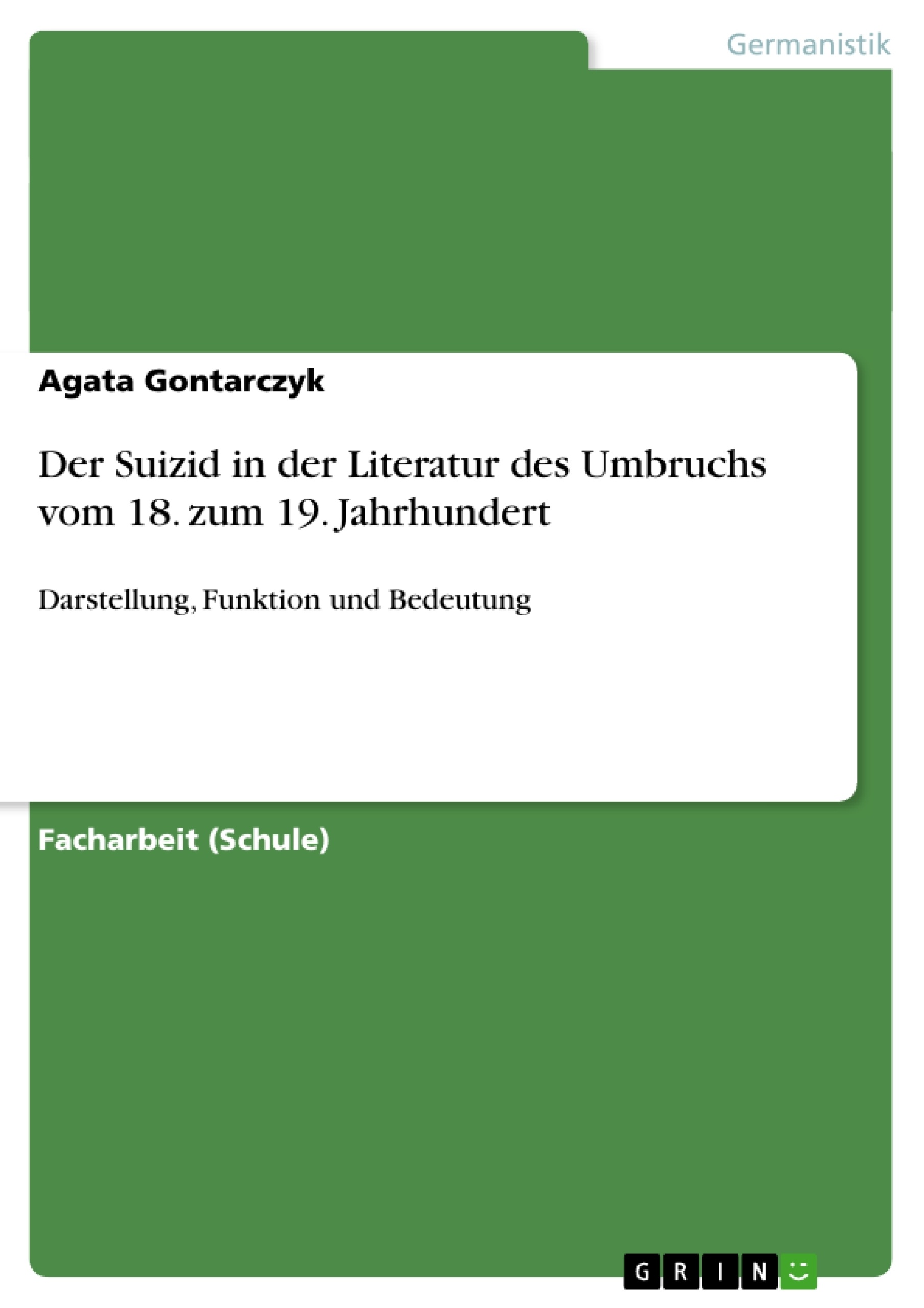Der Suizid ist seit der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts ein beliebtes und oft aufgegriffenes Motiv in der Literatur. Geschichten von Verliebten, Leidenden und Sterbenden wurden schon damals in solcher Anzahl gelesen, dass viele es sogar mit einer Sucht verglichen. „Die Wirkung dieses Büchleins war groß, ja ungeheuer, und vorzüglich deshalb, weil es genau in die rechte Zeit traf.“ So spricht der große Dichter J. W. von Goethe von seinem 1773 erschienenen Briefroman „Die Leiden des jungen Werthers", der unter seinen Lesern zu einem wahren Kult wurde. Dies ist wahrscheinlich auch die Ursache für die ungeheure Beliebtheit der oben angegebenen Thematik. Auch sie traf genau in die richtige Zeit. Denn der Übergang vom 18. ins 19. Jahrhundert brachte eine Menge sozialer wie auch politischer Veränderungen mit sich, die letztlich die Gesellschaft dieser Zeit stark beeinflussten. Diese Änderungen spiegelten sich in der Literatur, in den Charakteren der Figuren. Sie zeichneten sich durch eine herausragende Empfindlichkeit und Rührseligkeit aus. Ihre neue rebellische Auffassung von z.B. Religion, Natur oder die offene Kritik an der Umgebung waren oft Anlass für Konflikte. Diese nahmen in vielen Fällen ein tragisches Ende. Ein Aspekt, der mich dazu bewegt hat, sich in dieser Arbeit mit der Selbsttötung in der Literatur auseinanderzusetzen, war die Erkenntnis, dass, obwohl die Psychologie erst am Anfang des 19. Jahrhunderts als eigenständige Wissenschaft anerkannt wurde, die Verfasser der hier erforschten Werke schon früher in der Lage waren, den Geisteszustand eines Menschen glaubwürdig zu rekonstruieren. Die von ihnen dargestellten Empfindungen stimmen zum großen Teil mit den heute bekannten, wissenschaftlich erforschten Symptomen von emotionalen Störungen überein. Des Weiteren ist die Darstellung der Gedanken der einzelnen Figuren in Momenten der Unsicherheit und kurz vor der tödlichen Handlung besonders interessant. Die Betroffenen haben oft Erkenntnisse, die „glücklichen“ Menschen verschlossen bleiben.Sie stellen sich existenzielle Fragen, suchen nach einer Antwort und ziehen Schlüsse, die sie entweder zum weiteren Kampf mobilisieren oder zu ihrem Untergang beitragen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Der Suizid - Begriffserklärung
- Wortbedeutung und Herkunft
- Geschichtliche, religiöse und rechtliche Hintergründe
- Beispiele für Selbstmord in der Literatur des 18. und 19. Jahrhunderts
- „Kabale und Liebe“
- Das Drama als Gesellschaftskritik
- Zwischen Wut und Verzweiflung
- „Der Sandmann“
- Der Autor und Entstehenshintergrund
- Die narzisstische Krise als Ursache des Suizids
- „Die Leiden des jungen Werther“
- Der Briefroman als autobiographisches Werk Goethes
- Psychologische Analyse der Ursachen von Werthers Suizid
- „Kabale und Liebe“
- Die Darstellung des Suizids in der Literatur
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Darstellung des Suizids in der Literatur des 18. und 19. Jahrhunderts, beleuchtet dessen Funktion und Bedeutung im gesellschaftlichen Wandel dieser Epoche. Es wird analysiert, wie sich die Darstellung des Suizids in literarischen Werken verändert und welche psychologischen und gesellschaftlichen Faktoren dabei eine Rolle spielen.
- Der Suizid als literarisches Motiv im Übergang vom 18. zum 19. Jahrhundert
- Die gesellschaftlichen und psychologischen Ursachen für Suizid in den untersuchten Werken
- Die Entwicklung der Darstellung des Suizids von heroischer Tat zu individueller Tragödie
- Die Relevanz der literarischen Darstellung von Suizid für das Verständnis emotionaler Störungen
- Der Vergleich verschiedener literarischer Beispiele und deren jeweilige Interpretation des Suizidmotivs
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema ein und erläutert die Bedeutung des Suizids als literarisches Motiv im Übergang vom 18. zum 19. Jahrhundert. Sie betont die große Wirkung von Goethes „Die Leiden des jungen Werthers“ und den gesellschaftlichen Wandel als Hintergrund für die Popularität des Suizidmotivs in der Literatur. Die Arbeit untersucht, wie frühzeitig Autoren den Geisteszustand von Menschen glaubwürdig rekonstruieren konnten und wie die dargestellten Empfindungen mit heutigen Erkenntnissen der Psychologie übereinstimmen. Die existentiellen Fragen der Figuren im Angesicht des Todes und die besondere Ergreifung, die der Suizid junger Menschen hervorruft, werden hervorgehoben.
Der Suizid - Begriffserklärung: Dieses Kapitel definiert den Begriff „Suizid“ und differenziert zwischen verschiedenen Formen wie assistiertem Suizid und erweitertem Suizid. Es beleuchtet die verschiedenen Bezeichnungen für Selbsttötung im alltäglichen Sprachgebrauch und in der Fachsprache. Die Wortherkunft wird erklärt und die unterschiedlichen Konnotationen der verschiedenen Termini werden diskutiert. Das Kapitel beleuchtet historisches, religiöses und rechtliches Verständnis, beginnend mit dem dualen Bild des heroischen und unheroischen Suizids und dessen Entstehung. Die christliche Intoleranz gegenüber Selbsttötung wird im Kontext des göttlichen Eigentums am Leben und des fünften Gebotes erklärt und die historische Bestrafung von Suizidversuchen wird angesprochen.
Beispiele für Selbstmord in der Literatur des 18. und 19. Jahrhunderts: Dieses Kapitel analysiert verschiedene literarische Beispiele für die Darstellung von Suizid, ohne dabei einzelne Unterkapitel separat zusammenzufassen. Stattdessen konzentriert sich die Analyse auf die übergreifenden Themen und die jeweiligen Darstellung des Suizids in den Werken. Es werden die Hintergründe, Motive und die psychologischen Aspekte der Suizide beleuchtet und in den Kontext der jeweiligen Epoche eingeordnet.
Schlüsselwörter
Suizid, Literatur, 18. Jahrhundert, 19. Jahrhundert, Gesellschaftskritik, Psychologie, Emotionale Störungen, „Die Leiden des jungen Werthers“, „Kabale und Liebe“, „Der Sandmann“, Selbstmord, Freitod, heroischer Suizid, unheroischer Suizid, religiöse und rechtliche Aspekte.
Häufig gestellte Fragen zu: Darstellung des Suizids in der Literatur des 18. und 19. Jahrhunderts
Was ist der Inhalt dieser Arbeit?
Diese akademische Arbeit untersucht die Darstellung von Suizid in der Literatur des 18. und 19. Jahrhunderts. Sie analysiert die Funktion und Bedeutung des Suizidmotivs im gesellschaftlichen Wandel dieser Epoche, beleuchtet die psychologischen und gesellschaftlichen Faktoren und vergleicht verschiedene literarische Beispiele (z.B. „Die Leiden des jungen Werthers“, „Kabale und Liebe“, „Der Sandmann“).
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die Entwicklung der Darstellung des Suizids von einer heroischen Tat zu einer individuellen Tragödie, die gesellschaftlichen und psychologischen Ursachen für Suizid in den untersuchten Werken, den Suizid als literarisches Motiv im Übergang vom 18. zum 19. Jahrhundert, die Relevanz der literarischen Darstellung von Suizid für das Verständnis emotionaler Störungen und einen Vergleich verschiedener literarischer Interpretationen des Suizidmotivs.
Wie wird der Begriff "Suizid" definiert?
Das Werk definiert den Begriff "Suizid" und differenziert zwischen verschiedenen Formen (assistierter Suizid, erweiterter Suizid). Es beleuchtet die Wortherkunft, unterschiedliche Bezeichnungen im alltäglichen und fachsprachlichen Gebrauch und deren Konnotationen. Weiterhin werden die historischen, religiösen und rechtlichen Aspekte des Suizids, inklusive der christlichen Intoleranz und historischer Bestrafungsmethoden, behandelt.
Welche literarischen Werke werden analysiert?
Die Arbeit analysiert die Darstellung des Suizids in Werken wie Goethes „Die Leiden des jungen Werthers“, Schillers „Kabale und Liebe“ und E.T.A. Hoffmanns „Der Sandmann“. Der Fokus liegt auf den übergreifenden Themen und der Darstellung des Suizids in diesen Werken, einschließlich der Hintergründe, Motive und psychologischen Aspekte.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit untersucht die Darstellung des Suizids in der Literatur des 18. und 19. Jahrhunderts, beleuchtet dessen Funktion und Bedeutung im gesellschaftlichen Wandel und analysiert, wie sich die Darstellung des Suizids in literarischen Werken verändert und welche psychologischen und gesellschaftlichen Faktoren dabei eine Rolle spielen. Sie untersucht auch, wie frühzeitig Autoren den Geisteszustand von Menschen glaubwürdig rekonstruieren konnten und wie die dargestellten Empfindungen mit heutigen Erkenntnissen der Psychologie übereinstimmen.
Welche Schlüsselwörter sind relevant?
Die wichtigsten Schlüsselwörter sind: Suizid, Literatur, 18. Jahrhundert, 19. Jahrhundert, Gesellschaftskritik, Psychologie, Emotionale Störungen, „Die Leiden des jungen Werthers“, „Kabale und Liebe“, „Der Sandmann“, Selbstmord, Freitod, heroischer Suizid, unheroischer Suizid, religiöse und rechtliche Aspekte.
- Arbeit zitieren
- Agata Gontarczyk (Autor:in), 2013, Der Suizid in der Literatur des Umbruchs vom 18. zum 19. Jahrhundert, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/288404