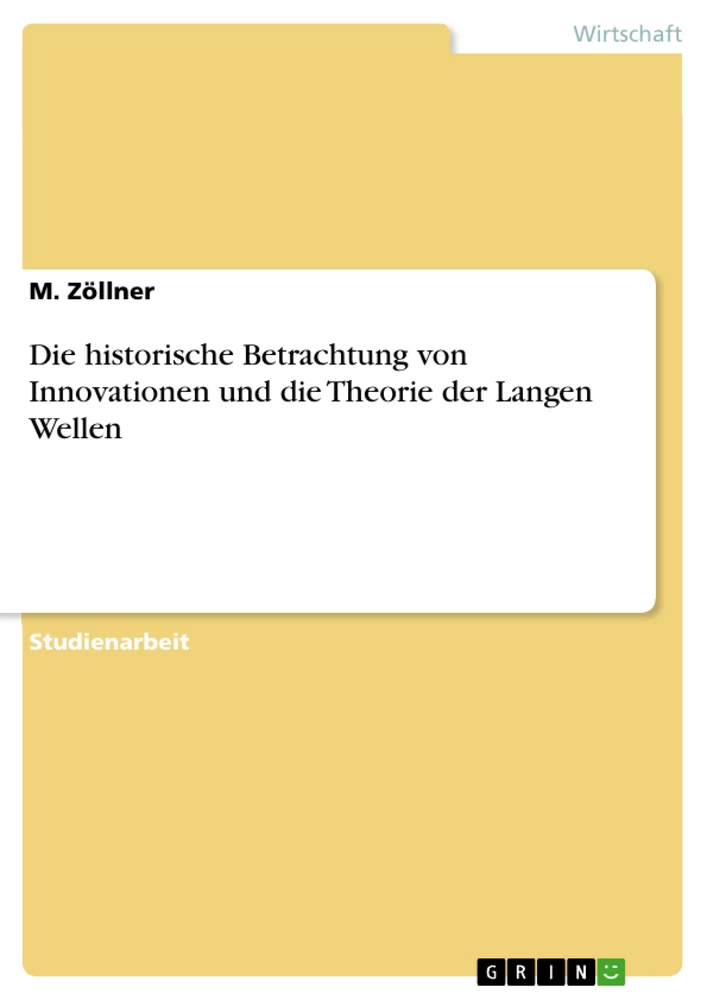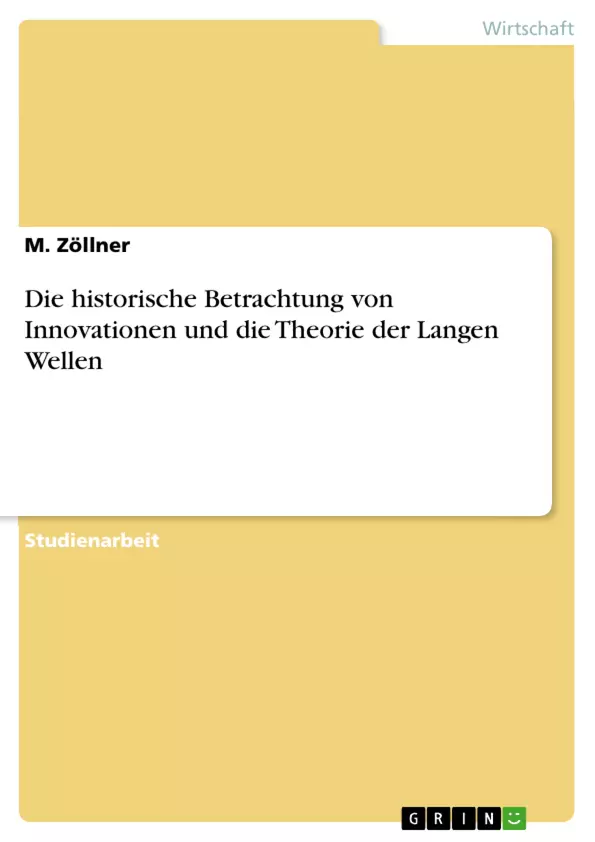Kondratieff bemerkte in seinem frühen Werk von 1926, dass die Entwicklung von Politik, Wirtschaft und Gesellschaft sich in langen Wellenbewegungen widerspielt. Somit folgt sowohl die gesellschaftliche als auch die ökonomische und politische Konzeption eines Systems den Auf- und Abschwüngen einer Wellenbewegung, was sich in diversen historischen Belegen widerspiegelt.
Das Thema dieser Arbeit war die Untersuchung des Zusammenhangs zwischen Innovationen und der Theorie Langer Wellen. Dabei wurde neben einer Betrachtungsweise der Theorieentwicklung, auch empirische Studien ausgewertet und mit historischen Ereignissen verglichen. Ziel der Arbeit war neben der Untersuchung des Zusammenhangs von Innovationen und langen Wellenbewegungen, die genaue Betrachtung von Innovationen und deren Anforderungen, um als Auslöser wellenartiger Bewegungen zu fungieren. Ebenso wurden die Entwicklung der Theorie der Langen Wellen und der Übergang zu empirischen Studien seit den 1970er Jahren untersucht.
Durch die Darstellung der Entwicklung der Theorie Langer Wellen und der empirischen Untersuchung wurde festgestellt, dass die Wissenschaft sich in einem Dissens befindet. Sie ist weder in der Lage, die Theorie zu verifizieren oder zu falsifizieren. Ebenso konnte festgestellt werden, dass Innovationen mit langen Wellenbewegungen einhergehen, aber nicht, ob Innovationen deren Auslöser sind.
In Kapitel 2 der Arbeit wurde zu allererst der Begriff General Purpose Technologie (GPT) - ein Schwarm von Innovationen bzw. ein Innovationscluster- sowie dessen Eigenschaften definiert. Nach der Definition folgte eine dogmatische Darstellung der Entwicklung der Theorie der Langen Wellen, angefangen bei Tugan-Baranowsky, über van Gelderer, Kondratieff, Schumpeter, Mensch und Freeman. In Kapitel 3 wurden die Anforderungen an Innovationen dargestellt, damit sie in der Lage sind, lange Wellenbewegungen auszulösen. Im Anschluss folgte eine Analyse der empirischen Untersuchung langer Wellenbewegungen in Zeitreihen. Dabei konnte festgestellt werden, dass die Trendbereinigung und die Wahl der Methode zur Bestimmung von Wellenbewegungen mit erheblichen Problemen verbunden ist. Kapitel 4 stellte die historische Entwicklung der ersten vier Kondratieffzyklen dar. Dabei wurden die Ergebnisse aus Kapitel 2 und 3 in die historische Untersuchung mit eingebracht, um die theoretischen Überlegungen und die empirischen Ergebnisse mit historischen Ereignissen zu vergleichen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- GPTs und die Theorie der Langen Wellen
- GPTs - General Purpose Technology
- Die Entwicklung der Langen Wellen-Theorie
- Über die Existenz Langer Wellen
- Anforderungen für die Existenz Langer Wellen
- Empirische Untersuchungen der Langen Wellen-Theorie
- Die historische Betrachtung der Langen Wellen
- Der erste Kondratieffzyklus - Der industrielle Kondratieff
- Der zweite Kondratieffzyklus - Der bürgerliche Kondratieff
- Der dritte Kondratieffzyklus - Die dritte industrielle Revolution?
- Der vierte Kondratieffzyklus
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die historische Betrachtung von Innovationen im Kontext der Theorie der Langen Wellen. Ziel ist es, die Entwicklung der Langen Wellen-Theorie nachzuzeichnen, ihren Zusammenhang mit Innovationen zu beleuchten und die wissenschaftlichen Kontroversen zu diskutieren. Ein Vergleich von Theorie und Empirie anhand historischer Ereignisse seit dem 18. Jahrhundert bildet einen weiteren Schwerpunkt.
- Entwicklung der Langen Wellen-Theorie
- Zusammenhang zwischen Langen Wellen und Innovationen (GPTs)
- Kontroversen in der wissenschaftlichen Diskussion über Lange Wellen
- Empirische Überprüfung der Langen Wellen-Theorie
- Historische Analyse der Langen Wellen anhand konkreter Ereignisse
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der Langen Wellen ein und stellt die Forschungsfrage nach dem Zusammenhang zwischen Innovationen und langfristigen wirtschaftlichen Entwicklungen dar. Sie skizziert den Aufbau der Arbeit und benennt die einzelnen Kapitel und ihre jeweiligen Schwerpunkte. Die Annahme langwelliger Bewegungen in der wirtschaftlichen Entwicklung, schon seit dem 19. Jahrhundert diskutiert, wird als Ausgangspunkt genannt, wobei das Werk Kondratieffs als Fundament der Theorie hervorgehoben wird. Die Arbeit untersucht die Theorieentwicklung, den Zusammenhang mit Innovationen und die damit verbundenen Kontroversen. Ein Vergleich von Theorie und Empirie anhand historischer Ereignisse bildet den weiteren Fokus.
GPTs und die Theorie der Langen Wellen: Dieses Kapitel definiert zunächst den Begriff der General Purpose Technology (GPT) und beschreibt anschließend die Entwicklung der Theorie der Langen Wellen. Es legt den Grundstein für das Verständnis der Zusammenhänge zwischen technologischen Innovationen und langfristigen Wirtschaftszyklen. Die unterschiedlichen Einflüsse und Perspektiven auf die Entwicklung der Theorie werden dargestellt, um die verschiedenen Ansätze und Interpretationen zu beleuchten und den theoretischen Rahmen für die spätere Analyse zu schaffen.
Über die Existenz Langer Wellen: Dieses Kapitel analysiert die Anforderungen an Innovationen, die notwendig sind, um Lange Wellen auszulösen. Es befasst sich mit der Problematik der empirischen Untersuchung von Langen Wellen und präsentiert eine Gegenüberstellung verschiedener empirischer Studien. Die Herausforderungen bei der Datengewinnung und -interpretation werden beleuchtet, um die Grenzen und Möglichkeiten der empirischen Überprüfung der Theorie aufzuzeigen. Die verschiedenen Studien liefern unterschiedliche Ergebnisse, wodurch die Komplexität des Themas unterstrichen wird.
Die historische Betrachtung der Langen Wellen: Dieses Kapitel beleuchtet die historischen Beispiele der Langen Wellen, die in den vorherigen Kapiteln theoretisch und empirisch behandelt wurden. Die einzelnen Kondratieff-Zyklen werden historisch eingeordnet und analysiert. Der Fokus liegt auf der Verknüpfung von Theorie und Empirie. Die Analyse der Zyklen liefert konkrete Beispiele für die Wirkung von Innovationen auf die wirtschaftliche Entwicklung, veranschaulicht die Theorie und beleuchtet deren Grenzen.
Schlüsselwörter
Lange Wellen, Kondratieff-Zyklen, Innovationen, General Purpose Technologies (GPTs), technologischer Wandel, empirische Wirtschaftsforschung, historische Analyse, Wirtschaftszyklen.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Analyse der Langen Wellen
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die historische Betrachtung von Innovationen im Kontext der Theorie der Langen Wellen. Sie verfolgt das Ziel, die Entwicklung der Langen Wellen-Theorie nachzuzeichnen, ihren Zusammenhang mit Innovationen zu beleuchten und die wissenschaftlichen Kontroversen zu diskutieren. Ein Schwerpunkt liegt auf dem Vergleich von Theorie und Empirie anhand historischer Ereignisse seit dem 18. Jahrhundert.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die Entwicklung der Langen Wellen-Theorie, den Zusammenhang zwischen Langen Wellen und Innovationen (GPTs), Kontroversen in der wissenschaftlichen Diskussion über Lange Wellen, die empirische Überprüfung der Langen Wellen-Theorie und eine historische Analyse der Langen Wellen anhand konkreter Ereignisse. Es werden die einzelnen Kondratieff-Zyklen historisch eingeordnet und analysiert.
Was sind General Purpose Technologies (GPTs)?
Der Begriff "General Purpose Technology" (GPT) wird definiert und im Kontext der Langen Wellen-Theorie erläutert. Die Arbeit zeigt den Zusammenhang zwischen technologischen Innovationen und langfristigen Wirtschaftszyklen auf.
Wie wird die Existenz von Langen Wellen untersucht?
Die Arbeit analysiert die Anforderungen an Innovationen, die notwendig sind, um Lange Wellen auszulösen. Sie befasst sich mit der Problematik der empirischen Untersuchung von Langen Wellen und präsentiert eine Gegenüberstellung verschiedener empirischer Studien. Die Herausforderungen bei der Datengewinnung und -interpretation werden beleuchtet.
Welche historischen Beispiele werden analysiert?
Die Arbeit beleuchtet die historischen Beispiele der Langen Wellen anhand der einzelnen Kondratieff-Zyklen. Diese werden historisch eingeordnet und analysiert, wobei der Fokus auf der Verknüpfung von Theorie und Empirie liegt. Die Analyse der Zyklen liefert konkrete Beispiele für die Wirkung von Innovationen auf die wirtschaftliche Entwicklung.
Welche Schlüsselwörter sind relevant?
Schlüsselwörter sind: Lange Wellen, Kondratieff-Zyklen, Innovationen, General Purpose Technologies (GPTs), technologischer Wandel, empirische Wirtschaftsforschung, historische Analyse, Wirtschaftszyklen.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit ist in Kapitel gegliedert, beginnend mit einer Einleitung, die die Thematik einführt und die Forschungsfrage stellt. Es folgen Kapitel zu GPTs und der Theorie der Langen Wellen, der Existenz von Langen Wellen, der historischen Betrachtung der Langen Wellen und einem Fazit. Die Kapitel enthalten jeweils Zusammenfassungen der wichtigsten Punkte.
Welche Schlussfolgerungen werden gezogen?
Das Fazit fasst die Ergebnisse der Arbeit zusammen und bewertet die Erkenntnisse im Kontext der bestehenden Literatur. Es bewertet den Zusammenhang zwischen Innovationen und langfristigen wirtschaftlichen Entwicklungen im Lichte der untersuchten Theorie und empirischen Daten. (Der genaue Inhalt des Fazits ist in der bereitgestellten Zusammenfassung nicht detailliert beschrieben.)
- Quote paper
- M. Zöllner (Author), 2013, Die historische Betrachtung von Innovationen und die Theorie der Langen Wellen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/289336