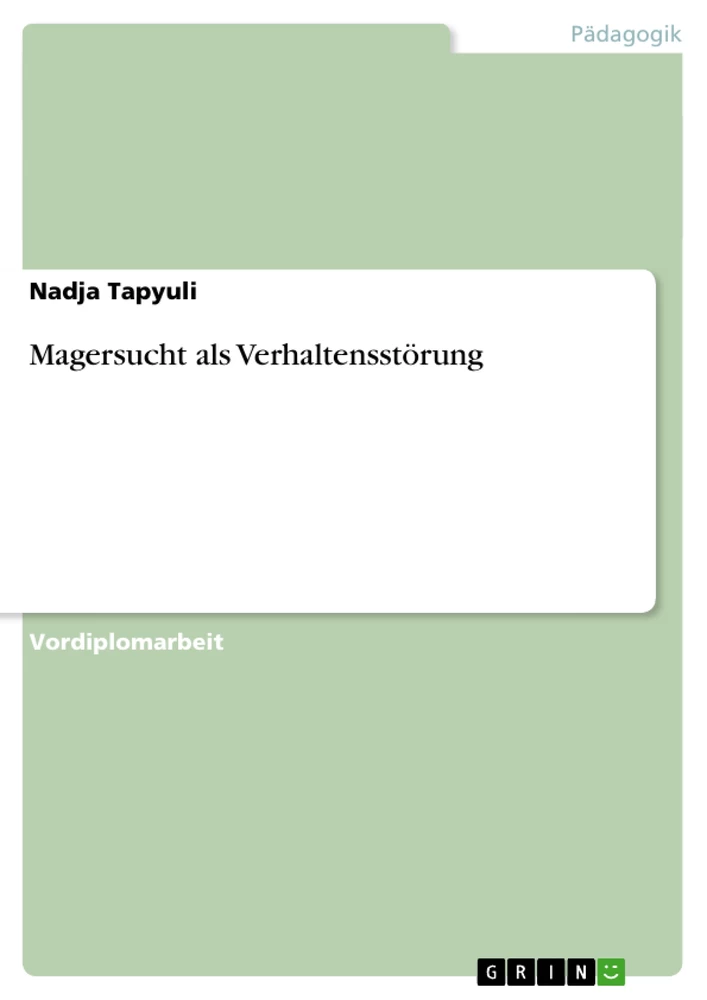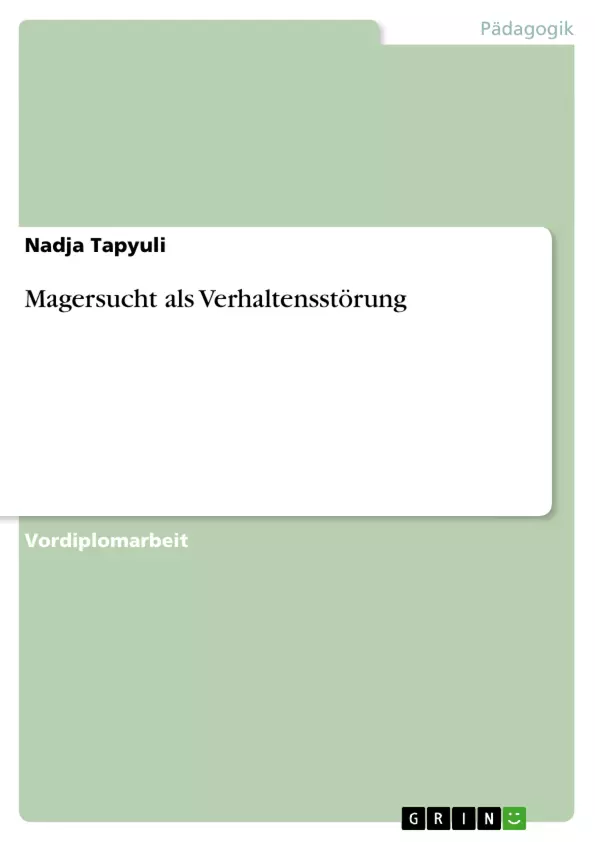Magersucht ist ein in unserem Kulturkreis weit verbreitetes Phänomen, das von Wissenschaft und Publizistik inzwischen in einer Fülle von Literatur behandelt wird. Oft jedoch scheint es, als fänden die unterschiedlichen Ansätze aus Medizin, Soziologie, Psychologie und Pädagogik kaum mehr eine gemeinsame Sprache. Dies wird deutlich wenn man sich die unterschiedlichen Zuordnungen des Störungsbildes vor Augen führt.
In der Literatur wird Magersucht vornehmlich als eine psychosomatische oder psychische Krankheit dargestellt. Baeck (1994) beschreibt Magersucht als eine „psychosomatische Erkrankung, bei der Körper und Seele aufeinander reagieren und in der Folge zwanghafte mit Körperverlust einhergehende Verhaltensweisen beim Essen bewirken“ (S. 8). Gerlinghoff (1990) ist ebenfalls der Ansicht, Magersucht trete als psychosomatische Erkrankung in Erscheinung, wobei sich die offenbar zugrundeliegenden psychischen Probleme in organischen Symptomen und abweichenden Verhaltensweisen äußern (S. 16). König (1991) dagegen ordnet Magersucht den psychoneurotischen Störungen zu (vgl. Pierro 1995, S. 10). Seltener wird Magersucht als eine Verhaltensstörung definiert. Nach Myschker (1990) beinhalten Verhaltensstörungen auch psychophysische Störungen, zu denen er die Magersucht zählt (S. 352 f.). Auch Vernooij (1987) begreift Magersucht als eine Verhaltensstörung und definiert sie als „eine psychische Störung des Wahrnehmens, Erlebens und Verhaltens, die im Überschneidungsfeld von Sonderpädagogik und Medizin anzusiedeln ist“ (S. 69). Nach dem Klassifikationssystem psychischer Störungen (ICD-10) wird Magersucht unter dem Kapitel „Verhaltensauffälligkeiten in Verbindung mit körperlichen Störungen und Faktoren“ (F5) aufgelistet (vgl. Dilling et al. 2000, S. 38 und 135). Die Literaturrecherchen ergeben keine eindeutige Antwort auf die Frage der Zuordnung der Magersucht. Ist sich die Wissenschaft nicht einig über eine klare Klassifikation ? Oder teilen die Wissenschaftler doch alle die Meinung, dass es sich bei Magersucht vorrangig um eine psychische Störung handelt, deren Symptome z.T. in einem von der Norm abweichenden Verhalten der Betroffenen zu erkennen sind? Oder kann Magersucht selbst als eine Verhaltensstörung definiert werden?
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Verhaltensstörungen
- Begriffsklärung
- Definition
- Ausmaß
- Erscheinungsformen
- Ursachen und Maßnahmen
- Das „Drei-Phasen-Modell“
- Das „Ökologische Modell“
- Magersucht
- Begriffsklärung
- Definition
- Ausmaß
- Verlauf
- Symptomatik
- Somatische Begleiterscheinungen
- Psychisches Erscheinungsbild
- Verhalten Magersüchtiger
- Ursachen und Maßnahmen
- Überlegungen zu einem identitätsorientierten Ansatz
- Soziokulturelle und gesellschaftliche Ansätze
- Diskussion: Magersucht als Verhaltensstörung
- Übereinstimmungen
- Abweichungen
- Aufgabe der Pädagogen
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit untersucht die Frage, ob Magersucht als Verhaltensstörung betrachtet werden kann. Hierfür werden zunächst die Definitionskriterien, Erscheinungsformen und Ursachen von Verhaltensstörungen dargestellt. Anschließend wird Magersucht anhand ihrer Symptomatik, Ursachen und möglicher Maßnahmen beleuchtet. Abschließend wird diskutiert, inwiefern Übereinstimmungen und Abweichungen zwischen Magersucht und den Definitionen von Verhaltensstörungen bestehen und welche Rolle Pädagogen in diesem Kontext einnehmen können.
- Definition und Abgrenzung von Verhaltensstörungen
- Symptome und Ursachen der Magersucht
- Zusammenhänge zwischen Magersucht und Verhaltensstörungen
- Mögliche pädagogische Interventionsansätze
- Relevanz des Themas für Pädagogen
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema Magersucht ein und stellt die Forschungsfrage nach ihrer Zuordnung als Verhaltensstörung in den Vordergrund. Es wird auf die vielfältige Betrachtungsweise in verschiedenen Fachdisziplinen hingewiesen und die Notwendigkeit einer klaren Klassifikation betont.
- Verhaltensstörungen: Dieses Kapitel definiert und erläutert den Begriff „Verhaltensstörung“ sowie deren Erscheinungsformen und Ursachen. Dabei werden verschiedene Modelle zur Erklärung von Verhaltensstörungen vorgestellt, unter anderem das „Drei-Phasen-Modell“ und das „Ökologische Modell“.
- Magersucht: Dieses Kapitel befasst sich mit der Definition, Symptomatik und Ursachen der Magersucht. Es werden sowohl körperliche als auch psychische Symptome sowie verschiedene Erklärungsansätze diskutiert.
- Diskussion: Magersucht als Verhaltensstörung: In diesem Kapitel werden die Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen Magersucht und den Definitionen von Verhaltensstörungen diskutiert. Es werden Argumente für und gegen die Zuordnung der Magersucht als Verhaltensstörung präsentiert.
- Aufgabe der Pädagogen: Dieses Kapitel beleuchtet die Rolle von Pädagogen im Umgang mit Magersucht. Es werden mögliche Interventionsansätze und Präventionsmaßnahmen erörtert, die von Pädagogen im schulischen und außerschulischen Kontext eingesetzt werden können.
Schlüsselwörter
Magersucht, Verhaltensstörung, Essstörung, Psychosomatik, Pädagogik, Intervention, Prävention, Identitätsentwicklung, Soziokulturelle Faktoren, Gesellschaftliche Einflüsse, Therapie, Behandlung, Erklärungsmodelle, Pädagogische Ansätze.
Häufig gestellte Fragen
Wird Magersucht als Verhaltensstörung eingestuft?
Magersucht wird oft als psychosomatische Krankheit definiert, kann aber nach dem ICD-10 auch als Verhaltensauffälligkeit in Verbindung mit körperlichen Störungen betrachtet werden.
Welche Ursachen führen zur Entstehung von Magersucht?
Neben individuellen psychischen Problemen spielen soziokulturelle Faktoren, gesellschaftliche Schönheitsideale und Probleme bei der Identitätsentwicklung eine zentrale Rolle.
Was sind typische Symptome von Magersucht?
Zu den Symptomen zählen extremes Untergewicht, gestörte Körperwahrnehmung, zwanghaftes Essverhalten sowie somatische Begleiterscheinungen wie Hormonstörungen.
Welche Aufgabe haben Pädagogen bei Essstörungen?
Pädagogen leisten wichtige Arbeit in der Prävention und Früherkennung, indem sie ein gesundes Selbstwertgefühl fördern und als Vermittler zu therapeutischen Einrichtungen fungieren.
Was ist das "Ökologische Modell" bei Verhaltensstörungen?
Dieses Modell betrachtet Verhaltensstörungen nicht isoliert im Individuum, sondern als Ergebnis der Wechselwirkung zwischen der Person und ihrer sozialen Umwelt.
- Quote paper
- Nadja Tapyuli (Author), 2003, Magersucht als Verhaltensstörung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/29020