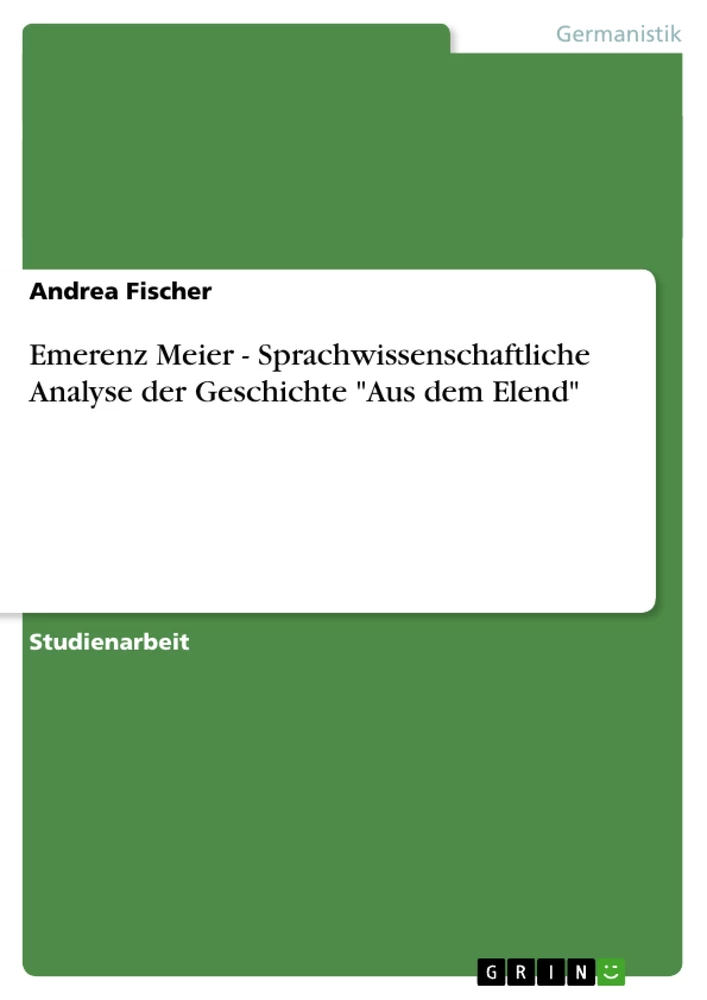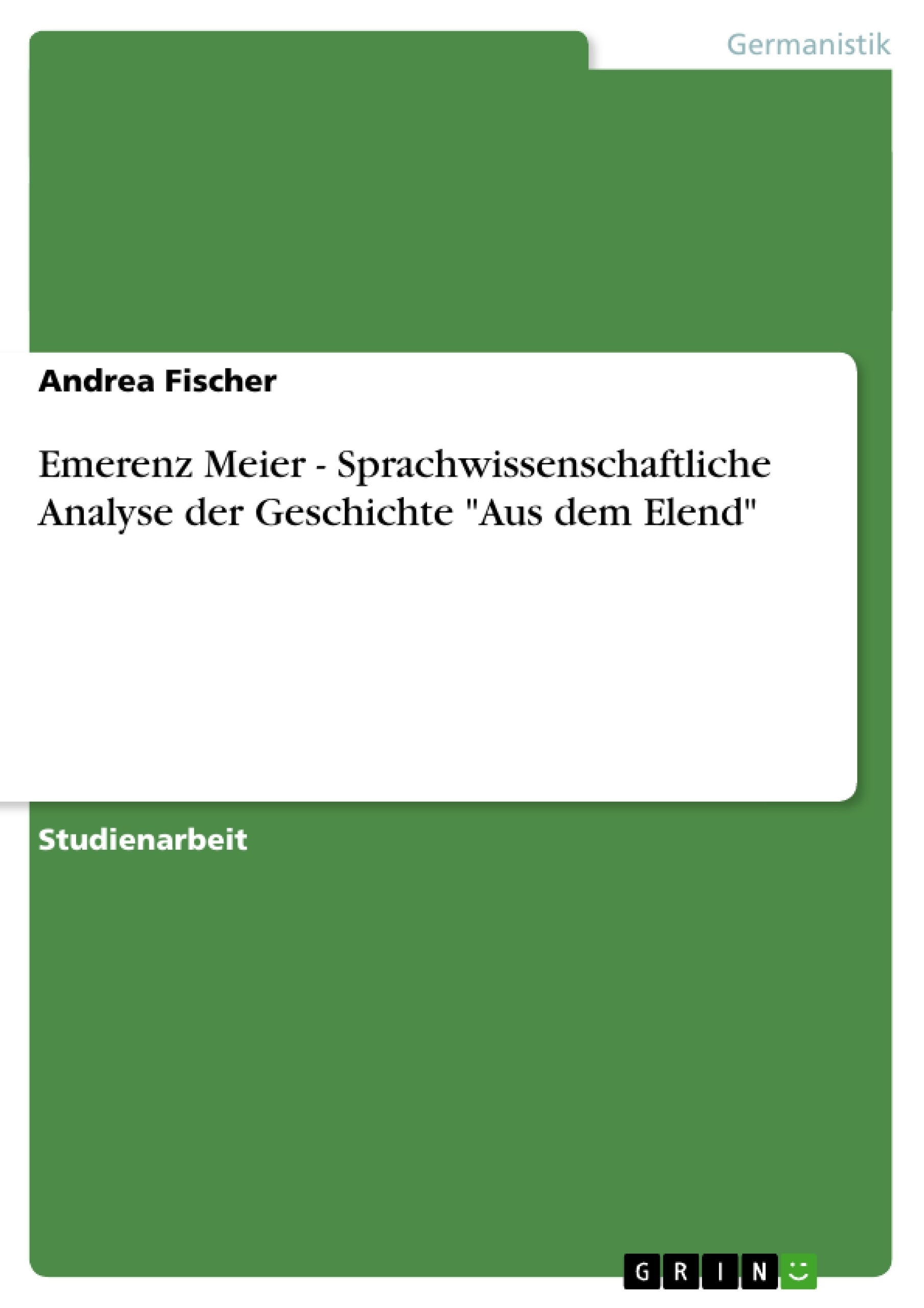Emerenz Meier wird am 3. Oktober 1874 als sechste Tochter des
Land- und Gastwirts Josef Meier und seiner Frau Emerenz in
Schiefweg bei Waldkirchen geboren.
Sie besucht die Volksschule Waldkirchen und liest bereits mit zehn
Jahren Werke von Schiller, Goethe und andren hochrangigen
Autoren.
Schon während ihrer Schulzeit schreibt sie kleinere Gedichte und
Verse, zugleich arbeitet sie am elterlichen Hof und in der Gastwirtschaft mit.
1893 erscheint in der Passauer Zeitung Donau Zeitung zum ersten
Mal eine Erzählung von Emerenz Meier, „Der Juhschroa“.
1895 wird auch in der Augsburger Abendzeitung eine Erzählung, „Die Madlhüttler“,
abgedruckt.
1896 beginnt die Freundschaft zu Auguste Unertl, die sie sowohl geistig als auch materiell
unterstützt. In diesem Jahr wird auch Prof. Karl Weiß-Schrattenthal, Lehrer Deutscher
Literaturgeschichte in Pressburg, auf Emerenz Meier aufmerksam. Nach einer Sommerfrische
in Waldkirchen verlegt er 1897 vier ihrer Erzählungen in seiner Reihe „Dichterstimmen aus
dem Volk“. Ihre Erzählungen bekommen durchaus positive Kritiken, vor allem ihre Frische,
Natürlichkeit und ihre Realistik werden gelobt. Sogar in deutschsprachigen amerikanischen
Zeitschriften wird über sie berichtet. Lediglich der finanzielle erfolg blieb mit diesem Buch
aus. In der Folgezeit veröffentlichen wieder Zeitschriften ihre Werke.
1899 verschafft ihr Guste Unertl Audienzen bei Prinzessin Therese von Bayern und Prinz
Dr. Ludwig Ferdinand von Bayern in München, doch die Hoffnung auf ein Stipendium wird
nicht erfüllt.
Im Jahre 1900 lernt Emerenz Meier den Würzburger Seminarlehrer Albert Miller und dessen
Familie kennen. Er lädt sie nach Würzburg ein und Emerenz verbringt dort drei Monate
während derer sie Vorträge hört, Kurse absolviert und Studien in Literatur, Philosophie und
Theologie betreibt. Kurz nach ihrer Rückkehr wird ihre Erzählung „Aus dem Elend“ im
Passauer Stadttheater mit großem Erfolg aufgeführt. Auch ihre Erzählung „Der
G’schlößlbauer“ wird, wenn auch mit Abänderungen, im Theater in Passau 1902 aufgeführt.
Im selben Jahr übernimmt Emerenz die Schifferkneipe „Zum Koppenjäger“ in der Passauer
Altstadt, die sie 1903 aber wieder aufgeben muss. [...]
Inhaltsverzeichnis
- Leben der Emerenz Meier
- Inhaltsangabe "Aus dem Elend" und Analyse des Textes
- Inhalt
- Sprachprägung
- Analyse des Textes
- Lexik
- Morphologie
- Phonetik
- Syntax
- Der Text als Ausdruck von Zeit und Umstand
- Literaturverzeichnis
- Anhang: Kopie der Erzählung "Aus dem Elend"
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Hausarbeit von Andrea Fischer analysiert die Erzählung "Aus dem Elend" von Emerenz Meier aus sprachwissenschaftlicher Perspektive. Die Arbeit untersucht die sprachliche Gestaltung des Textes, um die Besonderheiten der Sprache und die historischen und sozialen Kontexte, in denen die Geschichte geschrieben wurde, aufzuzeigen.
- Sprachliche Besonderheiten der Erzählung "Aus dem Elend"
- Analyse der sprachlichen Mittel zur Darstellung von Charakteren und Beziehungen
- Die Rolle von Dialekt und Umgangssprache im Text
- Die Geschichte als Spiegel ihrer Zeit und der sozialen Verhältnisse
- Die sprachliche Gestaltung von Emotionen und Konflikten in der Erzählung
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel 1: Die Geschichte beginnt mit der Ankunft des verwaisten, halb erfrorenen Mädchens Itta aus dem böhmischen Grenzort Elend auf dem Reutbauernhof im Dorf Kaltwasser. Burgl, die verwitwete Schwester des Bauern, zeigt Mitleid mit Itta und möchte sie bei sich aufnehmen, während der Bauer voller Vorurteile gegen die Böhmen ist.
- Kapitel 2: Der Bauer stimmt schließlich Burgls Vorschlag zu und lässt Itta bei ihnen wohnen. Gottfried, der Sohn des Bauern, lehnt das Mädchen jedoch ab, nicht zuletzt, weil sie ihm die Liebe und Fürsorge Burgls streitig macht. Burgl kümmert sich liebevoll um Itta, lehrt sie die Religion und das Lesen.
- Kapitel 3: An Kirchweih zeigt sich Gottfrieds Untergang: Er verschläft, weil er die Nacht durchgezecht hat, und muss seinen Vater um Geld bitten, da er mit seinem Budget nicht haushalten kann. Gottfried verachtet Itta, die unter seinen Streichen leidet, da sie in ihn verliebt ist. Im Gasthof unterhält sich Gottfried mit den Töchtern des Greiningerbauern, vor allem mit Resie. Itta wird zornig und folgt Burgl, die das Lokal verlässt, da sie die lustige Gesellschaft wegen ihrer Trauer um ihren Mann nicht aushalten kann.
- Kapitel 4: Vor dem Lokal erzählt Burgl Itta, dass sie ihren Mann am Allerseelentag kennen gelernt, geheiratet und verloren hat. Er hat Burgl gelehrt, wie Burgl jetzt Itta lehrt. Burgls Mann wurde im Grenzwald erschossen und der Täter wurde seit dem nicht gefunden. Ein Brief von Gottfried aus der Garnison trifft ein, der seine Ankunft einige Tage später ankündigt. Eine Hochzeit mit Resie ist in der Familie bereits abgesprochen. Itta schmerzt die Vorstellung sehr, ihre Liebe zu Gottfried wird immer offenkundiger.
- Kapitel 5: Gottfried übernimmt den Hof, die Mutter ist vor einem Jahr gestorben und Burgls Zustand ist ebenfalls bedenklich. Itta erledigt den Haushalt, distanziert sich aber sonst von Gottfried. Am Abend des 6. Januar sitzt die ganze Familie samt Personal zusammen, als die heiligen drei Könige auftreten und der Engel sich schließlich als Resie entpuppt. Gottfried überlegt, ob Resie wirklich die Richtige für ihn ist. Itta lenkt das Gespräch zu einem anderen Thema und Gottfried fühlt sich an diesem Tag sehr wohl zu Hause, obwohl er sonst lieber im Gasthaus sitzt.
- Kapitel 6: Die Besuche des Doktors, der sich um die kranke Burgl kümmert, nehmen zu. Der Arzt verehrt Itta und macht ihr einen Heiratsantrag, den sie wegen ihrer Herkunft ablehnt. Als der Arzt beteuert, dass ihm ihre Herkunft nichts ausmache, betritt Gottfried die Szene. Seine spöttische Haltung lässt erkennen, dass er eifersüchtig ist. Gottfried prügelt sich auf einer Wiese mit dem Knecht und wird dabei mit einem Messer verletzt. Als Grund für den Streit gilt die böhmische Herkunft des Knechts, obwohl sich dies später nicht bestätigt.
Schlüsselwörter
Die Hausarbeit befasst sich mit der sprachlichen Analyse der Erzählung "Aus dem Elend" von Emerenz Meier. Die zentralen Schlüsselbegriffe sind: Sprachwissenschaft, Erzähltextanalyse, Lexik, Morphologie, Phonetik, Syntax, Dialekt, Umgangssprache, Zeitgeschichte, soziale Verhältnisse, Emotionen, Konflikte, Figurencharakterisierung, literarische Analyse.
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in Emerenz Meiers Erzählung "Aus dem Elend"?
Die Geschichte handelt von dem Waisenmädchen Itta aus dem böhmischen Ort Elend, das auf einem bayerischen Bauernhof aufgenommen wird und dort mit Vorurteilen und unglücklicher Liebe konfrontiert ist.
Welche sprachlichen Aspekte werden in der Arbeit analysiert?
Die Arbeit untersucht Lexik, Morphologie, Phonetik und Syntax des Textes unter Berücksichtigung von Dialekt und Umgangssprache.
Wie wird die böhmische Herkunft der Hauptfigur thematisiert?
Die Herkunft führt zu sozialen Konflikten und Vorurteilen seitens der Dorfbewohner, was sich auch in der sprachlichen Abgrenzung widerspiegelt.
Welche Rolle spielt der Dialekt in Meiers Werk?
Der Dialekt dient als Ausdruck von Natürlichkeit und Realistik und verankert die Charaktere fest in ihrem sozialen und regionalen Umfeld.
Was erfährt man über das Leben von Emerenz Meier?
Die Arbeit beschreibt ihren Weg von einer Gastwirtstochter im Bayerischen Wald zu einer anerkannten Autorin, die trotz positiver Kritiken oft mit finanziellen Sorgen kämpfte.
- Arbeit zitieren
- Andrea Fischer (Autor:in), 2004, Emerenz Meier - Sprachwissenschaftliche Analyse der Geschichte "Aus dem Elend", München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/29083