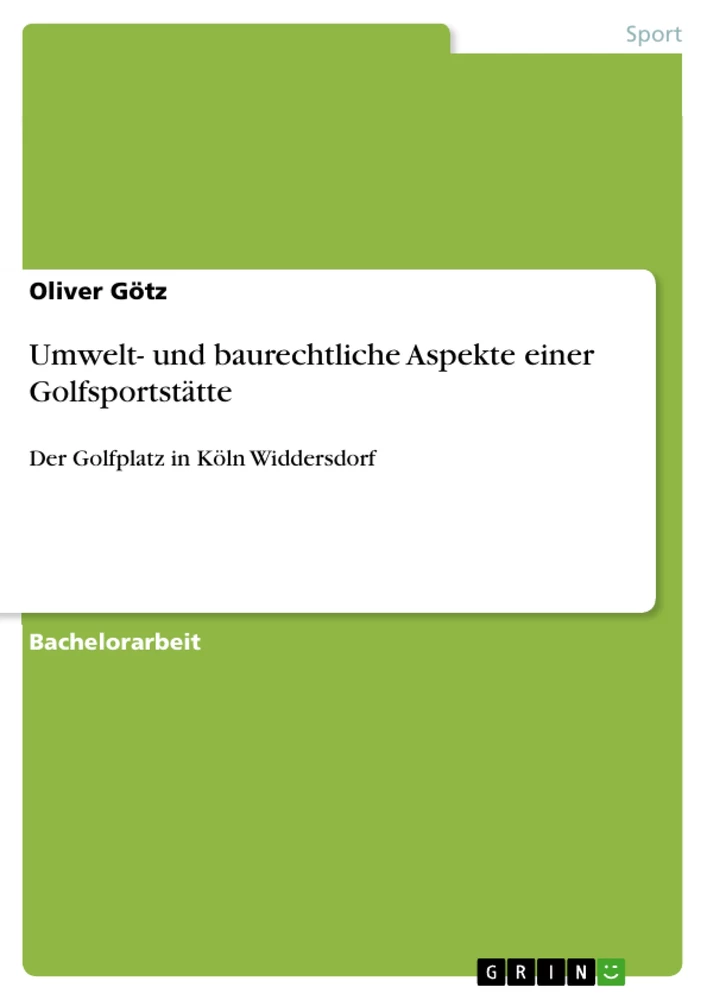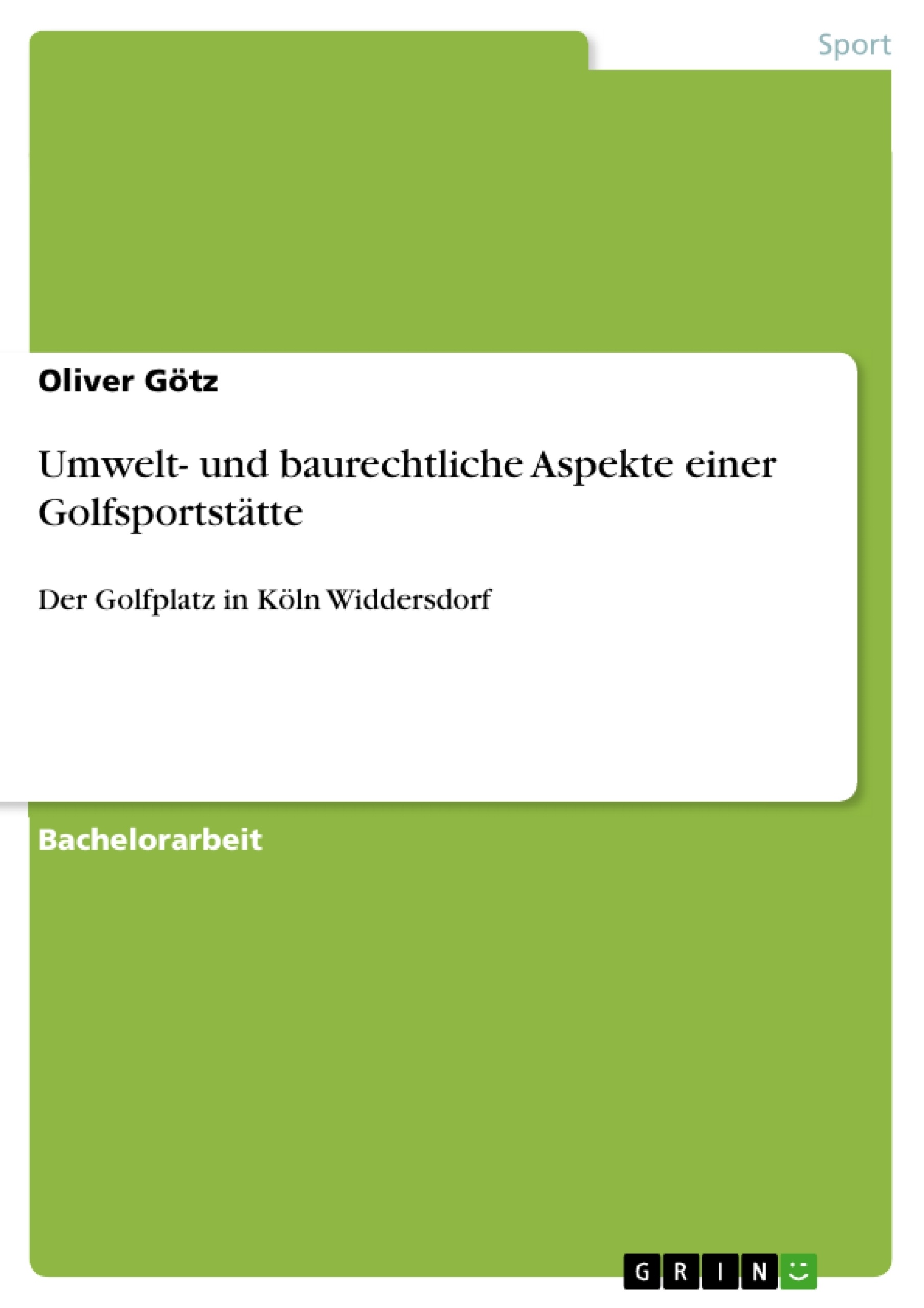„Der Golfsport erfreut sich seit vielen Jahren einer wachsenden Medienpräsenz“ (Steingrube & Ziebarth, 2005, S. 5). Nationale sowie internationale Golfturniere sind Bestandteil der Sportnachrichtenerstattung. Früher war diese Sportart der oberen Gesellschaftsschicht vorbehalten und galt als extravagant. Mittlerweile hat sie sich zu einer bedeutenden Breitensportart entwickelt, die nachweislich vermehrt von Jugendlichen praktiziert wird. Auch Senioren finden sich in der Zielgruppe wieder, um beispielsweise von den gesundheitlichen Aspekten zu profitieren. Die physischen Anforderungen an das Herzkreislaufsystem sind gering, d.h. es wird sich zu keinem Zeitpunkt im anaeroben Bereich bewegt. Die Spieler legen bei einer 18-Loch Anlage geschätzte 8 km zurück, was sich positiv auf den Bewegungsapparat und die Gesundheit auswirkt. (Boldt, Ferrauti & Wolff, 2000).
Längst wurde der Golfsport auch von der Wirtschaft als profitable Kommunikationsplattform entdeckt. Audi als Haupt- und Sky als Premiumsponsor zählen zu den großen Geldgeber, die Millionenbeträge investieren (http://www.golf.de/dgv/sponsoren.cfm, Zugriff am 11.06.2014).
„Gerade diejenigen Sportarten, die in der freien Natur betrieben werden mit dem Ziel, sportliche Erfolgserlebnisse mit dem Erleben der Natur zu kombinieren, beeinträchtigen eben diese Natur häufig am nachhaltigsten“ (Weisemann & Spieker, 1997, S. 2010). So auch der Golfsport. Dem Jahresbericht 2012 des Deutschen Golf Verbandes zu Folge nimmt die Zahl der aktiven Golfer jährlich zu. Im Jahr 2012 betrug die Anzahl der Golfer 635.097. Der Boom des Golfsports führt zu einer erhöhten Frequentierung von bereits genutzten Gebieten. Dabei werden nicht selten Belastungsgrenzen überschritten, zusätzlich entstehen erhebliche Störwirkungen auf Flora und Fauna (Winkelmann & Wilken, 1998). Die vermehrten Planungen und Errichtungen von Golfanlagen zeugen von der positiven Nachfrageentwicklung. Nordrhein-Westfahlen und Bayern sind die größten Landesverbände. Dort befinden sich über 150 Anlagen, mit 173 bzw. 196 DGV-Mitglieder. Diese Tatsachen sind entscheidende Katalysatoren für die gestiegene Belastungen von Natur und Umwelt für die sich der Sport verantworten muss.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Relevanz des Themas
- Entwicklung des Golfsports
- Golfplatz Köln Widdersdorf
- Ökologische Perspektive
- Konfliktpotentiale
- Landschaftsentwicklung
- Darstellung der verschiedenen Rechtsebenen
- EG-Recht
- Umweltverträglichkeitsprüfung
- Vogelschutzrichtlinie
- Schutzpflicht und FFH-Gebiete
- Bundesrecht
- Sport in der Verfassung
- Umwelt in der Verfassung
- Länderrecht
- Kommunalrecht
- Der Golfplatz als Bauvorhaben
- Das Baugesetzbuch im Überblick
- Anforderungen eines Golfplatzes aus baurechtlicher Sicht
- Einstufung als „sonstiges Vorhaben“
- Direkte Steuerungsmöglichkeiten
- Natur- und Landschaftsschutz
- Arten-,Biotop- und Tierschutz
- Wasserrecht
- Immissionsschutzrecht
- Wald- und Forstrecht
- Indirekte Steuerungsmöglichkeiten
- Landschaftsplanung
- Bauordnungsrecht
- Bauplanungsrecht
- Zusammenfassung und Fazit
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Bachelorarbeit befasst sich mit den umwelt- und baurechtlichen Aspekten einer Golfsportstätte am Beispiel des Golfplatzes in Köln Widdersdorf. Ziel ist es, die rechtlichen Rahmenbedingungen für die Errichtung und den Betrieb einer Golfanlage zu analysieren und die relevanten Rechtsnormen zu beleuchten. Dabei werden die ökologischen Auswirkungen des Golfplatzes auf die Landschaft und die Tier- und Pflanzenwelt sowie die baurechtlichen Anforderungen an die Anlage im Vordergrund stehen.
- Rechtliche Rahmenbedingungen für die Errichtung und den Betrieb von Golfanlagen
- Ökologische Auswirkungen von Golfanlagen auf die Umwelt
- Baurechtliche Anforderungen an Golfanlagen
- Konfliktpotentiale zwischen Golfplatz und Umwelt
- Steuerungsmöglichkeiten im Umwelt- und Baurecht
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema ein und erläutert die Relevanz des Themas sowie die Entwicklung des Golfsports. Anschließend wird der Golfplatz Köln Widdersdorf als Fallbeispiel vorgestellt. Das zweite Kapitel befasst sich mit der ökologischen Perspektive und analysiert die Konfliktpotentiale sowie die Landschaftsentwicklung. Im dritten Kapitel werden die verschiedenen Rechtsebenen, die für die Errichtung und den Betrieb einer Golfanlage relevant sind, dargestellt. Dazu gehören das EG-Recht, das Bundesrecht, das Länderrecht und das Kommunalrecht. Das vierte Kapitel widmet sich dem Golfplatz als Bauvorhaben und beleuchtet das Baugesetzbuch sowie die baurechtlichen Anforderungen an Golfanlagen. Im fünften Kapitel werden die direkten Steuerungsmöglichkeiten im Umwelt- und Baurecht, wie z.B. Natur- und Landschaftsschutz, Arten-, Biotop- und Tierschutz, Wasserrecht, Immissionsschutzrecht und Wald- und Forstrecht, vorgestellt. Das sechste Kapitel behandelt die indirekten Steuerungsmöglichkeiten, wie z.B. Landschaftsplanung, Bauordnungsrecht und Bauplanungsrecht.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen den Golfplatz, Umweltverträglichkeit, Baurecht, Landschaftsschutz, Arten- und Biotopschutz, Wasserrecht, Immissionsschutz, Wald- und Forstrecht, Planung und Steuerung. Die Arbeit analysiert die rechtlichen Rahmenbedingungen für die Errichtung und den Betrieb einer Golfanlage und beleuchtet die ökologischen Auswirkungen auf die Umwelt.
Häufig gestellte Fragen
Welche ökologischen Konflikte entstehen durch Golfplätze?
Golfanlagen können Belastungsgrenzen der Natur überschreiten, Störwirkungen auf Flora und Fauna ausüben und die Landschaftsentwicklung in unberührten Gebieten negativ beeinflussen.
Welche rechtlichen Ebenen sind für den Bau einer Golfanlage relevant?
Relevant sind das EG-Recht (z.B. Vogelschutzrichtlinie, FFH-Gebiete), das Bundesrecht (Baugesetzbuch), das Länderrecht sowie das kommunale Planungsrecht.
Ist eine Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) für Golfplätze notwendig?
Ja, im Rahmen des EG- und Bundesrechts ist oft eine UVP erforderlich, um die Auswirkungen auf die Umwelt vor der Genehmigung zu prüfen.
Wie wird ein Golfplatz baurechtlich eingestuft?
Ein Golfplatz wird im Baugesetzbuch häufig als „sonstiges Vorhaben“ im Außenbereich eingestuft, was spezifische Anforderungen an die Genehmigungsfähigkeit stellt.
Welche direkten Steuerungsmöglichkeiten gibt es im Umweltrecht?
Dazu zählen Gesetze zum Natur- und Landschaftsschutz, das Wasserrecht, das Immissionsschutzrecht sowie das Arten- und Biotopschutzrecht.
- Quote paper
- Oliver Götz (Author), 2014, Umwelt- und baurechtliche Aspekte einer Golfsportstätte, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/293168