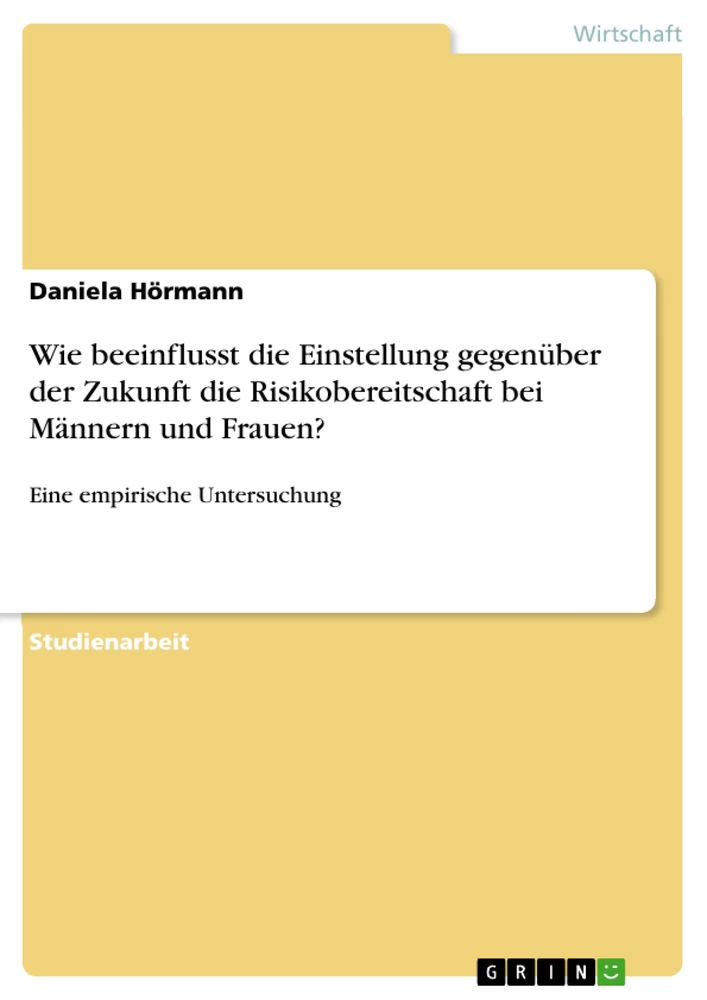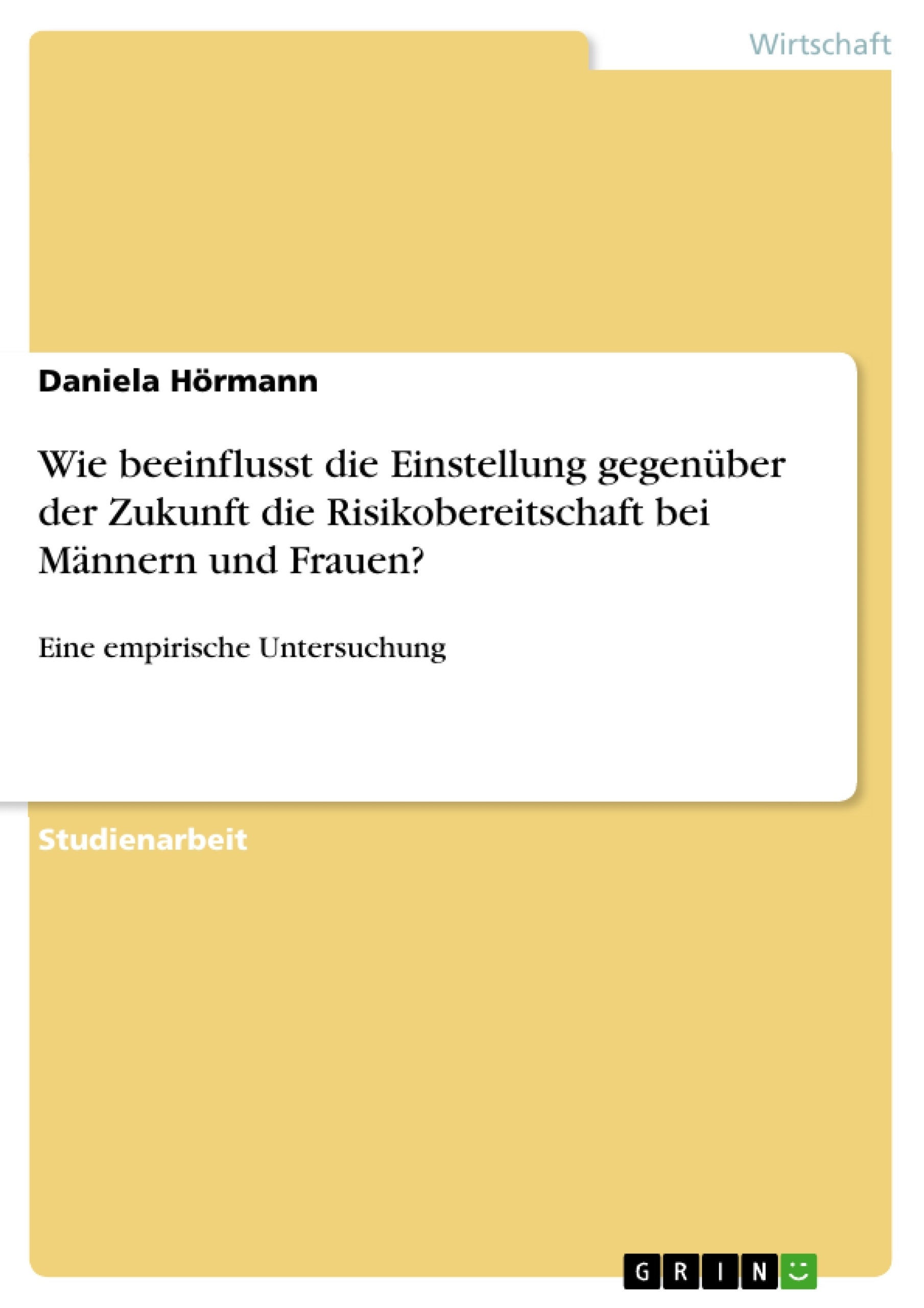Der Zweck dieser Studie ist zu erforschen, in welchem Ausmaß sich die Einstellung gegenüber der Zukunft einer Person – unter Kontrolle materialistischen Denkens – zur Vorhersage risikoreichen Verhaltens eignet. Außerdem wird die Frage beantwortet, inwieweit sich das männliche und das weibliche Geschlecht dabei unterscheiden. Hierfür wurden insgesamt 274 Personen ab 18 Jahren schriftlich anhand eines persönlich verteilten Fragebogens befragt. Korrelations- und Regressionsanalysen zeigten, dass es weder bei Männern, noch bei Frauen einen statistisch signifikanten Zusammenhang zwischen der Einstellung gegenüber der Zukunft und dem risikoreichen Verhalten gibt. Jedoch konnte festgestellt werden, dass Männer im Allgemeinen ein risikoreicheres Verhalten zeigen als das weibliche Geschlecht. Zudem gibt es eine negative Beziehung zwischen der Einstellung gegenüber der Zukunft und dem materialistischen Denken. Demnach ist es statistisch signifikant, dass Menschen, die eine positive Einstellung der Zukunft gegenüber haben, weniger Wert auf materielle Dinge legen. Gleichzeitig konnte nachgewiesen werden, dass das materialistische Denken auch mit steigendem Alter abnimmt.
Inhaltsverzeichnis
- Zusammenfassung
- Deutsche Zusammenfassung
- Englische Zusammenfassung
- Einleitung
- Theoretischer Hintergrund
- Forschungsfragestellungen
- Methode
- Stichprobe
- Fragebogen
- Messungen
- Statistische Analysen
- Ergebnisse
- Diskussion der Ergebnisse
- Interpretation der Ergebnisse
- Relevanz der Ergebnisse für Theorie und Praxis
- Forschungsanregungen
- Literaturverzeichnis
- Anhang
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Studienarbeit befasst sich mit der Frage, inwieweit die Einstellung gegenüber der Zukunft einer Person, unter Berücksichtigung des materialistischen Denkens, die Vorhersage risikoreichen Verhaltens ermöglicht. Darüber hinaus wird untersucht, ob sich Männer und Frauen in diesem Zusammenhang unterscheiden.
- Zusammenhang zwischen Einstellung gegenüber der Zukunft und risikoreichem Verhalten
- Einfluss des materialistischen Denkens auf die Beziehung zwischen Einstellung gegenüber der Zukunft und risikoreichem Verhalten
- Geschlechtsspezifische Unterschiede im risikoreichen Verhalten
- Zusammenhang zwischen Einstellung gegenüber der Zukunft und materialistischem Denken
- Alterseinfluss auf das materialistische Denken
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik der Altersvorsorge in Deutschland ein und stellt die Problematik des unzureichenden Sparverhaltens der Bevölkerung dar. Im Anschluss wird der theoretische Hintergrund der Studie erläutert, wobei die Bedeutung der Einstellung gegenüber der Zukunft für das individuelle Verhalten und die verschiedenen Dimensionen der Zeitperspektive nach Zimbardo und Boyd (1999) beleuchtet werden.
Die Methode beschreibt die Stichprobe, den Fragebogen, die Messungen und die statistischen Analysen, die in der Studie verwendet wurden. Die Ergebnisse präsentieren die Ergebnisse der Korrelations- und Regressionsanalysen, die durchgeführt wurden, um die Forschungsfragen zu beantworten.
Die Diskussion der Ergebnisse interpretiert die Ergebnisse der Studie und beleuchtet deren Relevanz für Theorie und Praxis. Zudem werden Forschungsanregungen für zukünftige Studien gegeben.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen die Einstellung gegenüber der Zukunft, risikoreiches Verhalten, materialistisches Denken, Geschlechterunterschiede, Altersvorsorge, Zeitperspektive, Zimbardo Time Perspective Inventory (ZTPI), Korrelationsanalyse, Regressionsanalyse.
Häufig gestellte Fragen
Gibt es einen Zusammenhang zwischen der Zukunftseinstellung und Risikoverhalten?
Die Studie fand keinen statistisch signifikanten Zusammenhang zwischen einer positiven Zukunftseinstellung und risikoreichem Verhalten, weder bei Männern noch bei Frauen.
Unterscheiden sich Männer und Frauen in ihrer Risikobereitschaft?
Ja, die Ergebnisse zeigten, dass Männer im Allgemeinen ein risikoreicheres Verhalten an den Tag legen als Frauen.
Wie hängen Materialismus und Zukunftseinstellung zusammen?
Es besteht eine negative Beziehung: Personen mit einer positiven Einstellung gegenüber der Zukunft legen statistisch gesehen weniger Wert auf materielle Dinge.
Verändert sich materialistisches Denken mit dem Alter?
Ja, die Studie konnte nachweisen, dass materialistisches Denken mit steigendem Alter abnimmt.
Welches Instrument wurde zur Messung der Zeitperspektive genutzt?
Es wurde das Zimbardo Time Perspective Inventory (ZTPI) verwendet, um die verschiedenen Dimensionen der Zeitwahrnehmung zu erfassen.
- Quote paper
- Daniela Hörmann (Author), 2013, Wie beeinflusst die Einstellung gegenüber der Zukunft die Risikobereitschaft bei Männern und Frauen?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/293692