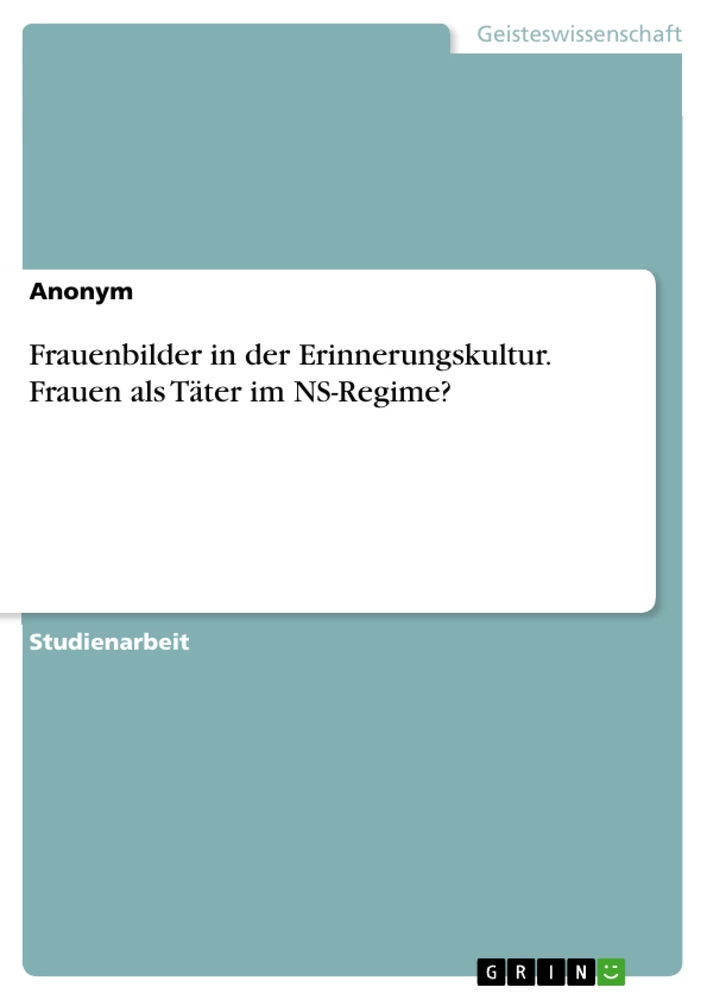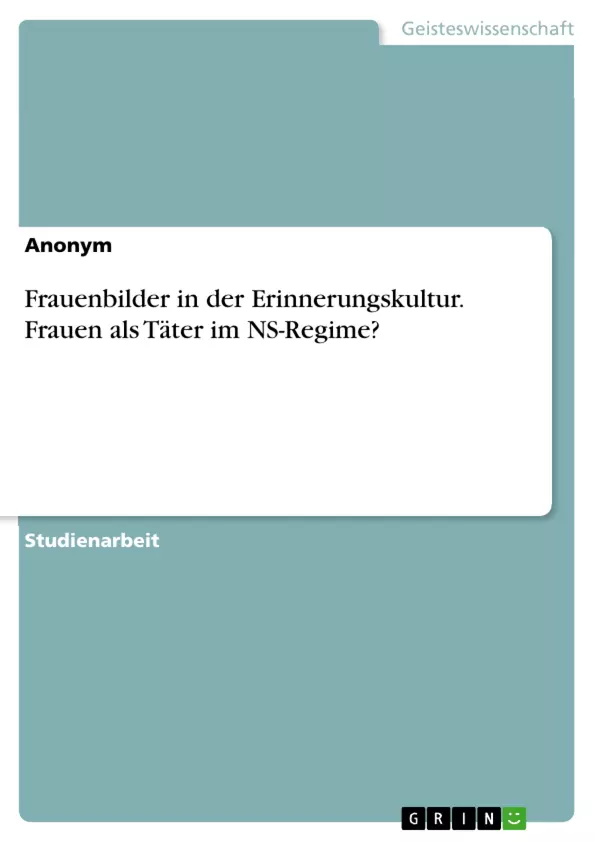Die Erinnerungskultur an den Nationalsozialismus in Deutschland und die Shoah hat in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten verschiedene Etappen durchlaufen. Politik, Medien und Öffentlichkeit haben dabei über die Jahre äußerst unterschiedliche Strategien entwickelt mit der Vergangenheit umzugehen.
Auffällig dabei ist, dass trotz der mittlerweile recht breit gefächerten Diskussion die Frage nach Frauen als Täterinnen in der Erinnerungskultur zumeist nur eine untergeordnete Rolle spielt. In den geschichtswissenschaftlichen Betrachtungen wurden Frauen lange Zeit vor allem als unbeteiligte Zeitgenossinen oder Opfer des Nationalsozialismus behandelt. Erst mit dem Aufkommen der Frauenbewegung in den 1960er-Jahren begann die Auseinandersetzung mit der Rolle von Frauen im Nationalsozialismus. Hier wurde jedoch zunächst ein überwiegend positives Bild der Frauen im „Dritten Reich“ gezeichnet, da es primär darum ging „zwecks positiver weiblicher Identitätsstiftung emanzipierte Frauen in der Geschichte sichtbar zu machen“. Das heißt bei diesen Betrachtungen standen Frauen zunächst vor allem als Opfer des Nationalsozialismus und/oder als Widerstandskämpferinnen im Fokus der Betrachtungen.
Eine kritische Hinterfragung dieser positiven Frauenbilder erfolgte erst Ende der 1970er-Jahre, als Wissenschaftler/innen gezielt damit begannen auch die Frage nach der aktiven Beteiligung von Frauen an den Verbrechen des Nationalsozialismus zu stellen. In den folgenden Jahren und Jahrzehnten rückte zunehmend die Tatsache, dass auch Frauen als Täterinnen betrachtet werden können und müssen ins Bewusstsein der Wissenschaft. Die bis dahin vorherrschende Vorstellung, welche Frauen als Hausfrauen und Mütter oder als Opfer des Nationalsozialismus betrachtete, musste folglich revidiert werden.
Auch wenn es in der Zwischenzeit eine Vielzahl geschichtswissenschaftlicher Publikationen gibt, welche die Täterschaft von Frauen thematisieren, spielt die Thematik in der Erinnerungskultur und der öffentlichen Wahrnehmung bisher keine große Rolle. So schreibt etwa Kathrin Kompisch in ihrem Buch Täterinnen: „Diese Handlungsspielräume ganz normaler Frauen in der NS-Diktatur liegen für die Öffentlichkeit immer noch weitgehend im Dunkeln.“ Noch immer wird Schuld und Täterschaft primär mit männlichen Tätern assoziiert, während das Bild der passiven, unpolitischen Hausfrau und Mutter weiterexistiert.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Erinnern und Verdrängen
- Erinnerungskultur der beiden deutschen Staaten
- Gesamtdeutsche Erinnerungskultur nach 1989
- Täterinnen
- Verengung des Täter/innengreises
- Nur Opfer und Zuschauerinnen?
- Wahrnehmung von Frauen in der Erinnerungskultur
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Rolle von Frauen in der Erinnerungskultur an den Nationalsozialismus. Sie analysiert, wie die Geschichte der Täterinnen in der öffentlichen Wahrnehmung und in der Forschung behandelt wurde, und hinterfragt die Gründe für die bis dato bestehende Lücke in der Auseinandersetzung mit weiblicher Schuld.
- Entwicklung der Erinnerungskultur am Nationalsozialismus in Deutschland und die Rolle von Frauen
- Verdrängung der Thematik weiblicher Täterschaft und die Ursachen dafür
- Strategien der Schuldabwehr in der Erinnerungskultur
- Vergleichende Analyse der Betrachtung von Frauen und Männern im Nationalsozialismus
- Aktuelle Debatten um die Rolle von Frauen in der Geschichte des Nationalsozialismus
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Forschungsfrage nach der Rolle von Frauen in der Erinnerungskultur an den Nationalsozialismus und skizziert die Motivation für diese Untersuchung. Das zweite Kapitel befasst sich mit dem Konzept der Erinnerungskultur und untersucht die unterschiedlichen Ansätze im Umgang mit der deutschen Vergangenheit.
Im dritten Kapitel werden verschiedene Theorien und Strömungen zur Erinnerungskultur in den beiden deutschen Staaten nach dem Krieg vorgestellt und analysiert.
Schlüsselwörter
Erinnerungskultur, Nationalsozialismus, Frauen, Täterinnen, Opfer, Schuld, Verdrängung, Geschlechterrollen, Geschichtswissenschaft, öffentliche Wahrnehmung, Medien
Häufig gestellte Fragen
Welche Rolle spielten Frauen lange Zeit in der Geschichtswissenschaft zum Nationalsozialismus?
In geschichtswissenschaftlichen Betrachtungen wurden Frauen lange Zeit primär als unbeteiligte Zeitgenossinnen, Opfer des Regimes oder Widerstandskämpferinnen dargestellt, während ihre Rolle als Täterinnen vernachlässigt wurde.
Wann begann die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit Frauen im Nationalsozialismus?
Die Auseinandersetzung begann verstärkt mit dem Aufkommen der Frauenbewegung in den 1960er-Jahren, wobei zunächst ein eher positives Bild zur weiblichen Identitätsstiftung im Fokus stand.
Wann wurde die aktive Beteiligung von Frauen an NS-Verbrechen kritisch hinterfragt?
Eine kritische Hinterfragung und die Forschung zu Frauen als aktive Täterinnen entwickelten sich erst Ende der 1970er-Jahre systematisch.
Warum spielt weibliche Täterschaft in der öffentlichen Erinnerungskultur bisher eine untergeordnete Rolle?
Schuld und Täterschaft werden in der Öffentlichkeit noch immer primär mit Männern assoziiert, während das Bild der passiven, unpolitischen Hausfrau und Mutter fortbesteht.
Was sind die zentralen Schlüsselwörter dieser Arbeit?
Zu den Schlüsselwörtern gehören Erinnerungskultur, Nationalsozialismus, Täterinnen, Opfer, Schuld, Verdrängung und Geschlechterrollen.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2014, Frauenbilder in der Erinnerungskultur. Frauen als Täter im NS-Regime?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/294826