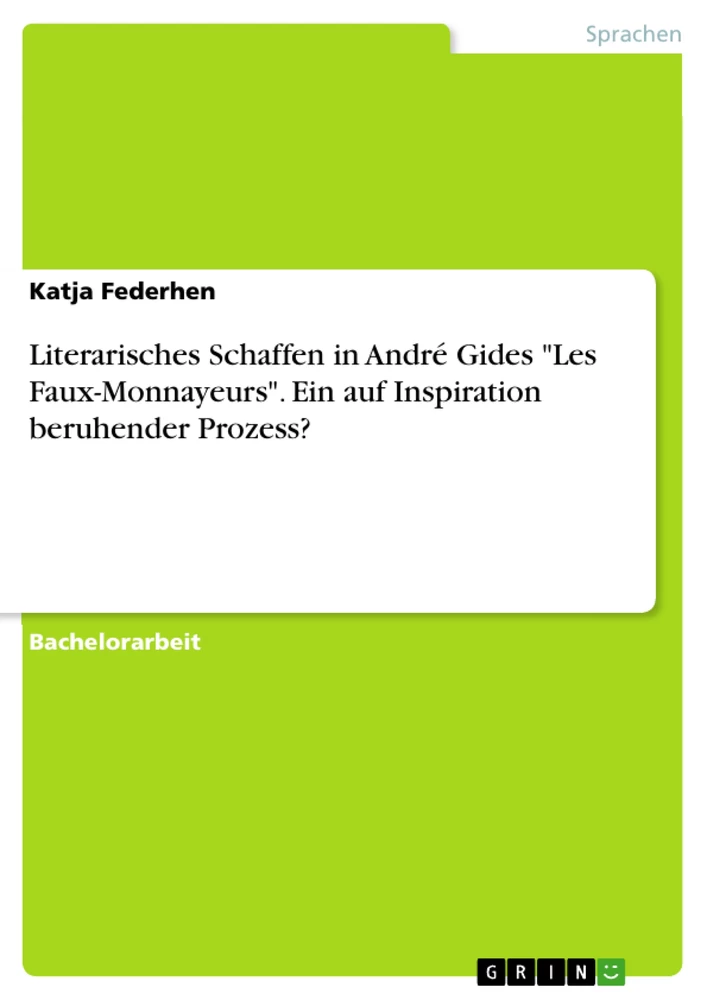In der vorliegenden Untersuchung soll zunächst dem Begriff der Inspiration nachgegangen werden. Nachdem ein Überblick über dessen Bedeutungsgehalte gegeben wurde, wird der Roman "Les Faux-Monnayeurs" daraufhin untersucht, ob tatsächlich „Inspiration“ eine Rolle beim dort dargestellten literarischen Wirken spielt. Für diese Untersuchung bietet "Les Faux-Monnayeurs", welches im Wesentlichen ein Roman über das literarische Schaffen ist , auf mehreren Ebenen Gelegenheit: Ein Roman mit dem Titel "Les Faux-Monnayeurs", der von einem Autor handelt, der seinerseits einen Roman mit eben jenem Titel in Angriff nimmt, und dessen Vorgehen wiederum im Romanverlauf fortwährend durch den Erzähler kommentiert und beurteilt wird, bietet vorliegender Untersuchung zahlreiche Anhaltspunkte, den Prozess des literarischen Schaffens nachzuvollziehen.
Der Protagonist Édouard, in dem man ein Abbild Gides sehen kann , hat die Ambition, einen nie dagewesenen Roman zu schreiben . Er möchte keine „tranche de vie“ darstellen, er hat vielmehr den Wunsch, einen ganzheitlichen Roman zu schreiben: „Pour moi, je ne voudrais pas couper du tout. […] Je voudrais tout y faire entrer, dans ce roman. Pas de coup de ciseaux pour arrêter, ici plutôt que là, sa substance.“
Bei diesem hohen Anspruch stellt sich die Frage, ob dementsprechend auch an das Verfahren besondere, innovative und außerordentliche Ansprüche gestellt werden: Zu jedem besonderen „Produkt“ gehört ein besonderer Schaffensprozess. Auch diesem soll nachgegangen werden: Wessen bedarf der Schriftsteller, um schreiben zu können, welche Voraussetzungen in Umfeld und Geisteszustand muss er sich schaffen? Woraus schöpft er, wessen bedient er sich?
Inhaltsverzeichnis
- I - Einleitung
- II - Konstitutive Elemente von „Inspiration“- ein begriffsgeschichtlicher Abriss.
- 1. Das Verständnis in der Antike.
- 1.1. Platon: Der Enthusiasmusgedanke
- 1.2. Die Anrufung der Musen
- 1.3. Inspiration als Dichotomie des Gebens und Empfangens
- 2. Inspiration in der Heiligen Schrift.
- 3. „Inspiration“ während der Aufklärung
- 4. Abgrenzung zum Genie-Gedanken des 18. Jahrhunderts.
- 5. Fazit
- III - Werkebenen in Les Faux-Monnayeurs
- 1. Definition der Mise en abyme
- 2. Die Mise en abyme in Les Faux-Monnayeurs
- 3. Fazit
- IV - Inspirationsbedingte Wirkungen Analyse
- 1. Prädisposition der „Kreativen“
- 1.1. Édouards Selbstverständnis
- 1.2. Wie erfährt Édouard Enthusiasmus?
- 1.3. Kontrastfiguren Passavant und Lady Griffith
- 2. Die Rolle Lauras
- 2.1. Einfluss Lauras auf das frühere Romanprojekt
- 2.2. Verlust des Einflusses
- 2.3. Verarbeitung des Inspirationsverlusts durch den Romancier.
- 2.4. Urteil des Erzählers und aktuelle Bedeutung Lauras für Édouard
- 3. Gewinnung von Romanstoff.
- 3.1. Konkrete Personen als Ausgangspunkt für literarisches Schaffen
- 3.2. „Êtres en formation“
- 3.3. „Gravitation“ und Feldgedanke
- 4. Visitation divine vs. Kontrolle über das Schreiben
- 5. Die Rolle Oliviers
- 5.1. Facetten einer gegenseitigen Zuneigung
- 5.2. Das Anziehungsfeld zwischen Édouard und Olivier.
- 5.3. Entladung einer Spannung.
- 5.4. „Cerveau dispos“
- 6. Verhältnis von Werk und Leben
- 7. Fazit
- 7.1. Subjektive Betrachtung aus Sicht Édouards.
- 7.2. Erklärungsversuche „von außen“
- V - Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Bachelorarbeit befasst sich mit dem Thema der Inspiration im literarischen Schaffen. Sie analysiert den Roman „Les Faux-Monnayeurs“ von André Gide, um zu untersuchen, inwieweit Inspiration eine Rolle im dargestellten Schreibprozess spielt.
- Die unterschiedlichen Bedeutungsfacetten des Inspirationsbegriffs in der Geschichte
- Die Konstruktion der literarischen Wirklichkeit in „Les Faux-Monnayeurs“ durch die Mise en abyme
- Die Rolle der Figuren Édouard, Laura und Olivier im Prozess des literarischen Schaffens
- Die Interaktion zwischen dem Schriftsteller und seiner Umgebung als Inspirationsquelle
- Das Verhältnis von Werk und Leben in „Les Faux-Monnayeurs“
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik der Inspiration im Kontext von André Gides Roman „Les Faux-Monnayeurs“ ein und stellt die Forschungsfrage nach dem Einfluss von Inspiration auf den Schreibprozess des Protagonisten Édouard. Das zweite Kapitel beleuchtet die historische Entwicklung des Inspirationsbegriffs, beginnend mit der Antike und seinen unterschiedlichen Facetten. Kapitel III erläutert die Konstruktion der literarischen Wirklichkeit in „Les Faux-Monnayeurs“ durch die Mise en abyme. Kapitel IV analysiert die Inspirationsbedingten Wirkungen im Roman, indem es die Prädisposition des Protagonisten, die Rolle der Figuren Laura und Olivier sowie die Gewinnung von Romanstoff beleuchtet. Abschließend werden das Verhältnis von Werk und Leben sowie die subjektive und objektive Betrachtung des Schreibprozesses untersucht.
Schlüsselwörter
Inspiration, „Les Faux-Monnayeurs“, André Gide, literarisches Schaffen, Mise en abyme, Édouard, Laura, Olivier, Romanprojekt, Schreibprozess, Enthusiasmus, „Êtres en formation“, „Gravitation“, Feldgedanke, Visitation divine, Kontrolle über das Schreiben, Verhältnis von Werk und Leben.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das zentrale Thema dieser Untersuchung zu André Gides Roman?
Die Arbeit untersucht den Prozess des literarischen Schaffens in „Les Faux-Monnayeurs“ und geht der Frage nach, ob dieser Prozess auf Inspiration beruht.
Was versteht man unter der „Mise en abyme“ in diesem Werk?
Es handelt sich um eine Verschachtelung: Der Roman handelt von einem Autor (Édouard), der selbst einen Roman mit dem Titel „Les Faux-Monnayeurs“ schreibt, was den Schaffensprozess auf mehreren Ebenen spiegelt.
Welche historischen Bedeutungen von „Inspiration“ werden beleuchtet?
Die Arbeit gibt einen Abriss vom Enthusiasmusgedanken Platons in der Antike über die biblische Inspiration bis hin zum Genie-Gedanken des 18. Jahrhunderts.
Welche Rolle spielen die Figuren Laura und Olivier für den Protagonisten Édouard?
Laura und Olivier fungieren als Inspirationsquellen oder Kontrastfiguren, deren Einfluss auf das Romanprojekt und den emotionalen Zustand des Schriftstellers analysiert wird.
Wie gewinnt der Schriftsteller in Gides Roman seinen Stoff?
Der Stoff wird aus konkreten Personen („Êtres en formation“) und der Beobachtung der Umgebung gewonnen, wobei das Verhältnis zwischen Werk und Leben eine zentrale Rolle spielt.
- Arbeit zitieren
- Katja Federhen (Autor:in), 2012, Literarisches Schaffen in André Gides "Les Faux-Monnayeurs". Ein auf Inspiration beruhender Prozess?, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/295298